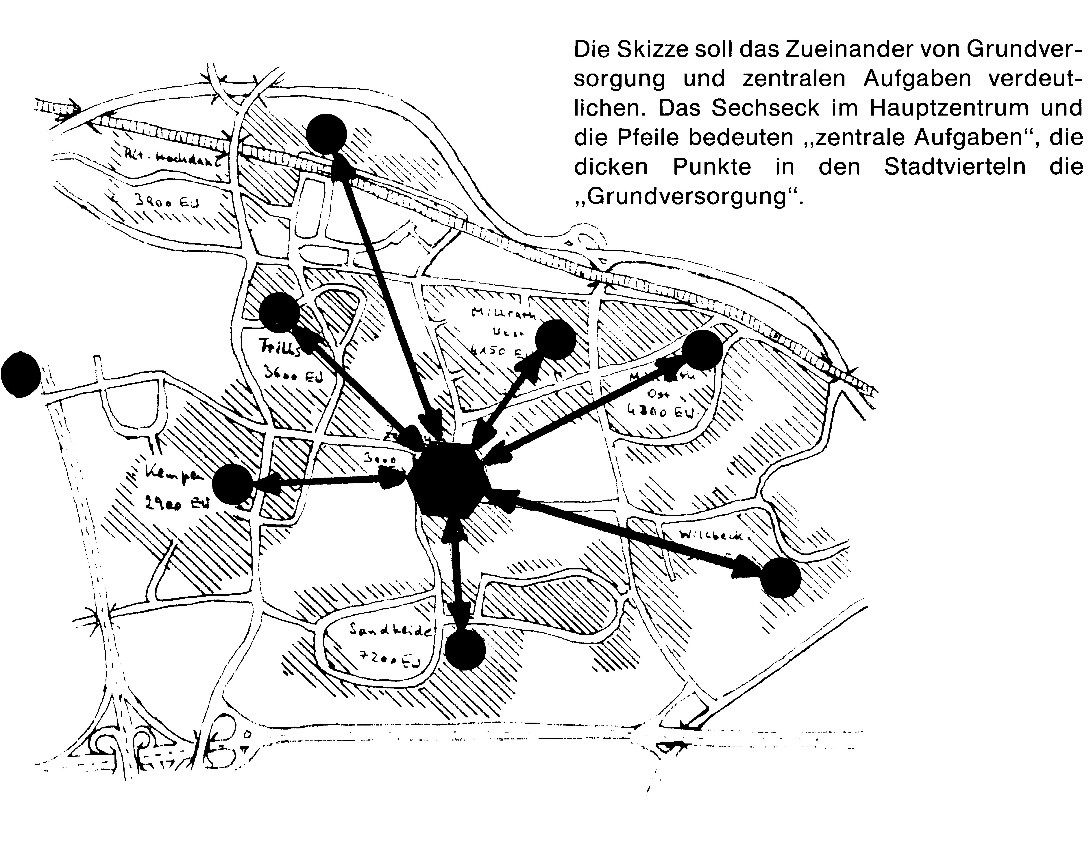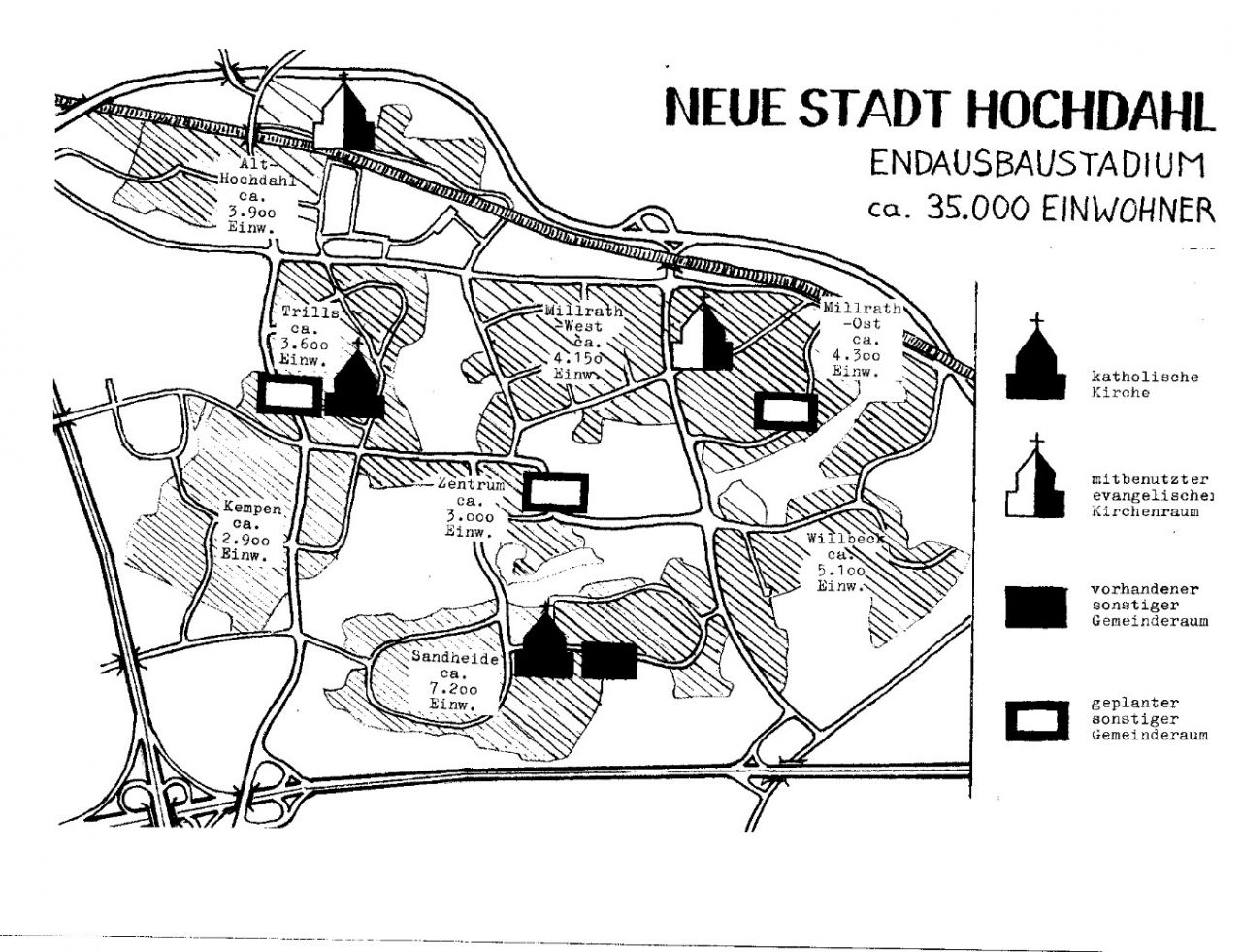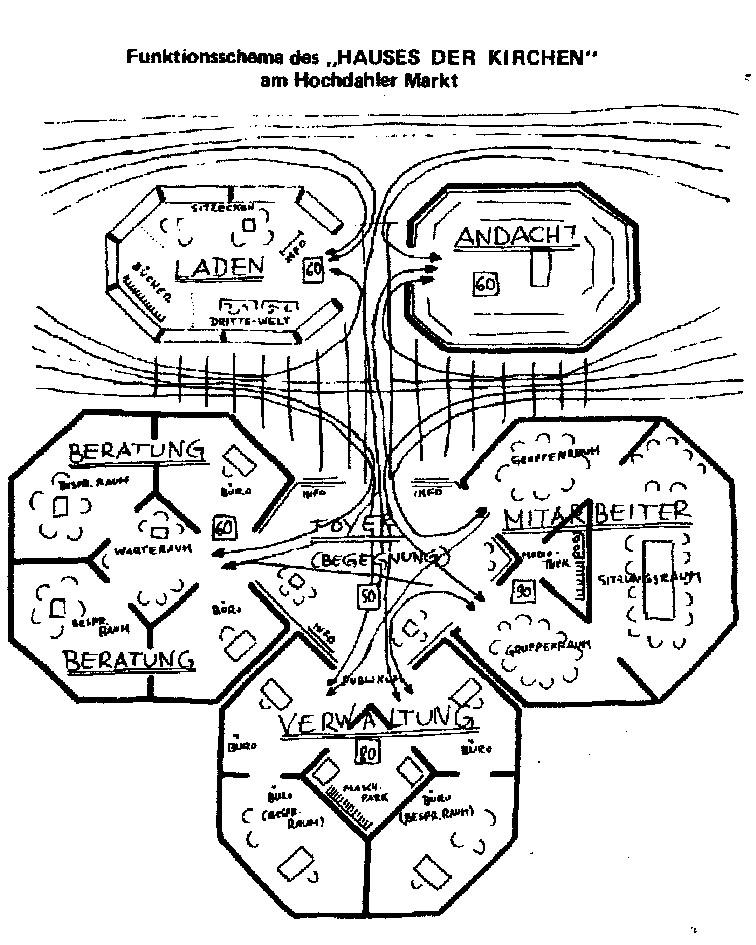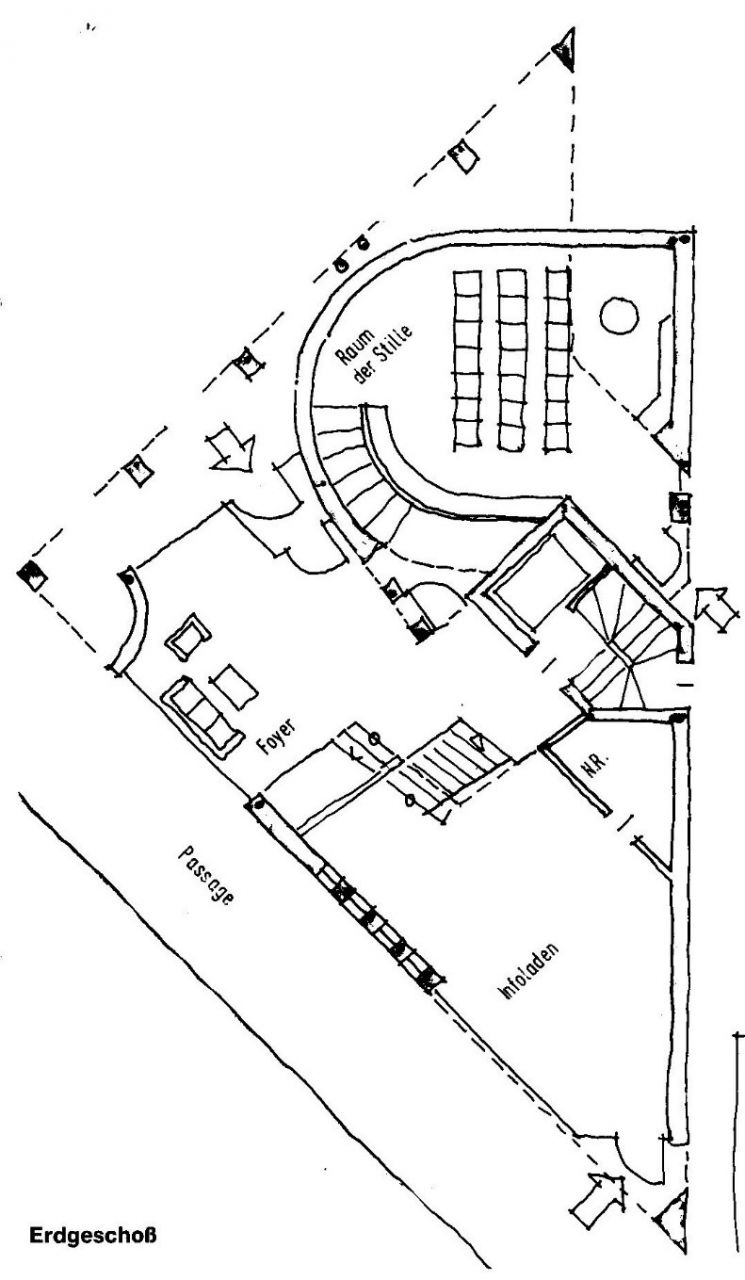0. Wer sucht, der findet
Diese Überschrift kam mir in den Kopf, als ich überlegte, warum ich meine Erinnerungen an unsere Arbeit in der Hochdahler katholischen Gemeinde veröffentlichen wollte. Suchen und fragen war eine wichtige Haltung während all der Jahre. Und sie hat unsere Arbeit sehr deutlich geprägt. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Leser dadurch angeregt und ermutigt, noch etwas mehr und intensiver über das Leben in der Gemeinde nachzudenken.
Und dann ging ich zurück auf die Stelle im Evangelium, wo dieser Spruch steht – im Lukasevangelium Kapitel 11, Verse 5-13 (Der Text ist weiter unten abgedruckt). Und ich war fasziniert, als ich anfing zu begreifen, wie wichtig diese Stelle für die Arbeit in der Gemeinde ist. Da steht ein sehr dringender, fast beschwörender Appell Jesu an seine Jünger, der den Satz aus der Überschrift doppelt und dreifach formuliert. „Deshalb sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.“ (Lk 11,9f) Ein Appell an die Jünger – ein Appell an die Glaubenden und Getauften, an die Gemeinde heute!
Wenn die Jünger, wenn die Gemeinde den Worten Jesu folgt, dann wird ihnen eine Verheißung zuteil. Die wird mit einem Beispiel aus dem Leben der Familie eingeleitet. Ein Vater wird doch seinem Sohn, der ihn um einen Fisch oder ein Ei bittet, nicht stattdessen etwas Tödliches geben. Und dann die Verheißung: „Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geit denen geben, die ihn bitten.“ (Lk 11,13)
Bitten, suchen, anklopfen – den Himmel bestürmen – und die Gabe von oben ist der Heilige Geist. Damit sind die Form und das Ziel des Suchens und Bittens eindeutig bestimmt – und genau so die Eigenart des Findens.
Irgendwann im Laufe der Geschichte gab es dann die gedruckten Bibeln. Und die Herausgeber haben den Text des Evangeliums in Abschnitte unterteilt und jedem Abschnitt eine Überschrift gegeben. Diese Überschrift gehörte und gehört nicht zum biblischen Text. Und siehe da: der Text Lk 11, 5-13 bekam die Überschrift: Vom Vertrauen beim Beten. Diese Überschrift ist falsch, weil sie die Aussage des Textes überhaupt nicht wiedergibt.
Da muss man sich fragen, wie es zu dieser irreführenden Überschrift kommen konnte. Das müsste ein Fachmann klären. Meine Erklärung dafür: Als das geschah, gab es in der Kirche keinen Spielraum für Bitten, Suchen und Anklopfen. Alles war für die Gemeinden klar und geregelt. In meinen Kindertagen konnte man die Vorstellung haben, dass alle Bewohner des Dorfes gute Christen waren, wenn sie die 10 Gebote hielten und regelmäßig beichten gingen. Der Appell Jesu im Evangelium wurde dadurch zu einer Ermahnung, wie man beten sollte.
Nach dem Konzil war das Volk Gottes jedoch wieder aufgerufen, sich mit Kopf und Herz den Weg zur Gemeinde Jesu Christi zu bahnen und den Beistand des Heiligen Geist zu erbitten. Wollen wir es gemeinsam wieder tun? Eine 2000-jährige Geschichte und unser aller Erfahrungen sind dafür eine gute Grundlage.
Der Text des Evangeliums. Lukas 11, 5-13.
(5) Und er sagte zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote; (6) denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts anzubieten, (7) wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? (8) Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht.
(9) Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. (10) Denn wer bittet, der empfängt; wer such, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. (11) Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, (12) oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? (13) Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.
1. Im Dienst an der Gemeinde
Es war eine eigenartige Geschichte, die sich nach der Firmung im Jahr 2005 in Hochdahl abspielte. Vorher hatten wir etwas Sorge. Der neue Weihbischof sollte die Firmung spenden und es war uns nicht klar, was wir zu erwarten hatten. Die Unsicherheit entstand aus den Erzählungen, Kardinal Meisner würde zur Firmung vor dem Altar Platz nehmen und die Firmlinge müssten sich vor ihm hinknien. Das schien uns für unsere jungen Erwachsenen, die durchweg 17 bis 18 Jahre alt waren, eine unangemessene Form zu sein. Ein Gespräch mit dem Weihbischof zerstreute allerdings diese Ängste.
Nach der Firmung war der Weihbischof schon in den Pfarrsaal hinaufgegangen, wo wir üblicherweise nach dem Gottesdienst noch etwas zusammenblieben. Ich war noch in der Sakristei und auch der Sekretär des Bischofs war noch da und eröffnete mir, dass der Bischof nicht lange bleiben könne, da er noch einen Hausbesuch machen müsste. Wie das Gespräch dann lief, weiß ich nicht mehr – bis zu der recht lauten Stellungnahme des Sekretärs: „Nicht Gemeinde – Kirche, Kirche!“ Und dieser Ausspruch kam mit einer derartigen Emotionalität, dass ich nur verwundert und verständnislos dagestanden bin. Natürlich habe ich gespürt, dass sich diese Attacke gegen unsere Arbeit und unsere Vorstellungen in Hochdahl richtete.
Nicht „Gemeinde“? Als wir in Hochdahl anfingen (1968/70), hatten wir keinen Zweifel daran, dass es um „Gemeinde“ ging. Die eigenartigen Konstrukte von Event-Seelsorge oder Großpfarrei mit 20.000 und mehr Mitgliedern waren noch nicht erfunden. Und wenn heute jemand meint oder sagt, die Kirche sei ein Dienstleistungsunternehmen, dann fällt mir immer wieder ein, wie sehr wir uns gegen das Bild von der Service-Station gewehrt haben.
Die Aufgabenstellung war klar und wir sind mit Schwung, Idealismus und viel Freude an die Arbeit gegangen. Wir konnten uns stützen auf eine – wie mir scheint – sehr solide theologische Ausbildung. Wir hatten im Sommer 1960 Ratzingers Vorlesung über die Kirche gehört, die uns begeistert und geprägt hat. Und von der Kirchengeschichte bis zum Neuen Testament hatten wir in Bonn sehr gute Professoren. Und während wir in Köln im Seminar waren, begann das Konzil und mit innerer Anteilnahme hörten wir die Botschaft Johannes’ XXIII. an die Deutschen. Und dann die Erneuerung der Liturgie, in langen Jahre vorbereitet, als Konzilsdokument verabschiedet – sie eröffnete einen ganz neuen, lebendigen Zugang zum Gottesdienst. Und die Vorstellung von Kirche als Gemeinschaft und Volk Gottes lag so sehr in der Luft, dass man nur tief einatmen musste, um diese beglückende Wahrheit über unser Zusammenleben als Glaubende in sich aufzunehmen.
Aus der Ratzinger-Vorlesung stammte vermutlich die zentrale Bedeutung, die Taufe und Eucharistie in unserem Kirchen- und Gemeindebild hatten. Die Taufe ist der alles entscheidende Vorgang, in dem der Mensch in die Gemeinschaft der Jünger Jesu aufgenommen wird. Er empfängt neues Leben, eine ganz neue Existenzform. Ich erinnere mich, wie sehr mich in der Vorlesung von Michael Schmaus – Dogmatiker in München – diese Vorstellung von „neuem Leben“ beschäftigt hat. Und nach der Taufe kann keiner mehr als „Privatmann“ leben, immer lebt er in der Gemeinschaft des Geistes Gottes. Diese Vorstellung ist so tiefgehend und anspruchsvoll, dass man immer wieder versucht ist zu fliehen – in die Alltäglichkeit oder in weniger verbindliche Umstände. Ein Getaufter gehört nicht mehr sich selbst und er gehört nie einem anderen Menschen bedingungslos. „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (vgl. 1 Kor 6,19) In einer Zeit, als mehr oder weniger alle Bewohner einer Gegend getauft waren – normalerweise sogar als Säuglinge – konnte die Taufe natürlich nicht als eine solche Veränderung der eigenen Existenz erfahren werden. Man erinnerte sich ja auch nicht daran. Da konnte es geschehen, dass man es als eine Bekehrung zu Jesus Christus interpretierte, wenn jemand Priester oder Nonne oder Mönch wurde. Getauft waren alle, in den „Stand der Vollkommenheit“ (!) kamen nur wenige. Viele in der älteren Generation werden noch mit solchen Vorstellungen groß geworden und vielleicht auch Priester geworden sein. Für seinen Glauben und den Herrgott etwas Besonderes tun! Und es gab ja sogar eine Theorie von zwei verschiedenen Verbindlichkeiten der Botschaft Jesu: die normalen Christen konnten das alles ja nicht so genau nehmen; die aus dem Evangelium abgeleiteten, so genannten „evangelischen Räte“ waren der Weg für die, die es ernster meinten! Ich glaube nicht, dass sich diese Theorie auf die Verkündigung Jesu berufen kann. Zudem nimmt sie dem Streben nach Vollkommenheit die Dynamik. Ist man nämlich in der richtigen Gruppe angekommen, hat man das Ziel schon erreicht!
Nun ist diese Zeit der Volkskirche ja bei uns offensichtlich endgültig vorbei. Und das war auch schon vor 40 Jahren so. Warum hängt man immer noch an den alten Vorstellungen, statt damit ernst zu machen, dass die Gemeinde, dass die Gemeinschaft aller Getauften für die Zukunft der Kirche steht? Das wäre eine Bekehrung, die ihre Kraft aus der Botschaft Jesu beziehen könnte!
2. Die „neue Stadt Hochdahl“
Hochdahl wurde geplant als eine von drei Modellstädten in Nordrhein-Westfalen. Die beiden anderen waren Wulfen (in der Nähe von Marl) und Meckenheim-Merl. Eine Entwicklungsgesellschaft, in der die verschiedensten Institutionen des Landes und der Kommunen vertreten waren, war für die Planung, Erschließung und Bauausführung zuständig. Den Namen bekam die neue Stadt von einem alten Ortskern in der nordwestlichen Ecke des Bebauungsgebietes. Eisenbahnfreunde in der Region erinnerte der Name an ein Kuriosum der Eisenbahngeschichte: bis in die Nachkriegszeit konnten die Züge den steilen Aufstieg von Erkrath nach Hochdahl nur mit der Unterstützung einer zweiten Lok schaffen, die in älteren Zeiten sogar talwärts fuhr und den Zug mit einem Seil über eine Umlenkrolle nach oben zog. Und bei vielen Bewohnern Düsseldorfs war die Gegend vor allem als Ziel für die sonntäglichen Familienausflüge beliebt.
Die neue Stadt sollte ursprünglich im Endausbau 45.000 Einwohner haben. Entsprechend groß war das für die Bebauung vorgesehene Gebiet. Es liegt heute in der Nordost-Ecke des Hildener Autobahnkreuzes und wird im Westen und Süden von der A3 und der A46 begrenzt und im Norden von der Eisenbahnlinie Düsseldorf-Wuppertal. Bei einer solchen Größenordnung ist die Gefahr groß, dass ein Neubaugebiet zu einer wüsten Ansammlung von Wohngebäuden wird, ohne ein städtebauliches „Gesicht“ zu bekommen. Es ist zweifellos das Verdienst der Stadtplanung unter der Federführung von Professor Aloys Machtemes, eine solche Entwicklung in Hochdahl vermieden zu haben. Der Aufbauplan sah eine Gliederung des Gebietes in sieben so genannte Quartiere vor. Es hieß damals, das entspreche den modernen städtebaulichen Konzepten. In Hochdahl legte die Topografie der Landschaft eine solche Gliederung von vorneherein nahe. Kleine Waldzüge und ein paar Bäche mit ihren kleinen Tälern prägten das Bild und haben möglicherweise den Stadtplaner entsprechend inspiriert. In diesen Quartieren sollte die Zahl der Bewohner überschaubar bleiben, um Kontakte und gemeinschaftliche Lebensformen zu ermöglichen. Fußläufig sollten alle wichtigen Einrichtungen erreichbar sein – Schulen und Kindergärten, Treffpunkte und Geschäfte. Deshalb sollte jedes Quartier auch ein voll funktionierendes Subzentrum bekommen. Das erwies sich allerdings im Laufe der Zeit als nicht durchführbar. Spätestens als das Stadtzentrum errichtet wurde, ging man zum Arzt oder zum Einkaufen meist dorthin oder fuhr noch lieber nach Düsseldorf. Einige geplante Subzentren wurden deshalb gar nicht mehr gebaut und die schon errichteten verloren viel von ihrer vorgesehenen Funktion. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass einige Jahre nach Beginn der Bebauung die Pläne von der zukünftigen Größe Hochdahls stark reduziert wurden. Als der Ausbau praktisch abgeschlossen war (etwa 1990), hatte Hochdahl – als Stadtteil von Erkrath – ungefähr 27.000 Einwohner. Und diese Zahl blieb relativ stabil.
Beim Aufbau der katholischen Kirchengemeinde hielten wir uns zunächst an die Vorgaben der Stadtplanung. Es ging – bei einer zu erwartenden Größe von 20.000 Katholiken –vor allem darum, kein übergroßes, anonymes Gebilde als Gemeinde entstehen zu lassen. In vergleichbarer Situation (Neubaugebiet Düsseldorf-Garath) versuchte man, dieses Ziel
dadurch zu erreichen, dass man die katholischen Bewohner auf zwei Pfarreien (drei Kirchen) verteilte. Dass man die im Jahre 2007 wieder zusammenführen würde, war 1970 natürlich nicht vorauszusehen. Trotzdem zeigt dieser Vorgang, dass wir in Hochdahl die bessere Perspektive verfolgt haben: die ganze Stadt blieb eine Gemeinde. Auch für Hochdahl waren wohl in den ganz frühen Überlegungen drei Pfarreien vorgesehen. Doch wurde diese Vorstellung bald wieder fallen gelassen. Um auch bei einer Pfarrei für die ganze Stadt die Überschaubarkeit nicht aufs Spiel zu setzen, war es nötig, die Quartiere genauso ernst zu nehmen wie die ganze Stadt. Der Aufbau der Gemeinde und die seelsorgliche Arbeit mussten sich deshalb gleichzeitig auf zwei Ebenen vollziehen. Alle Lebensvollzüge der Gemeinde, die sich auf die grundlegenden Formen des Zusammenlebens bezogen, sollten ihren Ort in den Stadtvierteln haben. Dazu gehörten Kindergärten, Kommunion- und Bussvorbereitung, Kindergruppen, Ehekreise, Altenclubs. Diesen Teil der Seelsorge nannten wir „Grundversorgung“. Auf der Ebene der ganzen Stadt sollten alle Leitungsaufgaben wahrgenommen werden. Spezialisierte Angebote, wie zum Beispiel Arbeitskreise von Katecheten, Lehrern und Erzieherinnen oder auch das Ökumenische Bildungswerk sollten zentral angeboten werden, da man dann mit einer hinreichend großen Zahl von Interessenten rechnen konnte. Pfarrfeste oder Karneval fanden zwar an wechselnden Orten statt, waren aber natürlich Feste für alle. Diese Lebensvollzüge nannten wir „Zentrale Aufgaben“.
3. Eine große Sache
Im Jahre 1968 begann im großen Stil der Aufbau der neuen Stadt Hochdahl. Die Entwicklung der Bautätigkeit vollzog sich unheimlich rasant. Innerhalb von wenigen Monaten entstanden hunderte neue Wohnungen. Und mit einem entsprechenden Tempo schoss die Zahl der neuen Bewohner in die Höhe. … Zunächst waren es vor allem die beiden östlichen Wohnbereiche Willbeck und Millrath-Ost, die in einer gemischten Bebauung von Hochhäusern und Reihenhäusern errichtet wurden. In Sandheide entstand das so genannte „Individualbaugebiet“ – vorwiegend Bungalows und Reihenhäuser in der Sandheider Straße – und eine „verdichtete“ Bebauung an der Schildsheider Straße. Es waren vor allem junge Familien, die nach Hochdahl kamen. Natürlich wurden die zunächst Zuziehenden mit den gleichen Erfahrungen konfrontiert, die von allen Neubaugebieten bekannt sind: unfertige Straßen, Baufahrzeuge, Baulärm – und schmutzverkrustete Schuhe vor den Eingängen. Aber bei dem hohen Tempo des Baufortschritts konnten die Neubürger die Hoffnung haben, dass sie bald in einer angenehmen Umgebung leben würden. Das war auch einer der Gründe für den zügigen Aufbau. Ich erinnere mich an einen Ausspruch des Stadtplaners Professor Machtemes, man könne den Leuten nicht zumuten, jahrelang in einem Provisorium zu leben. Es war eben eine große Sache, was in Hochdahl verwirklicht werden sollte.
Viele, die in den ersten Jahren in Hochdahl zuzogen, kamen mit einer hohen Motivation. Das ist wohl immer die Voraussetzung, wenn man die bisherigen bekannten und vielleicht auch liebgewordenen Lebensbedingungen verlässt und in eine neue und unbekannte Umgebung zieht. Aber in Hochdahl ging es nicht nur darum, das neue Haus und die Wohnung zu gestalten, eine neue Beziehung zu Nachbarn aufzubauen und den Weg zu Kindergarten, Lebensmittelgeschäften, Ärzten und Apotheken zu finden. In Hochdahl mussten die Neubürger gleichzeitig eine neue Stadt aufbauen. Bezieht man zum Beispiel heute in Gerresheim hinter der B7 eine Wohnung in einem Neubaugebiet, dann begibt man sich in einen Rahmen, bei dem fast alles vorbereitet und festgelegt ist. Die Geschäfte, Schulen, Kirchen und das Krankenhaus sind schon da und man braucht sich bloß einzupassen. Das ist bequem oder zumindest entlastend, aber es gibt keine Möglichkeit mehr, neue Lebensformen für sich selbst und das Leben mit andern auszuprobieren. Die neue Stadt Hochdahl wurde – fast – auf der grünen Wiese gebaut. Ganz am Anfang gab es nur ein paar (provisorisch untergebrachte) Lebensmittelläden, einen Laden für Hausrat, ein paar (neue oder alteingesessene) Ärzte, Schulen im Aufbau. Und der Rest war – Offenheit, Möglichkeiten, Nichtfestgelegtes. Und bei den Neubürgern gab es viele Wünsche, Vorstellungen, Gestaltungsvorschläge und vor allem ganz viel innerer, seelischer Platz. Ich vermute, dass das die große Chance Hochdahls war, dass es keine ideologische oder pseudotraditionelle Festlegung gab, wie das Zusammenleben in dieser Stadt auszusehen hätte. Viele Neubürger haben vermutlich diese seltene Chance gespürt und waren bereit, sich nicht nur um ihre privaten Belange zu kümmern, sondern miteinander eine Stadt aufzubauen, in der man menschlich leben kann. Viele Impulse und viel Unterstützung für solche Einsatzbereitschaft kamen im Laufe der Jahre von der Entwicklungsgesellschaft, den städtischen Gremien, dem Bürgerverein, dem sehr aktiven Sportverein TSV, und sicher auch von den Kirchengemeinden. Auch und gerade dieser innere Aufbau der neuen Stadt war für viele Beteiligte eine große Sache.
Es gab auch innerhalb des Baugebiets der neuen Stadt Hochdahl alte Wohngebiete: das schon erwähnte alte Hochdahl (das in der neuen Stadt dann Alt-Hochdahl hieß), Trills und Millrath.
Diese Siedlungen hatten eine dörfliche Struktur und weder die Größe noch das Selbst-bewusstsein oder die prägende Kraft wie zum Beispiel das oben erwähnte Gerresheim. Sie konnten deshalb nicht ihre Lebensgewohnheiten oder Vorstellungen zum Maßstab für die neue Stadt machen. Das hat in den ersten Jahren immer wieder zu Reibereien und Konflikten geführt. Meist waren Kleinigkeiten der Anlass. Sollte dieses oder jenes alte Gebäude abgerissen werden, weil es nicht in die Konzeption der neuen Stadt passte? Oder musste es nicht gerettet werden, weil man doch nicht alles Alte beseitigen kann? Sollte man deshalb nicht besser die geplante Straße verändern und um den alten Bau herumführen – auch wenn das ein Hindernis für den Verkehrsfluss bedeutete? Von heute her gesehen scheint es, dass sich in diesem vielfältigen Streit um konkrete, kleine Veränderungen eine viel grundlegendere Problematik äußerte: wenn man eine neue Stadt in ein alte Landschaft hineinbauen will, bringt das die Zerstörung alter Bilder, vertrauter Gegenstände und liebgewordener Sicherheiten mit sich. Oft hörte man in den ersten Jahren, wie schön man früher zwischen Hochdahl, Haan und Gruiten wandern konnte – da, wo jetzt die neue Stadt gebaut wird! Und die Sedenquelle, wohin sich früher junge Leute auf den Weg machten! Und das gute Wasser am Ort, das doch viel besser war, als was man aus Wuppertal geliefert bekam! Das Neue, Ungewohnte hat es oft schwer, weil so viele am Hergebrachten festhalten möchten. Und dieses Bedürfnis ist oft unabhängig davon, wie wertvoll das Alte ist. Man möchte nicht verzichten oder man möchte keinen Verlust verarbeiten müssen.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele solcher Querelen gegen das Konzept und den konkreten Aufbau der neun Stadt Hochdahl richteten. Ob das nur eine Sache von Stimmung und Gerede war oder ob dabei ernste Probleme eine Rolle spielten, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche konkreten Hintergründe den neugewählten Gemeinderat zu seiner Entscheidung veranlasst haben: er beschloss jedenfalls im Jahr 1972, den Stadtplaner Professor Aloys Machtemes zu entlassen. Sein Aufbaukonzept für die neue Stadt Hochdahl konnte glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt nicht mehr grundlegend verändert werden. Und durch all die Jahre ist diese Stadt von den neuen Bewohnern wirklich angenommen worden.
4. „Abraham, zieh fort, zieh fort …“
„Gott begegnet im Aufbruch“ ist der Titel eines Buches von Norbert Scholl, das ich vor Jahren mit Gewinn gelesen habe. Das markanteste Beispiel für diese Deutung religiösen Verhaltens ist Abraham, zu dem Gott spricht: „Zieh weg aus deiner Heimat … und geh in das Land, das ich dir zeigen werde“. Und in diesem Land, nämlich in Kanaan, begleitet dieser Gott seinen Herausgerufenen und gibt ihm seine Verheißungen – Nachkommenschaft, der Besitz des Landes, Segen für alle Völker. Wir haben in der Arbeit mit den Begleitern der Firmvorbereitung mehrmals diese Berufungssituation des Abraham durchgespielt, vor allem mit der Frage, was ihn an eigener Einsicht, an eigenen Erfahrungen bewegt haben mag, aus der alten Heimat wegzuziehen. Sehr einsichtig war uns dabei immer wieder, dass er möglicherweise die religiösen Praktiken seiner Umgebung, die Rituale und Aufmärsche und Opferriten nicht mehr ertragen hat. Immerhin lebte er im Norden des Zweistromlandes, wo es eine religiöse Kultur in hoher Blüte gab. Und so schlossen wir, dass eine festgefahrene Religiosität der Grund sein kann, durch den Gott einen Menschen ruft aufzubrechen.
Ein solcher Aufbruch war ja zweifellos die eigentliche Intention des Konzils. Es wollte doch das Leben der Kirche von den Verkrustungen der Vergangenheit befreien, die Fenster sollten weit aufgemacht werden für den frischen Wind der Erneuerung, ein neues Pfingsten sollte im Gebet erfleht und das Volk Gottes dafür bereitet werden. Und wenn Hans Urs von Balthasar einige Jahre vor dem Konzil einem Buch den Titel gab „Die Schleifung der Bastionen“, dann waren doch die Bastionen gemeint, hinter denen sich die Kirche verschanzt und scheinbar unangreifbar gemacht hatte. Eigentlich hätte doch um 1970 herum ein solcher Aufbruch dann auch in den Gemeinden vollzogen werden müssen, gewissermaßen als Anwendung der Konzilsergebnisse. Wenn ich dann heute feststelle, dass die seelsorglichen und liturgischen Praktiken in manchen Gemeinden die gleichen sind wie in meinen Kindertagen – unmittelbar nach dem Krieg –, dann darf man doch wohl fragen, warum diese Gemeinden unbedingt in den Verkrustungen der Vergangenheit verharren wollten. Andererseits kann man auch erfahren, wie schwierig es ist, in der Realität solcher Gemeinden neue Wege zu finden. Es herrscht oft die Auffassung, der Glaube fordere, dass alles bleibt, wie man es in Kindertagen gelernt hat. Und der Versuch, über den Glauben und das Leben nachzudenken, halten manche für den ersten Schritt in den Glaubensabfall. Und die Kirchenleitungen – wer das auch immer konkret ist – kreisen um das Problem des Priestermangels und zeigen damit nur, wie weit sie sich von dem Aufbruch des Konzils entfernt haben. Was war es demgegenüber für eine wunderbare Chance, die uns und den neuen Bürgern in Hochdahl religiös geboten wurde!
Damals waren etwas mehr als 40% der Menschen, die nach Hochdahl zuzogen, katholisch. Und viele davon kamen mit einer hohen Motivation. Darf man diesen Auszug aus den alten Lebensbedingungen mit der Berufung des Abraham vergleichen oder darin eine Möglichkeit der Verwirklichung des Konzils sehen? Glaubende, die gerufen sind, in ein neues Land aufzubrechen – zumindest in eine neue Stadt! Wir jedenfalls sind mit dem Schwung des Konzils an die Arbeit gegangen. Diese Deutung ist damals natürlich so nicht formuliert worden, wenn auch vielleicht manches davon im Unterbewusstsein vorhanden war und wirkte. Unser Blick war stärker auf die praktischen Erfahrungen und Vorgänge gerichtet. Wer seine bisherige Umgebung verließ, verlor normalerweise ein Stück seiner Beheimatung und seiner Tradition. Wer wegzog, konnte der Gruppe oder dem Verein, in dem er bis dahin eingebunden war, höchstens noch sporadisch oder auf Entfernung angehören. Viele werden sich auch ganz verabschiedet haben. Und vielleicht war es für den einen oder anderen auch wirklich ein Weg in die Freiheit, sind Vereine mit ihrer Tradition doch oft auch einengend und belastend. Aufzüge, Feste, Feiern – und immer dasselbe und immer alles selbstverständlich. Viele haben offensichtlich dieser ihrer Vergangenheit nicht nachgetrauert. Andererseits gab es aber auch den Mann, der über all die Jahre in Hochdahl lebte und fest eingebunden war, in der Karnevalszeit aber regelmäßig im Elferrat der Katholischen Jugend in Düsseldorf saß. Wahrscheinlich ein Beispiel für viele. Warum auch nicht? Es ist auch bekannt, dass es Leute gegeben hat, die nach einem „Schnupperkurs“ in der neuen Stadt Hochdahl doch recht schnell wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind.
Was viele aus ihrer bisherigen Umgebung mitbrachten und was den Aufbau der Franziskusgemeinde in der neuen Stadt getragen hat, war eine hohe Identifikation mit Glaube und Kirche. Es gab Menschen, die noch im prägenden Milieu des Münsterlandes und in einer betont christlichen Familie groß geworden waren. Andere waren in der alten Pfarrei aktiv gewesen, weil der Pastor auf sie aufmerksam geworden war und sie in der Jugendarbeit eingesetzt hatte. Und der Obermessdiener von Gerresheim hatte eben nicht nur den „Dienst am Altar“, sondern gleichzeitig auch die Mitverantwortung für die Pfarrei gelernt. Gleichzeitig waren die Erfahrungen und Vorstellungen, die sie für das Leben in der neuen Gemeinde mitbrachten, sehr unterschiedlich. Sie kamen ja auch von überall her nach Hochdahl. Aus dieser Verschiedenheit einen Weg in eine gemeinsame Zukunft zu finden, war eine spannende Aufgabe.
Und sehr viele waren bereit, sich auf diese Aufgabe einzulassen. Immer wieder haben wir gefragt, überlegt, diskutiert und ausprobiert, wie es denn gehen könnte. Und dazu waren alle eingeladen und aufgerufen. Im Pfarrausschuss und dem daraus entstehenden Pfarrgemeinderat, in Arbeitsgruppen (z.B. „Jugendausschuss“) und in Versammlungen für die ganze Gemeinde ging es manchmal hoch her; aber es entwickelten sich auch Erkenntnisse und Lösungen. Das Ziel war eine Gemeinde, in der man heute als Mensch und Christ leben kann. Deshalb verbot es sich, die alten Formen und Strukturen wieder einzuführen. Wir hatten von Anfang an in Hochdahl keine kirchlichen oder „kirchennahen“ Verbände, keine KAB, keinen BdkJ, keine Pfadfinder, keine Schützen, keinen Karnevalsverein. Natürlich haben wir die alte Kolpinggruppe nicht aufgelöst und auch die Frauengemeinschaft war resistent gegen unseren grundsätzlichen (theologisch gut begründeten) Ansatz. Wir waren der Meinung, dass es genügt, sich in der Gemeinde als Glaubende zusammenzufinden und aus diesem Zentrum heraus alle möglichen Lebensformen zu entwickeln. Wen wundert, dass im Laufe der Jahre die katholische Franziskusgemeinde in Hochdahl als exotisch oder anormal oder gar als „nicht mehr ganz katholisch“ eingeschätzt wurde.
5. Die Ehekreise
Pfarrer Hans Meixner, der seit 1958 in Trills Pastor war (Hochdahl und Millrath gehörten auch zur Pfarrei) nahm die Aufgabe, die sich ihm mit der neuen Stadt stellte, mit sehr viel Engagement und Bereitschaft an. Obwohl er 1958 eigentlich in eine kleine Gemeinde gekommen war und das sicherlich auch so gewollt hatte, kümmerte er sich intensiv um den inneren und äußeren Aufbau der schnell wachsenden Pfarrei. Dabei hatte er wohl auch ein recht vertrauensvolles Verhältnis zum Stadtplaner und vielleicht ergab sich daraus – in Zusammenarbeit mit der Diözese – dann auch wie ein Geschenk an uns Spätgeborene die Böhm-Kirche in der Sandheide (Grundsteinlegung 1969, Einweihung 1972).
Für den inneren Aufbau der Gemeinde war es natürlich entscheidend, wie sich die Zuziehenden in der neuen Umgebung einlebten. Die Bedingungen waren günstig. Denn eine der stärksten Strebungen der Ankommenden war das Bedürfnis nach Kontakten. Vor allem die zahlreichen jungen Familien mit ihren Kindern brauchten Beziehungen zu anderen Familien. Das wurde natürlich an vielen Stellen in der neuen Stadt möglich. Mütter mit kleinen Kindern kommen ins Gespräch, wenn sie sich auf dem Spielplatz treffen. Beratung, Anmeldung und Elternarbeit im Kindergarten und in der Schule schaffen Gemeinschaft. Und wir waren der Meinung, dass auch die christliche Gemeinde dabei eine besondere Aufgabe und Möglichkeit hat, denn „Gemeinde ist Gemeinschaft“. Eine der ersten Aktionen in dieser Richtung war Ende 1968 die Gründung der Ehekreise. Pfarrer Meixner war dabei die treibende Kraft, kongenial begleitet von seinem neuen Kaplan Gerd Verhoeven, der seit September 1968 in Hochdahl war. Innerhalb kürzester Zeit entstanden neun Ehekreise. Etwa 10 Paare fanden sich zu einem Kreis zusammen, trafen sich bei einer der Familien, diskutierten über Gott und die Welt, machten mit Kind und Kegel Ausflüge in den Hildener Stadtwald, oft im Anschluss an eine Kindermesse oder eine gemeinsame Veranstaltung in der Kirchengemeinde. Und mit vielen jungen Familien unterwegs zu sein (im zweifachen Sinne), war einfach schön.
Die Ehekreise waren von vorne herein als Gesprächskreise konzipiert. Bei den monatlichen Zusammenkünften gab es immer ein Thema. Wichtig waren zu dieser Zeit Fragen, wie man „heutzutage“ Kinder richtig erzieht, wobei zum Beispiel Bücher von Otto Betz beliebte Hilfen waren. Es ging auch darum, wie man in der veränderten Zeit gut und als Christ leben sollte. Wir hatten ja nach dem Konzil intensiv und erfolgreich für die Mündigkeit der Laien plädiert. Da war es dann aber wichtig, den Weg zu finden zwischen den alten Sündenkatalogen und der geforderten und gewünschten Selbstverantwortung. Und so versuchten diese Gruppen, im Gespräch und Erfahrungsaustausch Orientierung und Klärung zu finden. Im Januar 1971 begann in Würzburg die Synode der Bistümer Deutschlands. Sie hatte die Aufgabe, die Weisungen des Konzils auf die Situation der deutschen Bistümer hin zu übersetzen. In der Vorbereitungsphase gab es für Gesprächsgruppen in den Gemeinden ausführliches Arbeitsmaterial. Wir haben dieses Material vor allem in den Ehekreisen ausgiebig genutzt. Das Thema der Gespräche war – entsprechend dem Anlass – „Kirche, Gemeinde, Glaube, christliches Leben“. Die Gespräche waren intensiv und die Diskussionen oft hitzig. Das war natürlich in den verschiedenen Gruppen unterschiedlich je nach Eigenart und Zusammensetzung des Kreises. Normalerweise war einer der Geistlichen an den Abenden dabei – mit seinem theologischen Wissen, aber vielleicht mehr noch mit seiner persönlichen Einstellung und Glaubenserfahrung. Hier konnte man bei einer Reihe von Teilnehmern die hohe Kompetenz und Identifikation mit Kirche und Glaube erleben, von denen schon die Rede war. Und das Ergebnis war oft ein schönes Erlebnis von Gemeinschaft und eine Stärkung des Bewusstseins „wir sind Gemeinde in der neuen Stadt Hochdahl“.
Diese Kreise junger Familien entwickelten großen Elan. Sie setzten sich intensiv ein, wenn es in der Gesamtgemeinde etwas zu tun gab. Ob es die Arbeit in der Bücherei, die Vorbereitung
von Gottesdiensten oder Festen oder der Besuch nachkommender Neubürger war – anscheinend haben diese ersten neuen Gemeindemitglieder keine Arbeit gescheut. Diese Atmosphäre von Bereitschaft und Mittun war wohl eine typische Erscheinung für die frühe Zeit und war durchaus nicht auf die Ehekreise beschränkt. So entstand bald ein Besuchsdienst für Neuzugezogene, Gruppen für die Vorbereitung von Kinder- und Familiengottesdiensten, Chor und Band für Jugendgottesdienste – zusätzlich zu den normalen Gremien Kirchenvorstand und Pfarrausschuss, die sich um die Gesamtlinie des Aufbaus kümmerten.
An den Ehekreisen lässt sich verdeutlichen, was in den folgenden Jahren Linie des Lebens in der Hochdahler Gemeinde werden sollte.
* Die Gläubigen versammeln sich, sie werden nicht versammelt. Sie suchen miteinander Antwort auf die Fragen ihres Lebens und zwar eine Antwort aus dem Glauben. Sie diskutieren und sprechen über ihren Glauben, über die Erziehung der Kinder, über den Weg der Kirche und der Gemeinde in die Zukunft (ausdrücklich im Zusammenhang mit der Synode der Bistümer Deutschlands Anfang der 70-er Jahre).
* Die Geistlichen beteiligen sich mit ihrer Erfahrung, ihrem theologischen Wissen, ihrer eigenen Glaubensüberzeugung an dem Gespräch. Sie wirken in dem Maß, wie ihr Wort überzeugt. Sie sind nicht Sprachrohr der offiziellen kirchlichen Meinung.
* Die fragende und suchende Gruppe ist klein (nicht über 20 Personen). Kein Einzelner soll den „Meinungsführer“ abgeben. Die Vielfalt der Vorstellungen soll zu Wort kommen, damit durch die verschiedenen Perspektiven alle der Wahrheit näher kommen.
* Der Glaubenssinn der Gemeinde wächst vor allem durch die klärende Arbeit in den Gruppen. Natürlich kommen dazu andere Wege wie Predigt, Vortrag, Versammlung, Gottesdienst, Fest und Feier, Besuch und Einzelgespräch. (Das bedeutet, dass die Seelsorge ihren Schwerpunkt in der Gruppe hat).
6. Team
Wenn alte Leute früher erzählten, wie das Leben in einer Pfarrei vor dem 2.Weltkrieg aussah, dann konnte man vor allem über die Zahl der dort tätigen Priester staunen. Je nach Größe der Pfarrei waren drei oder gar vier Kapläne an der Tagesordnung. Und die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten waren klar verteilt. Wenn es Fragen oder Schwierigkeiten gab, stand der Pfarrer seinen Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite. Andererseits war er aber auch
derjenige, der klar die Richtung vorgab. Was dabei mehr Bedeutung hatte, war vermutlich von Eigenart und Temperament des Herrn Pfarrers abhängig. Jedenfalls bildete sich die für die Kirche vorausgesetzte hierarchische Ordnung (in der es vom Papst abwärts geht bis zum letzten Gläubigen) auch im Bild der Seelsorger vor Ort ab. In ländlichen Gemeinden war die Situation normalerweise anders. Dort gab es für die geringe Zahl der Gläubigen nur einen Seelsorger, der – in noch älteren Zeiten – zusammen mit dem Lehrer und Apotheker die Schicht der Honoratioren repräsentierte. Nach dem Krieg wurde das bald anders. Nicht nur die Zahl der Priester nahm schnell ab, auch die Vorstellungen von Pfarrei und Seelsorge veränderten sich.
Wer daher zwischen 1950 und 1960 mit dem Theologiestudium begann, um Priester zu werden, musste sich viele Gedanken machen, wie er sich seine spätere berufliche Tätigkeit vorstellte.
Wie intensiv dieser Klärungsprozess war, hing sicher von der persönlichen Eigenart und auch von der jeweiligen studentischen Gemeinschaft ab. In der Theologengemeinschaft des Bundes Neudeutschland wurde das Thema heftig und ausdauernd diskutiert. Dem langjährigen geistlichen Leiter der Theologengemeinschaft, dem Kirchenhistoriker Professor Erwin Iserloh, war dieses Gespräch ein Herzensanliegen. Wie kann man Lebensformen finden, die der Gefahr der Vereinsamung und der Mentalität des „Einzelkämpfers“ wehren? Kann es eine attraktive Form von „Priestergemeinschaft“ geben?
Dabei genügt es natürlich nicht zu klären, wie Priester miteinander leben können. Es geht auch darum, ob sich für die Seelsorge und die Gemeinde etwas verändert. Ist es von Vorteil, wenn in einer Pfarrei eine Gruppe die Arbeit aufnimmt, die schon in der Vergangenheit gewisse Formen gemeinschaftlichen Lebens ausprobiert und praktiziert hat und die dann auch für längere Zeit gemeinsam an Ort und Stelle bleibt? Wird durch Teamarbeit vielleicht eine größere Kontinuität möglich oder besteht eher die Gefahr, dass nach kurzer Zeit Routine und Gewohnheit jeden Aufbruch blockieren? Beides dürfte möglich sein und deshalb sollte irgendwann eine regelrechte Erfolgskontrolle stattfinden. Diese Aufgabe hätten sowohl die Teammitglieder als auch die Personalabteilung der Diözese. Die Idee mit der Teamarbeit war übrigens gar nicht so neu, denn manche Orden haben schon früher einzelne Pfarreien übernommen und dann haben mehrere Ordensmitglieder die Arbeit gemeinsam getan.
Die Frage nach dem Einsatz eines Teams für die Seelsorge stellte sich für die Hochdahler Gemeinde im Jahre 1969. Das Kölner Generalvikariat – damals wohl mehr als heute mit dem Finger am Puls der Zeit – trat mit der Frage an Hans Meixner heran, ob er sich eine Leitung der Hochdahler Gemeinde durch ein Team von Priestern vorstellen könne. Eine Gruppe aus Wuppertal hatte ihr Interesse an einer solchen Tätigkeit in Hochdahl geäußert. Nun war auch Gerd Verhoeven seit dem Studium in Bonn und den Gesprächen um die „Priestergemeinschaft“ mit einigen anderen jungen Kaplänen in Kontakt. Die Gruppe traf sich regelmäßig und hatte sich eine Arbeit als Team in der Seelsorge schon immer gewünscht. Pfarrer Hans Meixner war bereit, mit dieser Gruppe zusammen die Seelsorge in Hochdahl weiterzuführen. Diese Lösung wurde dem Angebot der Wuppertaler Priester vorgezogen, da so die beiden Seelsorger, die schon in Hochdahl waren, bleiben konnten. Den Ausschlag gab wohl die Bereitschaft von Hans Meixner, bei dem geplanten Team mitzumachen. Im April 1970 kam Bernd Staßen dann als zweiter Kaplan nach Hochdahl. Der dritte aus dieser Gruppe junger Kapläne sollte später folgen, doch dazu kam es dann nicht mehr.
Wie sollte diese Teamarbeit konkret aussehen? Dass Arbeitsaufteilung und entsprechende Zuständigkeiten geklärt werden mussten, lag auf der Hand. Aber sollte die Gruppe auch irgendeine Form gemeinschaftlichen Lebens praktizieren, vielleicht sogar mit gemeinsamen Gebetszeiten und einem abgestimmten Tagesablauf? Sollte sie gemeinsam in einem Haus wohnen? Sollte also Teamarbeit auch eine Form von „Vita communis“ einschließen – eine Form gemeinsamen Lebens? Diese Fragen wurden schon 1969 entschieden. Ob dabei das Bedürfnis nach Unabhängigkeit des Einzelnen wichtig wurde oder der Blick auf das Leben der Gemeinde die Entscheidung bestimmte, ist heute nicht mehr festzustellen. Aber die Lösung lautete: dezentral wohnen, mitten unter den Menschen. Hans Meixner blieb im Pfarrhaus in Trills, Gerd Verhoeven sollte nach Sandheide ziehen, wo seit Ende 1969 das neue Gemeindezentrum gebaut wurde. Und Bernd Staßen ging nach Willbeck, wo die Kirchengemeinde eine Eigentumswohnung gekauft hatte.
Zu diesem Zeitpunkt blieb die Frage offen, ob dieses Team auch gemeinsam für die Leitung der Gemeinde zuständig sein sollte – mit gleichem Recht und gemeinsamer Verantwortung. Wahrscheinlich wurde diese Möglichkeit gar nicht diskutiert, da Hans Meixner selbstverständlich Pfarrer der Gemeinde blieb. Erst im September 1972 wurde eine solche Regelung mit Generalvikar Nettekoven besprochen und entschieden. (siehe: Team 2)
7. Ökumene
Was könnte heutzutage eine evangelische und eine katholische Gemeinde in einem Vorort von Düsseldorf dazu bewegen, ihren Glauben gemeinsam zu leben? Alle religiösen Funktionen sind hier und da vorhanden und stabilisiert. Wenn es um die gegenseitige Teilnahme am Abendmahl geht, wissen sofort alle, dass dazu die Unterschiede noch viel zu groß sind und dass man der Wiedervereinigung nicht vorgreifen darf. Und von außen gibt es keinen Druck, etwas für den gemeinsamen Weg zu tun. Alles Ökumenische bewegt sich deshalb in Randbereichen und in Aktionen, die nur von der heilsamen inneren Unruhe einiger Christen hier oder da geprägt sind. Ökumenische Gottesdienste – die muss man ja wohl machen, aber bitte nicht zur Zeit des Sonntagsgottesdienstes. Gemeinsame soziale Aktivitäten – die können ja nicht schaden, obwohl man sie auch allein schaffen würde. Gemeinsame Kindergartenfeste kann man ja feiern – mal auf dem Grundstück der einen, mal der andern Einrichtung. Als Zeichen des guten Willens sind sicher auch solche Bemühungen nicht wertlos. Und die katholische Kirche hierzulande dürfte im Zeichen von Priestermangel und Fusionsrausch im Augenblick auch nicht die Kraft haben, nach dem großen Ziel wirklicher ökumenischer Gemeinschaft zu suchen und sich dafür einzusetzen.
Es war ein begrenztes Ziel, das wir in Hochdahl seit 1968 in ökumenischer Zusammenarbeit erreichen mussten. Wir brauchten nicht die Wiedervereinigung herbeizuführen. Wir mussten nur dafür sorgen, dass im Endausbau der neuen Stadt auch die kirchlichen Strukturen und Einrichtungen vorhanden sein würden, die die beiden Gemeinden brauchten. Der Weg dahin war nicht von vorneherein klar. Wir haben unzählige Male zusammengesessen, haben überlegt, diskutiert, geplant und wieder verworfen. Und damit waren wir jahrelang beschäftigt. Dass wir uns dabei kennen und schätzen gelernt haben, das hat die Mühe mehr als aufgewogen. Ein kleines Erlebnis aus späterer Zeit habe ich oft zitiert, um die gute Atmosphäre zu verdeutlichen, die allmählich zwischen den Seelsorgern der beiden Gemeinden entstand. Wir saßen zusammen, um eine ökumenische Bibelwoche vorzubereiten. Die Gespräche waren intensiv und persönlich. Plötzlich fiel uns auf, dass wir offensichtlich die Seiten vertauscht hatten: die Katholischen vertraten die evangelische Position und die Evangelischen die katholische – und das nicht als Spiel oder Experiment, sondern weil uns die Sache der Anderen inzwischen so wichtig geworden war. Die eigene Lehre fanatisch zu verteidigen, hatten wir nicht nötig! Auch zwischen vielen Mitgliedern der beiden Gemeinden entstand im Laufe der Zeit eine ähnliche Vertrautheit.
Verantwortlich für die Planungen und die Zusammenarbeit waren zunächst Reinhard Berchem, Pfarrer der evangelischen Gemeinde, und Hans Meixner, Pfarrer der katholischen Gemeinde, dazu natürlich das Presbyterium, der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat.
Schon ganz zu Anfang scheint entschieden worden zu sein, sich mit den kirchlichen Planungen eng an die Vorgaben der Stadtplanung anzulehnen. Die Gliederung der neuen Stadt in einzelne Stadtviertel, die sich um das Stadtzentrum herumgruppierten, sollte auch für die Seelsorge übernommen werden. Dementsprechend sollte die Kirche auch in den Stadtvierteln präsent sein. Da das Sandheider Subzentrum sehr früh geplant und gebaut wurde, entstand dort für jede der beiden Gemeinden ein kirchliches Zentrum. Für die anderen Stadtviertel war dann aber eine schachbrettartige Verteilung vorgesehen. Jede Gemeinde sollte nur in jedem zweiten Viertel bauen und ihre Räume dann der anderen Gemeinde zur Mitbenutzung überlassen. So war später die evangelische Gemeinde vertreten in Sandheide, im alten Hochahl, in Millrath und in Willbeck (das Gebäude wurde später wieder verkauft) – und die katholische Gemeinde in Sandheide, in Trills und in Millrath-Ost. Die Nutzung durch die jeweils andere Gemeinde war später nicht so intensiv, wie man sich das am Anfang vorgestellt hatte, obwohl die Bereitschaft zum Überlassen von Räumen immer groß war. Aber in der praktischen Arbeit entwickelten die eigenen Räume doch offensichtlich eine stärkere Anziehung.
Der Reformationstag 1969 war für die Ökumene und auch für die Zukunft der katholischen Gemeinde ein wichtiges Datum. Man hatte ihn gemeinsam begangen und im Gespräch hinterher beschloss man die Einrichtung des Ökumenischen Bildungswerks. Hans Meixner hatte schon vorher mit einem Bildungswerk begonnen, aber nur im Rahmen der katholischen Gemeinde. Für die Zukunft wurde das Ökumenische Bildungswerk zu einem wichtigen Instrument für den Lernprozess der beiden Gemeinden. Bis heute gibt es jedes Jahr ein Programm mit kirchlichen und gesellschaftlichen Themen, vorbereitet und organisiert von einer Gruppe von vier oder fünf Leuten aus beiden Gemeinden, die natürlich im Laufe der Jahrzehnte gewechselt haben. Vielleicht noch wichtiger war an diesem Reformationstag, dass die evangelische Gemeinde sich bereit erklärte, das Paul-Schneider-Haus in Millrath für einen katholischen Gottesdienst am Sonntagmorgen zur Verfügung zu stellen. Im Westen der neuen Stadt hatte die katholische Gemeinde die alte Kirche in Trills für ihre Gottesdienste. Und im Süden, in Sandheide, stand der Baubeginn unmittelbar bevor, aber der ganze Osten war zu der Zeit noch ohne ein kirchliches Gebäude für die katholischen Gläubigen. Es gab lediglich in Millrath eine Möglichkeit für einen Gottesdienst werktags in einem Raum der Familie Weber an der Bergstraße. Und die Messe sonntags um 11,15 Uhr im Paul-Schneider-Haus war von Anfang an und bis zum Jahr 2010 sehr gut besucht.
In Millrath-Ost wollte die katholische Gemeinde ein Pfarrzentrum mit Kirche, Versammlungsräumen und einem Kindergarten bauen. 1971 oder 1972 begann die unmittelbare Bauplanung. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an ein erstes Gespräch mit dem Architekten, bei dem er unsere Vorstellungen zu ergründen und erste Vorschläge für eine räumliche Gliederung zu entwickeln versuchte. Um die Möglichkeiten sichtbar zu machen, nahm er Legosteine zu Hilfe. Das hat mich denn doch fasziniert und überrascht. Und das prägte sich ein! In dieser Phase tauchte dann das Paul-Schneider-Haus in unseren Überlegungen wieder auf. Wenn wir den Gottesdienst dort auf Dauer beibehalten könnten, brauchten wir in Millrath-Ost überhaupt keine Kirche zu bauen, weil das Paul-Schneider-Haus fußläufig in wenigen Minuten erreichbar war; man brauchte nur ein kleines Bachtal zu überqueren. Und die Idee setzte sich durch! Wir trafen die Entscheidung: wir verzichten in Millrath-Ost auf den Bau einer Kirche und bleiben auf Dauer mit unserem Sonntagsgottesdienst im Paul-Schneider-Haus. Natürlich war das kein einsamer Beschluss einiger kleiner Seelsorger vor Ort. Was in Hochdahl gebaut werden sollte, wurde selbstverständlich dauernd mit der Bauabteilung im Generalvikariat in Köln überlegt und abgestimmt. Und bekanntlich sind Beschlüsse eines Kirchenvorstands ohne die Genehmigung von Köln überhaupt nicht rechtskräftig. Soweit ich mich erinnere, stieß diese Veränderung der Baupläne für Millrath-Ost im Generalvikariat auf eindeutige Zustimmung. Vielleicht war allen Beteiligten klar, wie sinnvoll diese Lösung war. Nicht das schlechteste Argument war, dass man dadurch eine Menge Geld sparte. Wie wir erwartet hatten, brachten die Verhandlungen mit der evangelischen Gemeinde keine Probleme. Beide Gemeinden banden sich auf Dauer an diese Lösung. Die Einzelheiten wurden in einem Mietvertrag geregelt.
Im Jahre 2010 glaubte Kardinal Meisner, an diese Entscheidung der Vergangenheit nicht mehr gebunden zu sein. Er erließ das Verbot, weiterhin im Paul-Schneider-Haus die Messe zu feiern. Als Begründung führte er an, das Paul-Schneider-Haus sei kein geweihter Raum und unsere Praxis sei das Ergebnis einer Ausnahmegenehmigung gewesen, da das kirchliche Recht die regelmäßige Feier der Messe in einem profanen Raum nicht gestatte. Sicher haben wir damals keine Ausnahmegenehmigung erbeten und auch nicht erhalten. Was wir da am Anfang überlegt, entschieden und vereinbart haben, vollzog sich eindeutig in klarem Einvernehmen mit den zuständigen Abteilungen im Generalvikariat. Es wäre doch im Jahr 2010 ein Leichtes gewesen, das durch einen Blick in die alten Akten (im Generalvikariat oder im Pfarrbüro) zweifelsfrei zu klären. Natürlich war das Paul-Schneider-Haus nicht mit katholischer Weihe versehen. Aber in den vielen Jahren, in denen ich dort zelebriert habe, hatte ich nie den Eindruck, dass dieser Raum als bloß „profan“ zu qualifizieren sei. Und die Atmosphäre beim Gottesdienst stimmte fast immer. – In der Planung für die notwendigen Räume in der neuen Stadt spielte das Paul-Schneider-Haus eine wichtige Rolle. Das wird dem aufmerksamen Leser sicher nicht entgangen sein. Und die Nutzung des Paul-Schneider-Hauses war eine gute und damals befreiende Lösung, damit auch im Osten des Neubaugebietes den Menschen ein regelmäßiger Sonntagsgottesdienst angeboten werden konnte. – Viele Menschen sind durch das Verbot schwer verletzt worden. „Man hat uns die Heimat genommen“, sagte ein mir bekannter Mann, als er mir – noch ganz aufgelöst – eröffnete, er sei am Morgen beim Amtsgericht gewesen und aus der Kirche ausgetreten. - - -
Eine ähnliche Gastfreundschaft wie beim Paul-Schneider-Haus zeigte die evangelische Gemeinde auch bei der Neanderkirche in Alt-Hochdahl. „Da oben“ lebten viele ältere Leute. Die Katholiken mussten, wenn sie am Gottesdienst teilnehmen wollten, den Berg runtergehen zur Kirche in Trills. Der Hinweg war dabei weniger das Problem, aber zurück machte der „Trillser Berg“ doch einige Mühe. 1973 ermöglichte uns die evangelische Gemeinde, eine Vorabendmesse um 18 Uhr in der Neanderkirche zu halten. Das wurde zunächst für einige Zeit probeweise eingeführt. Und wie beim Paul-Schneider-Haus wurde diese Messe dann eine Einrichtung auf Dauer. Auch dieser Gottesdienst wurde schon vor dem Paul-Schneider-Haus vom damaligen Pfarrer abgeschafft. Die Begründung lautete, die Zahl der Gottesdienste müsse reduziert werden mit Rücksicht auf die Zahl der Priester; bis dahin gab es nämlich seit mehr als dreißig Jahren in Hochdahl sieben Gottesdienste am Wochenende. Ob unterschwellig auch andere Gründe bei dieser Entscheidung mitgespielt haben, ist natürlich nicht zu klären.
8. Gottesdienst
Viele junge Familien mit Kindern – es war klar, dass die Gemeinde regelmäßig „Kindermessen“ feiern musste. Und schon früh gab es einen Kreis zur Vorbereitung. – Häufig finden sich in einer solchen Vorbereitungsgruppe Menschen, die anscheinend von Natur aus in der Lage sind, die Botschaft des Evangeliums auf das Fassungsvermögen von Kindern zu übertragen. Und wenn dabei dann noch eine schöne Geschichte oder ein passendes Bild zur Verfügung steht, braucht man wegen der Katechese keine Sorge mehr zu haben. Es stießen aber auch Leute zu diesem Kreis, denen die „Übersetzung“ nicht so leicht fiel und die deshalb den Wunsch hatten, das Evangelium oder die Lesung zuerst einmal selbst zu verstehen. Eigentlich ist das ja die Voraussetzung für jede Form einer Vermittlung an andere, besonders an Kinder. In dem „Arbeitskreise Kindergottesdienst“ war es deshalb üblich, dass die Gruppe sich zweimal traf, das erste Mal für das eigene Verständnis des entsprechenden Textes und das zweite Mal für die Umsetzung in die Katechese. Bei dem ersten Treffen war immer der Geistliche dabei, und das war die Praxis von Anfang an. Die Umsetzung wurde dann manchmal von einer Gruppe von zwei oder drei Mitgliedern erarbeitet.
Als 1972 die Heilig-Geist-Kirche fertig war, hat sich dieser „Arbeitskreis Kindergottesdienst“ auch um die Krippe für Heilig-Geist gekümmert. Neue Kirche – neue Krippe! Nun hätte man ja nach Oberammergau fahren und eine schöne geschnitzte Krippe kaufen können. Das tat man aber nicht. Man fragte vielmehr: wie sieht Weihnachten heute in unserer Stadt aus? Es ging also um eine Deutung des Weihnachtsfestes für die Menschen, die 1972 in Hochdahl lebten. Da musste doch die neue Stadt vorkommen und die Neubürger mit ihren Schwierigkeiten und Hoffnungen und natürlich der Glaube, dass Gott Mensch wird. Das Thema lautete dann: Alle kommen zur Krippe. Das bedeutete also Hoffnung für alle in Hochdahl und darüber hinaus. Und die Form war auch anders als gewohnt. An der Rückwand der Kirche war ein großes Stück Rupfen (grobes Sackleinen) befestigt und auf dieser Fläche alle möglichen Figuren, die Bewohner Hochdahls darstellten. Und alle kamen zur Krippe. Im Laufe der Jahre hat es viele solche Versuche gegeben, das Weihnachtsereignis in der neuen Stadt Wirklichkeit werden zu lassen. Bei einer der Darstellungen fand die Geburt Christi in einer Bushaltestelle statt, mitten in Hochdahl. Diese Krippen haben nicht allen gefallen und zwischendurch wurde der Wunsch laut, doch wieder so eine schöne, alte Krippe zu haben. Aber ist es bei einer Krippe nicht so wie bei der Predigt? Da darf man ja auch nicht bloß das Evangelium mit eigenen Worten wiederholen, sondern muss deutlich machen, was die Botschaft für das eigene und für das gemeinsame Leben bedeutet. Nur dann kann das Wort Gottes Ermutigung und Hilfe für das Leben werden. Zugegeben, manchmal ist es recht fordernd, immer wieder neu aus den Verfestigungen der Vergangenheit aufzubrechen – erst recht, wenn sie einem so ans Herz gewachsen sind wie eine schöne Krippe.
Für die größeren Gemeindemitglieder – Jugendliche und auch Erwachsene – gab es schon sehr früh Gottesdienste mit rhythmischen Liedern. Diese Lieder waren neu und man nannte sie deshalb „Neues geistliches Lied“ oder mit einer Bezeichnung, die von Peter Janssens (siehe unten) stammte, „Sacro Pop“. Es ist erstaunlich, wie schnell diese neue Kirchenmusik entstanden ist. Kaum war das Konzil zu Ende, da gab es schon überzeugende Versuche mit neuen Texten und Kompositionen. Ich begegnete diesen neuen Liedern, als die sogenannten „Duisburger Messen“ auftauchten. In Duisburg wurden sie zum ersten Mal gesungen und bei Hoppe & Werry in Mülheim/Ruhr gedruckt. Ich war Kaplan in Waldbröl und bin sofort angesprungen. Die Melodien waren Spirituals und sie waren mit deutschen Texten unterlegt. Deswegen nannten wir sie auch „Jazz-Messen“. Es gab Lieder für den Advent, für die Fastenzeit, für Ostern und Pfingsten. Wir haben sie mit Begeisterung gesungen, vor allem weil der Swing-Rhythmus so schön in die Beine geht. Das war unsere Musik! So haben wir es damals empfunden. Die erste Jazzmesse in Waldbröl (1968) haben wir dann allerdings nicht in der Pfarrkirche gesungen, zur Sicherheit sind wir lieber in eine der Waldbröler Filialkirchen ausgewandert. Was genau die Ursache für diese Vorsicht war, kann ich nicht mehr sagen. Ob Dechant Emmerich Wolter, ein alter Pfadfinderkaplan, dazu geraten hatte oder ob wir Angst vor der eigenen Courage hatten, weiß ich nicht mehr. Denn die Sachen waren ja neu. Und die Lieder wurden nicht mit der Orgel begleitet, sondern mit Klavier, Schlagzeug und Gitarre. Und „das Schlagzeug in der Kirche“ war auch in der Folgezeit für manche ein Stein des Anstoßes. Der zweite Versuch fand dann allerdings schon in der Pfarrkirche statt und es dauerte nicht lange bis zu dem Gottesdienst, bei dem wir die Jazzmesse (in der Pfarrkirche!) mit voller Dixieland-Besetzung begleiteten.
Und dann trat Peter Janssens in unseren Gesichtskreis. Zum ersten Mal gesehen habe ich ihn in Altenberg bei einem Treffen der Dekanatsjugendseelsorger. Das muss 1968 oder 1969 gewesen sein. Und dann lernte ich im Anschluss an die Duisburger Messen seine ersten Lieder für den Gottesdienst kennen. Eins davon haben wir bis nach der Jahrtausendwende immer wieder im Firmgottesdienst gesungen: „Der Geist wird uns lehren“. Ich glaube, das ist eines seiner ganz frühen Lieder. „Vier swingende Weihnachtslieder“ gab es von ihm schon 1965, verlegt beim Verlag Schwann in Düsseldorf mit einer kleinen Schallplatte. Eines davon hat mich besonders ergriffen – mit einem wunderbaren Text von Christine Heuser: „Mit diesen Händen, Kind, die sonst das Steuer halten und Geld verdienen, kann ich dich nicht wiegen.“ Heftig zur Sache ging es dann, als er mit Texten von Alois Albrecht die „Traummesse“ geschrieben hat. Wir haben sie – in Hochdahl – etwa 1971 eingeübt und 1972 gesungen, begleitet von einigen Mitgliedern der „Survivers“, einer Band aus Hilden, die auch bei manchen Pfarrfesten und Karnevalsfeiern musikalisch für Stimmung gesorgt hat. „Traummesse“ hieß die Messe wegen des ersten Liedes: „Wir haben einen Traum“, und für manche war das zweite ein Ausdruck ihrer Hoffnung: „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“.
In Hochdahl gab es 1969 schon einen Jugendchor und eine Combo für die Jugendmessen. Und wie die Jungs an den Instrumenten spielten, das war sehr ursprünglich, sehr nahe am „normalen“ Leben. Und dadurch hat das Spielen viel Spaß gemacht. Das begann schon, wenn Hans Bones – junger Religionslehrer in Erkrath – heranrollte und der Hals des Kontrabasses aus dem Sonnendach seines Käfers herausragte. Und es tat der Qualität der Musik keinen Abbruch, wenn Jürgen Schallück, genannt „Schalla“, als Verstärker für seine Gitarre ein altes „Dampfradio“ benutzte. Es hat uns zwar geärgert, aber wir haben uns nicht allzu sehr darum gekümmert, dass um 1970 herum von der Diözese die Verfügung kam: Schlagzeug in der Kirche ist verboten. Sollten wir uns denn wieder mit den alten Kirchenliedern begnügen, die doch oft musikalisch wie textlich einfach schlecht waren bzw. sind? Und ist es denn wahr, dass Glaube sich nur lahm und getragen und emotionslos äußern darf? Wir liebten den Rhythmus, die „normalen“ Instrumente, das freudige oder begeisterte Singen. Und was haben wir nicht alles gesungen – außer den „Duisburger Messen“! Spirituals in ursprünglicher Form und Sprache, Lieder aus Musicals, „O happy Day“ und „Amen“! Und manchmal konnte man nach dem Gottesdienst auf den Gesichtern vieler Besucher Freude und Dankbarkeit erkennen. Warum haben so viele in der Kirche das Potential nicht erkannt, das in diesem Aufbruch vorhanden war? Andererseits: warum war er irgendwann zu Ende?
Bei vielen dieser Erinnerungen tauchen Bilder der Heilig-Geist-Kirche auf. Angefangen hat unsere musikalische Aktivität sicher in St.Franziskus. 1972 wurde Heilig-Geist fertig, und in diesem Raum konnte sich der Gottesdienst viel großzügiger und gemeinschaftsbezogener entfalten.
9. Mit offenen Armen.
Da in Hochdahl in den ersten Jahren so viele neue Bewohner zuzogen, war es nötig, den Prozess des Kennenlernens zu unterstützen. Deshalb bekamen alle einen Begrüßungsbrief. Das war zunächst eine Aufgabe, um die sich die Seelsorger kümmerten. Gerd Verhoeven ging jede Woche ins Einwohnermeldeamt, wo man ihn gerne darüber informierte, wer in der letzten Woche zugezogen war. Fräulein Weber, die zu der Zeit die Sekretariatsarbeiten (in ihrer Privatwohnung in der Bergstraße) machte, schrieb die Briefe, die an alle Familien gingen, in denen ein Mitglied katholisch war. Nun gab es 1968 noch keine brauchbaren Geräte zur Vervielfältigung. Man behalf sich mit Wachsmatrizen oder dem Umdruckverfahren. Aber einen damit gedruckten Brief konnte man den Neubürgern nicht zumuten. Also schrieb Fräulein Weber jeden Brief einzeln mit der Schreibmaschine, alle Seelsorger und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats unterschrieben und dann ging der Brief zur Post – und das konnten zeitweise schon an die 500 Briefe pro Monat sein. Eine Heidenarbeit, die aber mit dem Schwung des neuen Anfangs geleistet wurde. Durch den Begrüßungsbrief erhielten die Zuziehenden erste Informationen über Stadt und Pfarrei. Und wer den Wunsch hatte, von einem Gemeindemitglied oder einem Geistlichen besucht zu werden, konnte das mitteilen. Diese Mühe von Büro und Gemeindeleitung war sehr wichtig. Aber noch schöner war die Idee mit dem Besuchsdienst. In einer lebendigen Gemeinde kann eine Atmosphäre von Offenheit und Gastfreundschaft entstehen. Und dann nehmen die, die schon seit einiger Zeit da sind, die Anderen, die nachkommen, „mit offenen Armen“ auf. So ungefähr war die Vorstellung und es fanden sich einige Leute, die diesen Erstbesuchsdienst begannen. Der konnte nicht flächendeckend sein, weil es ja nur sinnvoll war, Leute zu besuchen, die gerade eingezogen waren. Es ging demnach schwerpunktmäßig um die Bereiche, wo die Bebauung gerade fertig wurde. Die Zuziehenden bekamen nach wie vor den Begrüßungsbrief. Gleichzeitig wurden Namen und Anschrift an die „Besucher“ weitergegeben, die dann einen persönlichen Besuch machten. Wie viele Gemeindemitglieder bei diesem Dienst mitgemacht haben, ist nicht mehr festzustellen. In der Erinnerung eines Beteiligten war es eine ganze Gruppe, die sich auch in unregelmäßigen Abständen zusammensetzte und ihre Erfahrungen austauschte. Es gab noch eine dritte Einrichtung, um die Neubürger zu empfangen, nämlich monatliche Treffen für Neuzugezogene. Da wurde viel erzählt. Die Neuen berichteten von ihrer Herkunft und den Erlebnissen in der neuen Umgebung, sie konnten Fragen stellen, die über die Erstinformationen hinausgingen. Die Alten – von denen immer auch mehrere bei den Treffen dabei waren – versuchten, ein Bild von der Gemeinde und dem Leben in Hochdahl zu vermitteln. Diese Kontakte waren oft der erste Schritt zu dauerhaften und tragfähigen Beziehungen. Die Treffen fanden bis in die 90-er Jahre statt. Sie waren über lange Zeit ein gemeinsames Angebot mit der evangelischen Gemeinde. Die zog sich allerdings zurück, als Ende der 80-er Jahre in großer Zahl die Schlesier nach Hochdahl kamen. Denn unter denen gab es fast keine evangelischen Christen.
10. Der Jugendausschuss.
Der neu gewählte Pfarrgemeinderat gründete einen Jugendausschuss (1970). Und in diesem Fall war das nicht der Ausweg aus der Hilflosigkeit, sondern ein Versuch, sich den vielfältigen Aufgaben in der neuen Stadt zu stellen. Nach den ersten Wellen des Zuzugs gab es schon eine größere Zahl von Jugendlichen in Hochdahl, aber fast keine Räume und kaum Gruppen, in denen sie sich treffen konnten. Viel geklagt wurde zu der Zeit darüber, dass es in der neuen Stadt praktisch keine Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die jungen Leute gab: kein Kino, keine passende Kneipe, kein anderer Treffpunkt. Lediglich „V2“ war vorhanden. Dieses Kürzel stand für „2.Versuch“. In einem ersten Versuch hatten einige Jugendliche sich in einem alten Haus eingerichtet und daraus einen kleinen Treffpunkt für Jugendliche gemacht – natürlich in absoluter Selbstverwaltung. Und als sie das Haus räumen mussten, entstand „V2“. Allerdings war im neuen Unterschlupf sowohl der Raum begrenzt, als auch die Gruppe der Jugendlichen, die sich dort trafen.
„Welche Möglichkeiten haben Jugendliche in Hochdahl?“, dieser Frage sollte sich der Jugendausschuss der Pfarrei stellen. Dabei kam es einmal zu einem witzigen Missverständnis, das aber erkennen lässt, wie die Lage damals war. Wir luden zu einer Versammlung ein – in der alten Baracke hinter der Trillser Kirche – und wir machten ordentlich Reklame für die Zusammenkunft. Wir wollten miteinander überlegen, was wir in Hochdahl für die Jugendlichen tun könnten. Der Titel der Veranstaltung lautete: „Jugendträume werden wahr!“ Und viele kamen. Im Gespräch fragten dann einige Anwesende penetrant nach Räumen für ihre Treffen. Das Problem der fehlenden Räume kannten wir zwar, aber warum das Thema in dieser Runde so wichtig wurde, haben wir erst hinterher gemerkt: bei der Herstellung der Plakate war uns bei den „Jugendträumen“ unbemerkt das „t“ abhanden gekommen. Pech! Passende Räume hatte zu der Zeit auch die Kirchengemeinde nicht zu bieten. Trotzdem entstanden aus diesem Gespräch einige Aktivitäten, die ein paar Leute für die nächste Zeit zusammenbrachten. Wir haben wirklich klein angefangen!
Die Aktivitäten des Jugendausschusses beschränkten sich nicht auf Reden über nicht vorhandene Räume. Nach einer Zeit der Vorbereitung entstanden auch ein paar Gruppen für jüngere Jugendliche. Zwei davon bekamen einen Raum in der Grundschule Willbeck. Also selbst das Raumproblem war nicht unlösbar. Vermutlich deshalb, weil die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe zwischen den verschiedenen Institutionen und Vereinen groß war. Auch in Trills scheint noch etwas an Aktivität möglich gewesen zu sein.
Schon 1969 war eine Verbindung von Hochdahl zur Jugendakademie Walberberg aufgenommen worden. Die Jugendakademie befand sich neben dem Kloster der Dominikaner in Walberberg zwischen Köln und Bonn. Dort gab es einige Patres, die in ihren Vorträgen und Gesprächen den Ton der Jugendlichen trafen und in der Lage waren, das Evangelium für die heutige Zeit fruchtbar zu machen. Das Gehörte wurde dann im kleinen Kreis bis tief in die Nacht hinein vertieft und weiter erschlossen. Die Fahrten nach Walberberg waren in Hochdahl beliebt. Auch die Mitglieder des Jugendausschusses nutzten das Angebot und begleiteten auch hin und wieder jüngere Jugendliche.
Viel Zeit und Phantasie hat der Jugendausschuss aufgewandt, um zur Klärung des Gemeindekonzepts für die zukünftige Pfarrei beizutragen. Diese Aufgabe reizte ihren jugendlichen Willen zum Aufbruch und entsprach gleichzeitig ihrem Verantwortungs-bewusstsein als Mitglieder der Gemeinde. Und was sie in der Gruppe besprochen und erarbeitet hatten, trugen sie dann mit Selbstbewusstsein und klaren Worten in den Pfarrgemeinderat. Das war möglich, weil einige Leute in beiden Gremien Mitglied waren.
Die Treffen des Jugendausschusses waren regelmäßig und häufig. Einer, der damals dabei war, meinte sogar, wir wären fast jede Woche zusammengekommen. Zudem waren einige gleichzeitig im Jugendchor, der auch jede Woche probte. Es war so etwas wie eine verschworene Gemeinschaft. Wir haben viel überlegt und diskutiert, aber wir haben auch viel Spaß gehabt und oft gefeiert. Das war für manche Nachbarn gar nicht so einfach: schon wieder diese Gruppe, die nie leise war! Natürlich bei dem Kaplan, von dem man doch eigentlich etwas anderes erwartet hätte! Und dessen Wohnung war auch noch in einem normalen Wohnblock – pro Eingang 12 Wohnungen. Anderen Nachbarn gefiel es, wenn Leben im Haus war. Und die trugen auch ihrerseits dazu bei – feucht, fröhlich, wenn sich eine Gelegenheit bot.
Als das Pfarrzentrum in Sandheide fertig wurde, entstand bald ein Offener Treff, von dem noch Jahre später viele Geschichten erzählt wurden. Organisiert wurde er vom Jugendausschuss und eingeladen waren alle Hochdahler Jugendlichen. Und es kamen Leute von sehr unterschiedlicher Eigenart. Nicht alle waren die Sanftmut in Person. Vor allem wenn der Alkohol nicht hinreichend unter Kontrolle war, konnte es vorkommen, dass ein Teilnehmer im Pfarrsaal die Tür zur Küche eintrat. Ob er die Reparatur hinterher bezahlt hat, weiß ich nicht. Einige weibliche Mitglieder des Jugendausschusses hatten einen klaren Blick dafür, wenn einer der Herren wieder kurz vor der Randale stand. Durch eine Aufforderung zum Tanz gelang es meist, die brisante Situation zu entschärfen. Als jemand allerdings den Feuerlöscher als Spielzeug benutzen wollte, war das nicht zu verhindern; ich hoffe, man hat ihn wenigstens zum Säubern des Flurs veranlassen können.
Der offene Treff in Sandheide ist noch mehrere Jahre weitergeführt worden, auch nach den Zeiten des Jugendausschusses. Andere Gemeindemitglieder haben die Organisation und Begleitung dann übernommen. Das waren dann zum großen Teil Erwachsene, sodass wieder ausgiebig über das alte Thema der Erwachsenen in der Jugendarbeit diskutiert werden konnte.
11. „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“
Dieses Motto haben wir von der Franziskus-Gemeinde in Dortmund-Scharnhorst geklaut. Anfang der 70-er Jahre hatten wir einen lockeren Kontakt dorthin. Die Situation in Scharnhorst war mit der unseren vergleichbar, auch dort entstand ein Neubaugebiet und eine neue Gemeinde musste aufgebaut werden. Zwei Franziskanerpatres, Werenfried Wessel und Reinhard Kellerhoff, hatten die Leitung der Gemeinde für diese Aufbauphase übernommen. Eine 1972 veröffentlichte Zwischenbilanz trug den Titel: Wer mitmacht, erlebt Gemeinde –Modell Dortmund-Scharnhorst. Wenn man dem Eindruck trauen darf, den einige Hochdahler in jüngster Vergangenheit gewonnen haben, dann hat diese Gemeinde es bis auf den heutigen Tag geschafft, ihre Ursprungsprägung zu bewahren und ein Leben im Geiste des Konzils zu führen. Man hörte allerdings auch, dass das nicht ohne immer neue Verdächtigungen und Schwierigkeiten von seiten der Diözesanleitung in Paderborn möglich ist.
Den Titel haben wir also damals als Motto für unsere Pfarrei übernommen. In der Praxis sah das so aus: hatte jemand eine Idee, was man in Hochdahl noch machen könnte und solche Ideen gab es viele, dann bekam er die Antwort: „Dann machen Sie es doch!“ Das hieß nicht, dass er mit seiner Idee und ihrer Verwirklichung allein gelassen worden wäre, sondern wir trauten ihm zu, dass er auch die Verantwortung für die Realisierung seiner Idee übernehmen könnte. Wenn Heiner Schuster also gerne im neuen Bürgerhaus ein großes Fest mit dem Titel „Tanz auf der Tenne“ machen wollte, dann hat ihm das niemand erlaubt oder verboten. Bei vielen in der Gemeinde fand seine Idee Anklang und der Spaß an der Sache griff um sich. – Und als die Stadt Erkrath Ende der 70-er Jahre eine Partnerschaft mit Cergy-Pontoise in der Nähe von Paris begann, war es ein Kreis von Frankreich-Begeisterten, der diese Idee auch für den Kontakt der Kirchengemeinden realisieren wollte. Die Geistlichen waren zwar beteiligt, aber die Treffen gingen auch selbstverständlich weiter, als sie nur noch sporadisch mitmachten. – Und als Brigitte Wolfers einen Gesprächskreis über die Erfahrungen und mögliche Verbesserungen in der Feier der Messe zusammenholen wollte, hat ihr niemand das Recht abgesprochen, so etwas zu tun. Sowohl der Gedankenaustausch als auch das mögliche Ergebnis galten als legitimer Vollzug des Lebens der Gemeinde.
„Wer mitmacht“, das sind also zunächst Leute, denen im Blick auf die Realität der Gemeinde eine Idee kommt. Die Idee muss sichtbar und hörbar werden und dafür gibt es viele Wege. Einige von denen, die von der Idee hören oder die angesprochen werden, fangen Feuer. Und auch die machen dann mit. Und sie werden miteinander überlegen und planen und die Idee der Realisierung zuführen. Und dabei erleben sie „Gemeinde“ – im Gespräch, im Zuhören und Argumentieren, im Planen und Organisieren. Sie erfahren Freude und Dankbarkeit, wenn Vertrauen und Übereinstimmung möglich werden und sie halten miteinander den Schwierigkeiten und dem Versagen stand. Und es wird auch Ideen geben, bei den am Schluss nicht die Verwirklichung steht, sondern die Einsicht: die Idee war ja schön, aber sie ist nicht realisierbar. – Bei diesem Bild von Handeln in der Gemeinde bestimmt die Realität den Anfang und den Weg des Prozesses. Beim Blick auf das Leben der Gemeinde erkennt man Möglichkeiten und Defizite und es entsteht das Bedürfnis, etwas zu tun. Dabei sind irgendwelche „Zuständigkeiten“ überflüssig. Oder: zuständig ist jeder, der die Augen aufmacht und erkennt, was zu tun ist.
Bei einer solch offenen Gemeinde muss man damit rechnen, dass Leute auftreten, die nur die eigenen Ideen realisieren wollen. Das können dann auch Ideen sein, die gegen den Geist einer derartigen Gemeinde gerichtet sind, die hemmen oder zerstören. Dann muss jemand korrigierend eingreifen. Oder die Gemeinde korrigiert ihn, entweder im Gespräch oder dadurch, dass er niemand findet, der mitmacht.
Wer jetzt meint, hier ginge es um „mehr Demokratie in der Kirche“, der hat die Überlegungen missverstanden. Denn „mehr Demokratie“ ist ja der Wunsch nach einer Veränderung der Machtverteilung. Aber von Macht war die ganze Zeit nicht die Rede. Vielmehr war die Hoffnung formuliert, dass die Menschen einer Gemeinde die Realität oder die Wahrheit oder die Weisung Gottes in ihren Geist und ihr Herz hineinlassen. Jeremia hatte den Mut, so etwas für möglich zu halten, wenn Gott seinem Volk von neuem Heil schenkt. „Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht mehr zueinander sagen: Erkennt den Herrn!, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn.“ (Jer 31, 34)
Und der Leiter einer solchen Gemeinde wird nicht überflüssig. Er müsste derjenige sein, der auch viele Ideen hat, der vor allem offen ist für die Realität und dadurch – wie eine Formulierung für diesen Dienst lautet – seiner Gemeinde im Glauben vorangeht.
Wir haben das Motto „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“ damals wohl instinktiv als richtig erlebt und angewandt. Aber es hat ja einen tiefen theologischen Hintergrund. Und für diesen Hintergrund hatte die Theologie während und nach dem Konzil noch eine andere Formulierung. Da alle Getauften Kirche sind, ist die Gemeinde das Subjekt aller kirchlichen Lebensvollzüge und nicht das Objekt. Als wir vor ein paar Jahren mit Wolfgang Kraft, dem ehemaligen Spiritual der Theologiestudenten in Bonn, zusammen saßen und uns über Kirche und Gemeinde unterhielten, habe ich diese Formulierung so ausgesprochen. Er lachte kurz auf und wiederholte mit einem deutlich hörbaren Fragezeichen meine Aussage. Und noch heute meine ich in seinem Auflachen Trauer und Bitterkeit zu hören. – Ist denn diese theologische Wahrheit in der Realität der Kirche Illusion? Wie können wir die Zuversicht retten, mit der wir damals angefangen haben?
12. Suchen und fragen
Die neue Gruppe der Seminaristen, die im Sommer 1961 das Kölner Priesterseminar bezog, war klein. Es handelte sich um ein „Zwischensemester“ mit vorgesehenem Weihetermin im Sommer 1963. Es waren neun Theologiestudenten, die alle von der Bonner Universität kamen. Im Priesterseminar ging der Studienbetrieb normal weiter, wenn auch gegenüber der Universität reduziert. Daneben spielte die Vorbereitung auf den eigentlichen Dienst in der Gemeinde mit dem Einüben in Liturgie, Predigt und Sakramentenvollzug eine wichtige Rolle.
Unser Semester war klein und viele waren schon seit Jahren miteinander bekannt. Es stellte sich schnell ein gutes Vertrauensverhältnis ein. Das äußerte sich zum Beispiel darin, dass wir uns neben den offiziellen „Lehrveranstaltungen“ auch privat mit den Fragen nach unserer zukünftigen Tätigkeit beschäftigten. Ein Kreis fand sich zusammen, der in Theorie und Praxis zu lernen versuchte, wie das mit dem Predigen geht. Dabei waren mehrmalige Treffen mit der Journalistin Vilma Sturm, die damals in Köln lebte, sehr hilfreich. Ein anderer Kreis übte die Praxis des „geistlichen Gesprächs“ ein. Dieser Kreis traf sich – wie regelmäßig auch immer – sonntags nachmittags in einem Raum des Seminars und wurde für mein seelsorgliches Konzept prägend.
Bei einem der ersten Treffen suchten wir nach einem Motto für unsere gemeinsamen Bemühungen. Von Michael Marmann – der später zu Schönstatt gegangen ist – kam der Vorschlag: Wir sind das Geschlecht derer, die Gott suchen. Das ist wohl ein Bibelzitat, dessen Fundort ich aber bis heute nicht festgestellt habe. Aber das verhakte sich: Gott suchen! Wir sind also auch als Studierte und Geweihte nicht Leute, die „die Wahrheit in der Tasche haben“, sondern wir sind nach wie vor Suchende!
Bei einem Treffen dieser Gruppe war ich für die Vorbereitung zuständig und das Thema war: Die Mentalität des mitbrüderlichen Gesprächs. Die Überlegungen und Erkenntnisse zu diesem Thema haben meine Vorstellungen und die Praxis des Gesprächs für die nächsten 50 Jahre entscheidend bestimmt! Beim Versuch, diese Mentalität zu beschreiben, wird es nicht vermeidbar sein, dass sich die ursprünglichen Einsichten mit den Erfahrungen der langjährigen Praxis vermischen. Aber es geht ja auch nicht um historische Quellenforschung.
Gesprächsformen sind sehr zahlreich. Hier geht es nicht um Diskussionen, nicht um Versuche eine Lösung durchzusetzen, nicht um Manipulationsversuche, nicht um politische Auseinandersetzungen, nicht um Wettkämpfe, nicht um Ratespiele, nicht um Small-Talk oder Talk-Show. Es geht weder um eine Sitzung noch um ein Seminar.
„Gespräch“ ist ja nun zweifelsfrei eine Ableitung von „Sprechen“. Aber das Charakteristische dieser Mentalität ist nicht Sprechen, sondern Hören! Jeder Teilnehmer muss versuchen, dem jeweils Sprechenden zuzuhören. Und das nicht äußerlich, sondern mit dem Wunsch, den Andern zu verstehen. Wer etwas nicht wirklich versteht, darf und sollte nachfragen. Aber dieses Fragen darf nicht die Absicht haben, per Trick den Sprechenden auf eine andere Fährte zu bringen, sondern es muss wirklich der Wunsch nach Verstehen dahinter stehen. Der nächste Schritt ist, dass jeder versucht, bei den verschiedenen Meinungsäußerungen den Gang des Gesprächs zu erkennen. Das setzt natürlich voraus, dass eine Äußerung jeweils an die vorhergehende anknüpft und ein Roter Faden zu erkennen ist. Das bedeutet gleichzeitig, dass in dem Gespräch ein gedanklicher Fortschritt feststellbar ist. Wenn ich während der Entwicklung des Gesprächs auch auf mich selbst höre und meinen eigenen Gedanken erkenne, kann ich feststellen, an welcher Stelle er in den Ablauf passt und wann ich ihn beitragen sollte. Man sollte in einem solchen Ablauf nicht ängstlich darauf bedacht sein, „dass jeder auch zu Wort kommt“. Es kann nämlich durchaus sein, dass bei einem bestimmten Thema der eine mehr beizutragen hat als ein anderer. Und wenn die Atmosphäre stimmt und die nötige Gelassenheit herrscht, wird keiner das Gefühl haben zu kurz zu kommen. Der Maßstab ist der Fortschritt in der Erkenntnis. Die Wahrheit soll sich entfalten können. Und diejenigen, die wegen des Themas oder wegen augenblicklicher Erkenntnis am besten dazu führen können, sollen die Führung auch übernehmen. Während dieses Gesprächs wird es keine Leitung von außen geben. Die Leitung übernimmt – wechselnd – jeder, der etwas Weiterführendes zu sagen hat. (Eine äußere Leitung ist allerdings nötig für die Vorbereitung, für das Einhalten der Spielregeln – zum Beispiel, wenn einer anfängt zu diskutieren – und vielleicht hier und da für eine stützende Frage/Aussage zur Weiterführung.) Wenn ein solches Gespräch gelingt und wenn eine weiterführende Erkenntnis sich einstellt, dann kann es durchaus sein, dass sich ein Gefühl von Dankbarkeit und Freude einstellt. Ich erinnere mich, dass ich häufig – oft sogar im Schulunterricht – mit Überraschung und Freude ausgerufen habe: „Das habe ich so ja noch nie gesehen“. Eine neue Facette der Wahrheit – immer wieder neu – und „suchen und fragen“ wird nie langweilig! Und dann liegt auch der nächste Schritt nahe, in einem solchen gemeinsamen Erkenntnisprozess das Wirken des Gottesgeistes zu vermuten und anzuerkennen, denn er ist schließlich der Gemeinschaft der Glaubenden verheißen und geschenkt. Allerdings ist an dieser Stelle äußerste Vorsicht geboten, denn der Geist ist nie dingfest zu machen!
„Keiner kann die Wahrheit in der Tasche haben.“ Das ist schon rein erkenntnistheoretisch leicht aufzuzeigen. Die Wahrheit ist mir vorgegeben und immer größer als ich. Wenn man will, dann ist die Wahrheit letztlich ein Geheimnis. Ich werde zum Beispiel einen anderen Menschen nie ganz verstehen können. Und wer Gott ist und wie ich ihm dienen kann, ist mit noch größerer Sicherheit letztlich unbegreiflich. Ich kann natürlich eine gewisse Facette der Wahrheit erkennen, in einer bestimmten Situation ein Stück einer Eigenschaft eines Anderen begreifen, aber bei der nächsten Gelegenheit erlebe ich überrascht, dass er ganz anders ist als ich meinte. Meine Erkenntnis ist dem dauernden Wandel unterworfen. Ein beliebter Spruch im erwähnten Jugendausschuss war: „Was interessiert mich mein dummes Gerede von vorige Woche!“ Und das hieß nicht, dass ich nicht bereit und fähig war, zu meinem Wort zu stehen, sondern dass mein Gesprächspartner damit rechnen muss, dass sich Erkenntnis in einem dauernden Fortschritt befindet. – Und warum diskutieren Menschen so gerne miteinander und versuchen den anderen dauernd davon zu überzeugen, dass er sich irrt? Was dem Vorgang zugrunde liegt, ist doch die Tatsache, dass es nicht nur eine Facette der Wahrheit gibt, die für alle gleich ist. Es ist möglich, dass fünf Leute diskutieren und dass alle fünf recht haben, weil jeder einen Teil der Wahrheit sieht und im Gespräch vertritt. Sie sollten dann nur nicht die eigene Perspektive für die einzig mögliche halten, sondern versuchen, die verschiedenen Aspekte (!) zusammenzutragen.
Und wer eine solche Gemeinde leitet, muss auch hier, bei der Suche nach der Wahrheit, seiner Gemeinde im Glauben vorangehen (vgl.Nr.11). Er sollte besonders intensiv suchen und mehr Fragen haben als in der Gemeinde auftauchen. Wenn er davon ausgeht, er wüsste doch Bescheid, dann wird‘s gefährlich. Denn dafür kann weder eine gute theologische Ausbildung noch eine gereifte Lebenserfahrung garantieren. Man muss immer damit rechnen, dass die Erkenntnis eines Einzelnen sehr begrenzt ist. Und daran ändert sich auch durch die Weihe nichts. Denn sie eröffnet keinen neuen Erkenntnisweg, sodass man deshalb Zugang zu einer Erkenntnis hätte, die dem normalen Menschen verschlossen ist. – Das wäre so wie bei dem Witz mit dem Mitarbeiter von IBM, der einem Gast ein Telefon zeigt, bei dem man mit dem Himmel telefonieren kann. Auf den staunenden Einwurf des Gastes, das sei doch sicher sehr teuer, antwortet der Mann von IBM: „Überhaupt nicht! Hausanschluss!“ – Die Weihe ist eine Zusage Gottes und Jesu Christi, eine Verheißung. Man sollte sie vor jeder magischen Überhöhung bewahren! Umso wichtiger wäre es dann doch, eine Gesprächsform zu trainieren, in der man sich nicht selbst aufgibt, die Gesprächspartner nicht gering achtet und sich gemeinsam öffnet für die Wahrheit.
13. Die Gaben des Geistes
Ich weiß nicht mehr, wer diejenigen waren, die mir einen Zugang zum ersten Korintherbrief – und zwar zu den Kapiteln 12 bis 14 – erschlossen haben. Es muss schon während des Studiums gewesen sein. Und auch später habe ich mich immer wieder mit diesen Texten beschäftigt. Sie haben mich als Maßstab und faszinierendes Bild durch fast 50 Jahre Tätigkeit begleitet.
Paulus musste Stellung nehmen zu einem Konflikt, der in der Gemeinde von Korinth aufgebrochen war. Im Gottesdienst traten Leute auf, die „in Zungen redeten“. In der Apostelgeschichte wird an mehreren Stellen ebenfalls von solchen Erscheinungen gesprochen. Das waren ekstatische Formen des Gebetes, die aber für die übrigen Teilnehmer nicht verständlich waren. Die Einstellung der „Konfliktparteien“ kann man sich leicht vorstellen. Die Ekstatiker hielten sich wahrscheinlich für besonders fromm und gläubig, während die anderen sich gestört fühlten. Und man kann sich denken, dass diese gegensätzlichen Einstellungen auch lautstark geäußert wurden. – Es handelte sich also um ein Problem im Gottesdienst. Wir würden heute wahrscheinlich in einer solchen Situation zwei verschiedene Gottesdienste in getrennten Räumen oder zu unterschiedlichen Zeiten anbieten. Auf eine solche Idee ist Paulus gar nicht gekommen. Natürlich ist auch diese liturgische Frage interessant. Aber wichtiger war für mich immer das Bild von Gemeinde, dass Paulus im 12. Kapitel erläutert, um den Konflikt zu lösen.
Für Paulus gibt es nur eine Basis, auf der man sich über die Probleme unterhalten kann. Wenn jemand sagt: „Jesus sei verflucht“ – und das heißt heute doch wohl, dass Jesus ihn nicht interessiert – dann spricht er nicht im Heiligen Geist und dann ist er eben auch kein Gesprächspartner. Hier stehen alle nur gesellschaftlich begründeten Stellungnahmen und alle Beratungsfirmen auf dem Prüfstand! Die gemeinsame Basis ist das Bekenntnis (nämlich im Heiligen Geist): „Jesus ist der Herr!“. Ich glaube, dass man das Bild, das Paulus dann entwickelt, nur verstehen und vertreten kann, wenn man mit dem Geist Jesu rechnet und ihn ernst nimmt.
(1 Kor 12,3)
Und dann kommen die Sätze, die für mich der Schlüssel zum Verständnis von Gemeinde sind. In der Einheitsübersetzung lauten sie: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen.“ Was in der Gemeinde also an Gaben sichtbar wird, und er zählt in Vers 8 bis 10 einige auf, ist nicht menschliches Wollen und Konstruieren, sondern das Handeln des Geistes, des Herrn, Gottes. Natürlich müssen der Einzelne und die Gemeinde miteinander aufpassen, dass sie nicht auf den Versuch menschlicher Selbstdarstellung hereinfallen. Aber noch mehr müssen sie sich sorgen, damit sie nicht das Handeln Gottes im Leben der Gemeinde übersehen oder gar verachten. Und kein einziger hat das Recht, die Gaben des Geistes beiseite zu schieben. Die Gaben Gottes sind für jeden Menschen unverfügbar.
(1 Kor 12.4-6)
Eigentlich müsste diese Aussage doch selbstverständlich sein. Aber was geschieht, wenn diese Unverfügbarkeit in Konflikt gerät mit der Aufgabe des Bischofs, der seinen Dienst ebenfalls ausübt, weil „Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt“ hat, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer … (1 Kor 12,28). Beides geht vom Geist Gottes aus. Wie kann das gelebt werden?
In der Vorstellung des Paulus ist allem Anschein nach kein Mitglied der Gemeinde von dieser Zuteilung der Gaben ausgenommen. Denn so wird man ja wohl den Vers 11 verstehen dürfen: „Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will“.
(1 Kor 12,11)
Eine revolutionäre Veränderung gegenüber dem, was wir in der deutschen Kirche dauernd erleben! Und vielleicht eine Befreiung von dem Druck und der Überforderung, dem die nur noch wenigen Priester heute ausgeliefert sind. Es reicht ja schon, was die Fusionen an Durcheinander und an logistischen (!) Problemen den Priestern aufhalsen. Belastender ist aber die offensichtlich weithin akzeptierte Vorstellung, der Bischof oder der Priester sei der Einzige, über den das Heil zu den Menschen komme. Das kann kein Mensch leisten, daran muss ein Priester kaputt gehen. Wie befreiend müsste die Perspektive sein, dass Gott selbst alle Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung stellt, damit der Glaube wächst und die Gemeinde lebt. Dann besteht die spannende Aufgabe darin, dem Handeln Gottes auf die Spur zu kommen und den Bruder und die Schwester als Träger der Gaben zu erkennen. Jesus hat verkündet, das Reich Gottes sei nahe und er hat diese Nähe Gottes selbst tagtäglich aufgenommen und zu Wort kommen lassen. Und für uns wird die Nähe des Reiches Gottes erfahrbar, wenn wir die Gaben des Geistes in allen Mitgliedern der Gemeinde erkennen.
„Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.“ Die Gabe des Geistes ist ein Geschenk, in dem der Einzelne erleben kann, wie sehr die Liebe Gottes ihn annimmt und bejaht. Und diese Erfahrung kann immer wieder Angst und Selbstzweifel und persönliche Unsicherheit überwinden. Und man darf seiner Erwählung vertrauen und zu verstehen versuchen, welche Gabe und Fähigkeit einem gegeben ist. Und wenn jeder in der Gemeinde sich und seine Gabe in den Dienst der Anderen stellt, dann entsteht ein Kreislauf der Liebe, der erlöst und befreit und zu einem glücklichen Leben führt. Was Paulus hier beschreibt, ist ein Gegenbild zum Kampf aller gegen alle, der dann entsteht, wenn jeder nur sich selbst groß zu machen versucht. Offensichtlich lohnt es sich doch, was die Kirche Jesu Christi zu bieten hat!
(1 Kor 12, 7)
„Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.“ Offensichtlich ist die Taufe doch der eigentliche Vorgang, der die Existenz des Menschen grundlegend verändert. Woher wir auch kommen und wer wir auch sein mögen – Juden und Griechen, Sklaven und Freie – in der Taufe wurden wir alle durch den einen Geist in einen einzigen Leib, nämlich den Leib Christi, aufgenommen und mit dem einen Geist getränkt. Diese Aussagen dürfen wir nicht als abgehobene Theologie relativieren, sondern sie müssen uns zu einer großen Ehrfurcht und Hochachtung vor dem Handeln Gottes führen! Die Begegnung in der Gemeinde ist der Lebensvollzug Jesu Christi! Hier wird auch noch einmal deutlich, was Paulus am Anfang des Kapitels meinte: „Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet.“
(1 Kor 12, 12f)
Im Zusammenhang des Konflikts in Korinth ist Paulus wichtig, dass keiner „aussortiert“ wird.
„Der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern.“ Und die Vielzahl der Glieder und die Vielfalt der Gaben ist für das Leben der Gemeinde unverzichtbar. Trotzdem geschieht es oft, dass die vorhandenen Gaben nicht geweckt, gepflegt und zusammengetragen werden. Und das hat zwei fast gegensätzliche Gründe, die Paulus am Bild vom Leib verdeutlicht. Einmal besteht die Gefahr darin, dass Menschen sich nicht trauen, ihre Gaben ins Spiel zu bringen. Immer wieder taucht die Entschuldigung auf, man könne das doch nicht, irgendjemand anders (meist der Hauptamtliche) könne das doch viel besser. Damit ist man in Gefahr, sich aus der Lebensgemeinschaft (des Leibes Christi) zu verabschieden. Und Paulus sagt: „Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört er doch zum Leib.“ (Vers 15f). Die andere Gefahr ist, dass jemand sich für besser hält und meint, die andern mit ihren Gaben nicht zu brauchen. Und Paulus sagt, dass dürfe nicht sein. „Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht.“ (Vers 21). „So aber gibt es viele Glieder, und doch nur einen Leib.“ (Vers 20).
Dazu ein kleines Erlebnis aus der Kommunionvorbereitung in Hochdahl in späten Jahren. Für die Kinder gab es sonntags in ihrer Messe eine kleine Katechese zu einem Element im Vollzug des Gottesdienstes. Dafür war normalerweise eine Mutter zuständig. An einem Sonntag erzählte mir eine der Mütter, sie habe am Sonntag davor diese Aufgabe übernommen. Und sie hätte große Angst gehabt, weil sie sich das eigentlich nicht zugetraut habe. Dann habe sie es trotzdem gewagt. Und sie war ganz begeistert und froh: sie hatte es geschafft! – Sie hatte eine Gabe entdeckt, von der sie vorher nichts wusste!
(1 Kor 12, 14 – 21)
Wahrscheinlich haben wir in Hochdahl mit diesem Bild auch nicht genügend ernst gemacht. Aber etwas davon haben wir doch zu verwirklichen gesucht. Wir haben an die Menschen geglaubt. Und wir haben feststellen können, welche Fähigkeiten Gemeindemitglieder bei der Organisation der Erstkommunionvorbereitung, bei der Katechese, bei der Begleitung und Vorbereitung von Katecheten, bei der Predigt und bei der musikalischen Verkündigung der Botschaft usw. entwickelt haben. Und wir konnten die Hoffnung haben, dass eine Gemeinde auch dann nicht untergehen würde, wenn der Mangel an Menschen, die sich ganz in den Dienst der Gemeinde stellen, noch größer würde. Das setzt allerdings die Weckung und Pflege der Gaben des Geistes voraus und eine Menge Arbeit, damit eine Gemeinde einen Lernprozess durchmacht – im Laufe von vielen Jahren.
Paulus hatte es im Vergleich zu uns heute gut. Er musste zwar „Missstände bei der Feier des Herrenmahles“ abstellen und in dem vorliegenden Fall einen Konflikt in der Gemeinde analysieren und klären, aber er konnte davon ausgehen, dass in Korinth unter den Bekehrten „etwas los“ war. Ohne die Situation damals zu glorifizieren, darf man wohl annehmen, dass Hoffnungslosigkeit und Jammern in Korinth nicht die typische Mentalität war.
Wer wissen möchte, wie Paulus den Konflikt konkret gelöst hat, möge den Text bis zum Ende des 14. Kapitels lesen.
14. Personale Begegnung
Der 1.September 1971 – dieses Datum hat sich in der Erinnerung festgesetzt. An diesem Abend war nämlich eine Sitzung von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand in der alten Baracke hinter der Trillser Kirche. Und für dieses Treffen gab es ein Arbeitspapier, das den Titel hatte: Gedanken zur Entwicklung der katholischen Kirchengemeinde Hochdahl. Es ist wahrscheinlich entstanden aus der Arbeit des Pfarrgemeinderats in der ersten Jahreshälfte 1971. Man muss heute noch staunen über den Einsatz (und vielleicht sogar die Begeisterung) der Mitglieder. Bezeugt sind im März und April drei Sitzungen hintereinander (am 10.3., 24.3.und16.4.) und dann ein Wochenende am 12./13. Juni im „Haus der Begegnung“ in Horrem („ Theologisch-geistliche Wochenendtagung des Pfarrgemeinderates“). Einen großen Teil der Arbeit hat dabei Heinrich Smoch geleistet; er schrieb bei den Gesprächen mit und sorgte dafür, dass alle Beteiligten kurze Zeit später die Ergebnisse nachlesen konnten, sauber mit Schreibmaschine geschrieben, vielleicht unter Mithilfe von Fräulein Weber. Es gab bei dem Wochenende drei große Themen, die sich dann in den drei Abschnitten des Arbeitspapiers niedergeschlagen haben. Es ging auch bei diesen Bemühungen um die Zukunft der Hochdahler Gemeinde, aber die Überlegungen unterschieden sich deutlich von dem, was sonst normalerweise besprochen wurde. Es ging nicht um die räumliche Organisation der Gemeinde oder die Bauplanung, nicht um Teamarbeit oder Ökumene. Der Text versuchte vielmehr eine Vorstellung zu entwickeln, wie Menschen aus Entfremdung, Abhängigkeit und Anpassung herauswachsen und zu eigenverantwortlichen Menschen werden können. Und dabei sollte gleichzeitig die Antwort erkennbar werden, wie die Menschen einer Gemeinde in Vertrauen und Offenheit zueinander finden können.
Im ersten Abschnitt des Textes (Mensch – Gesellschaft – Kirche) geht es um die Lebensbedingungen des Menschen, wie sie sich damals darstellten. Die Wertungen sind zwar vorsichtig, weil die beschriebenen Erscheinungen sowohl als Chance als auch als Gefährdung interpretiert werden können. Insgesamt wird aber die Sorge deutlich, dass der moderne Mensch nicht mehr er selbst sein kann. Wenn er sich im Beruf unter Umständen bedingungslos dem dauernden Druck und der selbstverständlichen Über- und Unterordnung ausliefert, kann er sich verlieren, sodass er nur noch funktioniert. Oder wenn er nur noch dem folgt, was die Gesellschaft ihm vormacht und vorgibt, wird er fremdbestimmt. Damals wurde die Anpassung an die Gesellschaft vor allem bei der Mode kritisiert. Denn das betraf auch junge Menschen. Wenn man allerdings heute sieht, wie fast alle, wo sie gehen und stehen, tippen oder wischen, dann hat man den Eindruck, dass die Abhängigkeit von der Gesellschaft heute viel gefährlicher ist. Wer hat nicht 1000 Freunde im Netz? Eine andere Gefährdung sieht der Text in der Anonymität, in die jemand flüchten kann, um sein aufgebautes Image vor dem Nachbarn aufrecht zu erhalten. Vielleicht war uns die Anonymität auch deshalb verdächtig, weil man 1971 noch davon ausging, dass Hochdahl im Endausbau 45.000 Einwohner haben sollte.
Im Text wird dann die Rolle der Kirche in dieser Situation in den Blick genommen. „Die kirchliche Entwicklung hat mit der gesellschaftlichen nicht Schritt halten können. Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Lebensform des heutigen Menschen und den Lebens- und Verkündigungsformen der Kirche.“ Kritisch werden die Grundvollzüge kirchlichen Lebens unter die Lupe genommen, Verkündigung, Liturgie und Diakonie. Und deutlich werden die Schwachstellen benannt: Die Aussagen in der Verkündigung haben zu wenig Bezug zum konkreten Leben, auch wenn sie oft theologisch richtig sein mögen. In der Liturgie fehlt die immer wieder behauptete Gemeinschaftserfahrung und die Diakonie erschöpft sich oft in dauernden Appellen an den einzelnen Christen, für andere helfend tätig zu werden.
Es folgen noch einige Ausführungen zu der soziologischen Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit, die am Schluss dazu überleiten, was das zentrale Thema des Textes ist: wie können dem Einzelnen Wertungen und Strukturen angeboten werden, die es ihm ermöglichen, ganzmenschlich zu leben und sich personal zu entfalten und wie kann sich das in einer christlichen Gemeinde, wie kann sich das in der katholischen Gemeinde in der neuen Stadt Hochdahl vollziehen.
Im zweiten Abschnitt (Christliches Leben und Verkündigung heute) geht es um den Weg, wie Menschen heil werden können, und gleichzeitig um eine heilschaffende Gemeinschaft. Der Titel dafür lautet: Personale Begegnung. Was mit diesem Wort gemeint ist, lässt sich leicht erläutern. Wenn ein Mensch, der gemobbt wird oder der deutliche Erscheinungen von Burn-out hat, auf Menschen stößt, die ihn bedingungslos annehmen, dann kann ihn das zunächst trösten oder ermutigen. Wenn die Begegnung dann persönlicher wird, kann sie für den bedrückten oder bedrohten Menschen die Gelegenheit sein, sein Vertrauen zu sich und den Mitmenschen wieder oder neu zu entwickeln.. Beides ist wesentlich: der Hilfsbedürftige muss fähig sein, noch etwas Neues und Hilfreiches zu erleben und er muss Menschen begegnen, die ihn so annehmen und auffangen, wie er hinter aller Fassade wirklich ist. Und je mehr beide Seiten von allem Zufälligen und Verkümmerten absehen und einander so begegnen, wie sie im Kern ihrer Person wirklich sind, umso mehr geschieht Befreiung und Heilung. Die Voraussetzung, damit so etwas sich vollziehen kann, ist offensichtlich ein irgendwie gearteter Glaube an das Gute, an Liebe, an die Möglichkeit von Heil. Das heißt gleichzeitig, dass ein solcher Prozess nicht machbar oder gar manipulierbar ist. Man könnte sogar meinen, eine solche Beschreibung sei unlogisch, weil eins vom andern abhängt und weil man keins einfach setzen oder postulieren kann. Die in der Psychotherapie ein solches Muster vor Augen haben, müssen Könner sein!
Der nächste Abschnitt im Arbeitspapier beschreibt dann, wie personale Begegnung in Gruppen geschehen kann. Der Punkt b) dieses zweiten Teils war überschrieben „Personale Begegnung als Prozess“. Und diese Überlegungen sind auf Vorgänge in der Gemeinde anwendbar. Ein Zitat aus der entsprechenden Beschreibung im Arbeitspapier: „Die Gelegenheiten und Formen, in denen Menschen zusammenkommen, sind unendlich zahlreich. … Das anfängliche Motiv, sich zu begegnen, kann oberflächlich und zufällig sein. Zufällige Begegnung auf der Straße, im Geschäft, bei bestimmten Ereignissen (Pfarrfest) führt zu einem ersten Kontakt. Möglicherweise schließt man sich auch unter einem bestimmten Interesse (Interessengruppe) oder Bedürfnis (Kontaktsuche) zusammen. Möglicherweise löst sich ein solcher Zusammenschluss wieder auf, wenn das betreffende Bedürfnis erfüllt ist. Es kann aber auch sein, dass es – wegführend von dem ursprünglichen Anlass – zu einer personalen Begegnung zwischen diesen Menschen kommt. Man versteht sich gegenseitig, an die Stelle des Sachinteresses, das zusammenführte, tritt das Interesse an dem oder den anderen Menschen. In Gesprächen werden mehr und mehr die rein sachlichen, theoretischen Argumente, die nichts von der jeweiligen persönlichen Situation erkennen lassen, abgelöst durch Erfahrungsgründe. Der Einzelne bringt – im Maß des wachsenden Vertrauens – mehr und mehr seine eigene Geschichte, seine Situation, seine Erlebnisse, vielleicht sogar sein persönliches Versagen ein. Die theoretische Diskussion wird allmählich abgelöst von einem Gemeinschaftsprozess, der unter Umständen in der Auseinandersetzung mit einem Thema abläuft, in dem aber der Einzelne und die Gemeinschaft das eigentliche Thema sind. Je größer in diesem Prozess die Offenheit füreinander wird, je größer das Vertrauen und die Gesprächsbereitschaft, umso intensiver wird das Gemeinschaftsbewusstsein werden.“
Damit der Lesser nicht den Eindruck hat, das sei ein einfacher Prozess, immer in Richtung von etwas Besserem und Schönerem, werden in dem Text dann ausdrücklich Konflikte und Schwierigkeiten oder sogar das Scheitern mit einem Abbruch der Kontakte thematisiert. Auch das ist möglich, aber eben auch der Weg zu einer lebendigen, vertrauensvollen Gemeinschaft. Ich vermute, dass bei der Abfassung dieses Textes Erfahrungen mit den drei Jahre vorher gegründeten Ehekreisen mitgespielt haben.
Mit Blick auf die Kirche und die Gemeinde heißt es dann weiter: „Die Aufgabe von Kirche, Gemeinde, Gemeindeleiter ist von daher: Auf dem Weg personaler Begegnung den anderen Menschen ganz anzunehmen. Das bedeutet Verzicht auf Abwertung des Anderen, Verzicht auf Vorurteile, überhaupt auf vorgängige Wertung. Auf diesem Weg muss und kann der heutige Mensch die Botschaft Christi im Zeugnis der Christen als befreiend, beglückend, helfend erfahren. Die Kirche darf nicht mit einer neuen Forderung auftreten, der heutige Mensch ist sowieso dauernd gefordert und überfordert. Die Begegnung mit den Menschen der Gemeinde muss erfahrbar sein als bedingungslose Liebe, als radikale Bereitschaft, den anderen zu tragen. Das setzt die eigene Erfahrung des Getragenseins voraus, insofern einen lebendigen Glauben, Glaube an das Gute, Glaube an den Schöpfer, der zu seinen Menschen steht, Glaube an den auferstandenen Herrn, dessen Auferstehung Zeichen ist für den Sieg dienender Liebe, Güte, Hingabe. Solcher Glaube, solcher Optimismus, solche Hoffnung, solche Offenheit für den Anderen, sprich Liebe, macht die Botschaft Christi glaubwürdig, attraktiv, und ermöglicht dem andern, seinerseits zu glauben.“
Für die Praxis der Seelsorge in Hochdahl war der 3. Abschnitt (Prinzipien der Gemeindebildung) als Folgerung aus dem Bisherigen ganz wichtig. Wenn Personale Begegnung der Königsweg der Seelsorge werden soll, dann hat das Konsequenzen für die Bereiche oder Orte, an denen die Seelsorge vor allem tätig wird. Personale Begegnung kann sich nicht in der großen Menge, in den Großereignissen des Lebens der Kirche vollziehen. Diese sollen dadurch aber nicht in Frage gestellt werden, wenn sie von Glaubensgeist getragen sind. Personale Begegnung aber verlangt die überschaubare Größenordnung. Im Text wird die Meinung vertreten, dass für diese Form der Seelsorge Einzelgespräch – Familie – Kleine Gruppe die geeigneten Orte seien. Und noch einmal ein Zitat: „Es geht hier um die kleine Gruppe, die Lebensgemeinschaft sein kann, nicht um jede derartige Gruppierung. Das Klima in einer solchen Gruppe wird bestimmt von Vertrauen, Offenheit und einem großen Maß von Intimität. Dabei ist wesentlich, dass hierbei absolute Freiheit herrscht. Der Einzelne darf nicht den Eindruck haben, von der Gruppe überspielt zu werden. Er darf nicht zu Offenheit gezwungen werden. Nur soweit die Einzelnen in der Gruppe zu je größerer Offenheit bereit sind, wird der entsprechende Prozess möglich sein.“
Den bereits bestehenden kleinen Gruppen sollte die Möglichkeit der Intensivierung deutlich gemacht werden, aber auch hier darf kein Druck entstehen. Freiheit ist für den Glauben und die Gemeinde das oberste Gebot.
In der Folgezeit war das „Prinzip der kleinen Gruppe“ ein Schlagwort, das alle kannten und mit Vorliebe benutzten. Selbst heute, Jahrzehnte später, kann man erleben, dass die inzwischen alt gewordenen Jugendlichen von damals sofort Bescheid wissen, wenn man sie nach dem Prinzip der kleinen Gruppe fragt. Nicht so sicher ist allerdings, ob sie dabei immer wussten, wofür die kleine Gruppe gut sein sollte.
Als ich in den späten Jahren das Arbeitspapier wieder gelesen habe, war ich immer noch von den Überlegungen angetan – mehr als vierzig Jahre, nachdem der Text entstanden ist. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwelche Anregungen gab, die wir bei den Überlegungen zu diesem Text aufgenommen haben. Denn es ist nicht wahrscheinlich, dass die Idee mit der Personalen Begegnung nur eigenen Überlegungen entsprang. Nun gab es zu der Zeit eine breite Bewegung, die sich mit dem Namen Carl Rogers verband. Dass wir davon beeinflusst waren, ist möglich, aber nicht nachweisbar. Carl Rogers war ein US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, der eine personzentrierte (klientenzentrierte) Psychotherapie vertrat und praktizierte. Und in vielen Bereichen führten seine Ausführungen zu neuen und hilfreichen Ansätzen. Eine sehr ausführliche Zusammenstellung der Schriften von Carl Rogers und seiner vielfältigen Wirkungen fand ich in einem Buch, das 1989 im Echter Verlag in Würzburg erschienen ist: „Peter F. Schmid, Personale Begegnung. Der personzentrierte Ansatz in Psychotherapie, Beratung, Gruppenarbeit und Seelsorge“. – Immerhin eine Spur, die vielleicht auch nach Hochdahl geführt hat – schon 1971.
Ich habe oft überlegt, warum das Arbeitspapier damals für die Seelsorge keine Rolle gespielt hat. Bei der Sitzung, für die es entstanden war, ist es „durchgefallen“, wie jemand vor einiger Zeit einer alten Notiz entnommen hat. Das war zu erwarten. Denn wenn Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat zusammenkommen, stehen die praktischeren Dinge zur Debatte Und damals gab es viel zu planen und zu entscheiden. In dem Zusammenhang hatte das Arbeitspapier keine Chance. Es hat ja nur eine spezielle Sicht für die innere Entwicklung der Gemeinde angeboten. Der Text hätte genauso gut in einer Zeitschrift stehen können (das ist jetzt kein Qualitätsanspruch) und man hätte hin und her darüber diskutieren können. Aber er forderte keine Entscheidung für dieses oder jenes Verhalten. Die praktische Umsetzung wurde offen gelassen und dabei schlugen dann in der Planung für die Gemeinde die Aufgaben durch, die erkennbar und naheliegend waren. – Es kann auch sein, dass der Wunsch nach dem Neuen in der Gemeinde an anderer Stelle hinreichend stark war. Es war ja eine Zeit des intensiven Aufbruchs, sowohl in der Vorstellung vom Leben der Gemeinde, als auch in besonderem Maß in den Formen der Liturgie (Muttersprache, Teilnahme am Mahl der Eucharistie). – Es kann auch sein, dass der Weggang von Hans Meixner einige begonnene Entwicklungen durcheinander gebracht hat; vermutlich war seine Absicht Ende 1971 in der Gemeinde schon im Gespräch. Als er wegging, rückte nämlich die Frage nach der Leitung der Gemeinde und der Teamarbeit in den Mittelpunkt (vgl. Nr. 18).
15. Schlechte Stimmung
Im Pfarrgemeinderat gab es nach 1971 wiederholt heftige Auseinandersetzungen, die oft auch mit Aggressivität und Lautstärke einhergingen. Es ging immer um die Zukunft der Gemeinde. Wenn man sehr wohlwollend ist, kann man die Konflikte als ein Zeichen interpretieren, dass das Thema keinen der Beteiligten gleichgültig ließ. Trotzdem werden einzelne Mitglieder inständig gewünscht haben, dass etwas mehr Rücksichtnahme oder Selbstbeherrschung das Zusammensein erträglicher und erfreulicher machen würde. Manches wird man mit der menschlichen Schwäche erklären können, manches war sicher auch eine Folge von Herrschaftsansprüchen. Und die Stimmung war oft schlecht und ließ sich dann auch nicht kurzfristig verbessern.
Wenn man diese Situation zu verstehen versucht, dann fällt zunächst auf, wie sehr sich die Atmosphäre im Pfarrgemeinderat verändert hatte. In der Einleitung zum vorigen Text („Personale Begegnung“) wird erzählt, welchen Arbeitseifer die Mitglieder im Frühjahr 1971 an den Tag gelegt haben. Die Stimmung war offensichtlich sehr gut und das Wochenende in Horrem war so produktiv, dass daraus die Vorstellung von der personalen Begegnung entstehen konnte. Sogar die Gliederung des Textes stammte von diesem Treffen. Am 1.September 1971 war dann die Sitzung von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, für die dieser Text entstanden war. Und da ist das Arbeitspapier „durchgefallen“, wie jemand viele Jahre später aus seinem Tagebuch zitieren konnte. Der Text hatte die Überschrift „Gedanken zur Entwicklung der katholischen Kirchengemeinde Hochdahl“ und natürlich ging es dabei um die innere, also die geistliche Entwicklung der Gemeinde. Wenn aber Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand eine gemeinsame Sitzung hatten, dann haben sie dabei nicht über die geistliche Entwicklung der Gemeinde gesprochen. Sie werden sich mit praktischen Aufgaben und Lösungen beschäftigt haben. – Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im September/Oktober 1971 enttäuscht oder wütend gewesen wäre; aber „die schlechte Stimmung“ muss irgendetwas mit dieser Ablehnung des Arbeitspapiers zu tun gehabt haben.
Es hat dann lange gedauert, bis ich mich noch einmal mit dem Artikel über die „Personale Begegnung“ (Nr.14) beschäftigt habe, um mir den Zusammenhang wieder ins Gedächtnis zu rufen. Dabei fiel mein Blick zufällig auf ein paar Worte in der Einleitung zu diesem Text. – Die Worte stehen nur in Klammern, spielten also keine Rolle im Gedankengang und sind trotzdem sehr wichtig. Der Pfarrgemeinderat hatte in Horrem eine „Theologisch-geistliche Wochenendtagung“ erlebt. Dieser Titel trifft ziemlich genau die Thematik und die Atmosphäre bei diesem Treffen. Die in Horrem dabei gewesen waren, behielten das Wochenende in guter Erinnerung. Und es wirkte nach. „Der Geist von Horrem“ wurde in der Folgezeit immer wieder zitiert oder sogar beschworen. Und das war Ausdruck des Wunsches, eine solche Intensität im Gespräch und Vertrautheit im Miteinander wieder zu erleben. Für mich war das eine Vorstellung, wie ich mir die Zugehörigkeit zur Kirche und die Zusammengehörigkeit unter den Mitgliedern der Gemeinde wünschte. Und ich hatte die Hoffnung, dass eine solche Mentalität für die Zukunft der Gemeinde prägend werden könnte.
Das Problem mit dem Geist von Horrem war nur, dass es die Bedingungen jenes Wochenendes nicht mehr gab. Die guten Erfahrungen und das reale Erleben der Gruppe waren Vergangenheit. Was in der Folgezeit übrig blieb, war ein Bedürfnis (nach Wiederholung), ein Wunsch, der sich bei entsprechenden Situationen unter Umständen in einen Anspruch verwandelte. Dieser Wunsch hatte in der Gemeinde keine Möglichkeit, in einer Gruppierung, einem Kreis oder einer regelmäßigen Veranstaltung realisiert zu werden. Eine solche Möglichkeit hätte erst geschaffen werden müssen. Gruppen wie die Ehekreise wären dazu vielleicht eine Chance gewesen. Aber in dieser Phase ist es dazu nicht gekommen. Es könnte deshalb sogar sein, dass das Konzept und die Beschreibung in dem Text „Personale Begegnung“ durchaus auf Interesse stieß, dass es aber an der Umsetzung fehlte. Es gab offensichtlich nirgendwo ein Programm oder eine klare Beschreibung, welche Gruppen daran arbeiten sollten und mit welchen Methoden das geschehen könnte.
Und dann geschah etwas, was die anfangs beschriebene Misere zur Folge hatte. Da gab es doch ein Gremium, das existierte und bei allen hoch im Kurs stand: Der Pfarrgemeinderat! Etwas von dem, was man in Horrem erlebt hatte oder was in der „personalen Begegnung“ beschrieben war oder was man sich als gute Atmosphäre in einer Gruppe wünschte, sollte im Pfarrgemeinderat Wirklichkeit werden. Solche Bedürfnisse waren vorhanden, aber sie waren sehr wahrscheinlich keinem der Beteiligten klar bewusst.
Es gab andere Vorstellungen, mit denen andere Leute in den Pfarrgemeinderat kamen. Es gab in dieser Phase des Aufbaus der Hochdahler Gemeinde viel zu überlegen, zu besprechen, zu planen und zu entscheiden. Und das musste im Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand geschehen. Die Fragestellungen, die dabei geklärt werden mussten, kann man zum Beispiel in Nr.17 nachlesen (Eine Gemeinde von 20.000 Katholiken). Und wie die Durchführung und die Vollendung aussehen konnten, wird in Nr.47 erzählt (Das Haus in Millrath-Ost). Es gab sehr viel zu tun und auch ich habe dabei mit Begeisterung und viel Phantasie mitgemacht. – Und dafür war die Mentalität nötig, die zur Ablehnung des Arbeitspapiers (Personale Begegnung) in der Sitzung von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand am 1.9.1971 geführt hatte. Es ging um sachliche Fragen, die für die Zukunft der Gemeinde entscheidend waren, die gute Information, Sachkenntnis und klare Entscheidungen verlangten. Und das war ein Anspruch, der von der Sache gefordert war.
Ich halte beide Bedürfnisse und Wüsche für berechtigt. Und beide Aufgaben, die geistliche Entwicklung der Gemeinde und die Sorge um die räumliche Struktur, um die äußeren Lebensbedingungen, müssen ihren Ort haben. Nur darf man beide Aufgaben auf keinen Fall gleichzeitig zu lösen versuchen. Sie sollten deshalb auch nicht bei ein und derselben Sitzung des Pfarrgemeinderats zur Debatte stehen. Ziel und Methoden sind so verschieden, dass beim Zusammentreffen nur Unfriede entstehen kann. Und das scheint im Pfarrgemeinderat nach 1971 immer wieder der Fall gewesen zu sein. Etwas schematisiert kann man wohl sagen: es gab die ganze Zeit zwei unterschiedlich Vorstellungen, was in den Sitzungen geschehen sollte. Wären diese verschiedenen Wünsche klar und beschreibbar gewesen, dann hätte man für jedes Anliegen unterschiedliche Treffen vereinbaren können. So aber waren im Untergrund beide Bedürfnisse dauernd präsent und es gab eine permanente Spannung, die sich ziemlich regelmäßig entlud. – Ein guter Trainer hätte die Situation analysieren und entschärfen können!
Wenn diese Deutung der Schwierigkeiten richtig ist, dann dürfte „Hassels“ etwas von seinem Schrecken verlieren. Das Wochenende in Hassels war nämlich der Höhepunkt der problematischen Situation. Man braucht den Namen „Hassels“ nur zu nennen und bei allen, die dabei waren, verdüstert sich das Gesicht und ein „furchtbar“ quält sich über die Lippen. Geplant war es als ein Treffen zur „Selbstfindung“, weil ja die Arbeit für die Gemeinde davon abhängig ist, wie die Gruppe sich selbst versteht. Der Pfarrgemeinderat war im März 1974 neu gewählt worden und das Wochenende war im Herbst 1974. Hassels ist ein kleiner Stadtteil von Düsseldorf im Südosten der Stadt. Im Jugendheim der dortigen Pfarrei waren wir versammelt und einer, der aus beruflichen Gründen erst etwas später dazu kam, fand eine Truppe vor, die zerstritten und deprimiert und den Tränen nahe war. Die damals dabei waren, können durchweg nicht mehr sagen, worum es eigentlich ging, stellen aber fest: es war eine totale Katastrophe! So wurde der Name „Hassels“ zum Begriff für das, was in den ersten Jahren der neuen Stadt nicht gelungen ist – zumindest im Pfarrgemeinderat.
Bei dem Versuch, die „schlechte Stimmung“ zu verstehen, tauchte die Frage auf: Wieso musste der Gegensatz zwischen den verschiedenen Vorstellungen für die Zukunft der Gemeinde ausgerechnet im Pfarrgemeinderat ausgetragen werden?
1. Der Pfarrgemeinderat war ein neues und von vielen Mitgliedern in der Gemeinde geschätztes Gremium. Viele Katholiken verbanden damit die Hoffnung, dass die Kirche lebendiger und menschlicher werden würde. Hans Meixner hatte schon vorher einen Pfarrausschuss gegründet, der manche Funktionen vorwegnahm. Diese Gruppe wurde zum Pfarrgemeinderat. Wenn es nun um die Zukunft der Gemeinde ging, war der Pfarrgemeinderat das zuständige Gremium. Ein anderes Gremium, das eine vergleichbare Beschäftigung mit der Zukunft ermöglichte, gab es nicht. Die Rolle des Kirchenvorstands war nach Staatskirchrecht auf andere Abläufe festgelegt.
2. Der Pfarrgemeinderat war eine hinreichend unverbindliche Gruppierung. Man konnte Grundsatzprobleme debattieren, man konnte auch Entscheidungen fällen und man konnte sogar Aufgaben verteilen. Die Ausführung war damit aber nicht garantiert. Eine solche Erfahrung konnte und kann man bis heute immer wieder machen. Und jede nicht umgesetzte Lösung verstärkte den Frust.
3. Wenn man mutig ist, könnte man deshalb behaupten, die zu Beginn beschriebene Misere sei zum Teil die Folge eines Fehlers in der Konstruktion des Pfarrgemeinderats. Vielleicht müsste man deshalb die Struktur und die Aufgaben des Pfarrgemeinderats noch einmal unter die Lupe nehmen.
Ein anderes Gremium war bei uns in Hochdahl ähnlich angesehen und beliebt: das Team. In Nr.6 wird der Sinn der Zusammenarbeit unter mehreren Hauptamtlichen sehr positiv beschrieben. Und nach dem Weggang von Hans Meixner übernahmen wir als Team die Leitung der Gemeinde (Nr.20). Dafür gibt es eine Beschreibung, wie die Teamarbeit im Einzelnen geplant war. In Team 4 (Nr.55) steht dann eine kritische Bemerkung, dass die Übereinstimmung zwischen den Teammitgliedern nicht so gelungen ist, wie das in der Theorie geplant war: „Was sehr schwierig war und weitgehend nicht gelungen ist, war der Austausch über die persönlichen Hintergründe, Bedürfnisse, Sorgen und Enttäuschungen. In den ersten Jahren ist das nicht zum Problem geworden. Wie waren ja auch nicht unvorbereitet in das Experiment „Teamarbeit“ eingestiegen.“ Das hat zwar nicht zum offenen Konflikt geführt, hat aber vielleicht manche Klärung oder Problemlösung behindert. – Ob wir als Team in die gegensätzlichen Positionen im Pfarrgemeinderat eingebunden waren, halte ich für möglich, ist aber nicht mehr zu klären. Genau so wenig ist zu sagen, was wir als Team für die Lösung hätten tun können.
Der folgende Text (Nr.16) ist überschrieben: Eine neue Chance. Bei der Umstellung der Vorbereitung auf die Erstkommunion gab es die bisher nicht vorhandenen anderen Gruppen (außer dem PGR): die Gruppen der Kinder und die Gruppen der Eltern, die die Kinder begleiteten. Die ganze Arbeit hatte eine klare Struktur mit festgelegten Arbeitsabläufen, Treffen und Inhalten. Die Organisatoren kamen zu ihrem Recht. Gleichzeitig war eine geistliche Entwicklung das Ziel, vor allem in den Gruppen der Kinder und als Voraussetzung dafür auch in der Gruppe der Begleiter. Das Gespräch sollte zu Erkenntnis und wachsender Gemeinschaft führen. Eine organisatorische und geistliche Entwicklung!
16. Eine neue Chance
Das Arbeitspapier von 1971 formulierte ein anspruchsvolles Ziel. Die christliche Gemeinde in der neuen Stadt Hochdahl sollte ihr Bemühen darauf ausrichten, dass Menschen aus Entfremdung, Abhängigkeit und Anpassung herauswachsen und zu eigenverantwortlichen Menschen werden. Und die Mitglieder der Gemeinde sollten gleichzeitig in Vertrauen und Offenheit zueinander finden. Den Weg dazu haben wir mit dem Wort „Personale Begegnung“ umschrieben (Siehe Nr.14). Die Situation in Hassels zeigte, wie weit wir von diesem Ziel entfernt waren.
Aber dann bekamen wir eine neue Chance, die sich sogar parallel zu den Querelen im Pfarrgemeinderat entwickelte. Im Jahr 1973 haben wir die Vorbereitung auf die Erstkommunion auf kleine Gruppen umgestellt. Welche Veränderungen damit konkret verbunden waren und wie die Arbeit danach aussah, wird unter Nr.24 ausführlich erzählt. Dort kann man auch nachlesen, weshalb wir die neue Form für wesentlich besser hielten als die alte Praxis. – Was da 1973 begann, hatte eine kaum zu überschätzende Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde. Es war der Beginn der „Gemeindekatechese“, die unsere Gemeinde fast 40 Jahre lang geprägt hat. Ich glaube inzwischen, dass dieser Vorgang von 1973 die wichtigste Veränderung in der Geschichte der Gemeinde gewesen ist. Und wir sind in Hochdahl dieser Praxis bis 2007 und darüber hinaus treu geblieben. Dabei konnten wir irgendwann in späteren Jahren das Gefühl haben, ziemlich allein übrig geblieben zu sein. Natürlich ist die Erstkommunionvorbereitung mit immer wieder neuen Variationen weitergeführt worden, auch mit intensiver Beteiligung der Eltern. Aber oft war dabei auch deutlich, dass der Ablauf nicht mehr mit dem Wort „Gemeindekatechese“ zu beschreiben war. Die Geschichte der Gemeindekatechese in den westdeutschen Diözesen ist nämlich leider auch eine Geschichte der verpassten Chancen.
Die neue Möglichkeit, die wir 1973 bekamen, war für uns und die Gemeinde ein Geschenk. Wir haben die Umstellung zwar vollzogen und wir haben auch viele Gründe gehabt, so zu handeln (Siehe 24). Aber wir haben sie uns nicht ausgedacht. – Sie kam über uns. Sie begegnete uns – zufällig – auf unserem Weg. Und es muss ein ziemlich plötzlicher Vorgang gewesen sein. Viele Gemeinden in den westdeutschen Diözesen haben sich fast gleichzeitig entschieden, die Vorbereitung auf die Erstkommunion in kleinen Gruppen anzubieten. Und das vollzog sich, wenn ich mich recht erinnere, innerhalb von ein, zwei Jahren. Woher der Anstoß kam, ist nicht mehr festzustellen. Vielleicht war es ein Impuls, der von der Synode der deutschen Bistümer (1971 bis 1975) ausging, die ja auch für die Firmvorbereitung klare Empfehlungen ausgesprochen hat. Und wir in Hochdahl waren uns in diesem Fall sogar einig. Die erwähnten Schwierigkeiten im Pfarrgemeinderat standen plötzlich nicht mehr im Vordergrund. Team, Pfarrgemeinderat und viele Gemeindemitglieder haben die Umstellung einmütig begrüßt und sich mit Elan und großem Eifer an die Arbeit gemacht. Vielleicht gab es in der Gemeinde doch mehr Übereinstimmung als „Hassels“ vermuten ließ. Aber vielleicht war auch diese Einmütigkeit eine Beigabe in dem Geschenk.
Und es war ein überaus großzügiges Geschenk. In den ersten Jahren nach der Umstellung hatten wir jedes Jahr etwa 200 Kommunionkinder. Jeweils 20 bis 30 Eltern begleiteten diese Kinder. Diese Zahl nahm natürlich im Laufe der Zeit ab, aber auch zur Jahrtausendwende waren die Jahrgänge noch zwischen 100 und 150 (kath.) Kindern stark. Nach der Erstkommunion nahmen viel Kinde dann am Bußkurs teil. Ab 1977 wurde die Firmvorbereitung nach dem gleichen Muster gestaltet. Gruppen von acht bis zehn Jugendlichen hatten drei Begleiter. Von den katholischen Jugendlichen eines Jahrgangs nahmen dann zwar nur noch etwa ein Drittel an dem Glaubenskurs zur Vorbereitung auf die Firmung teil, aber das waren immerhin jedes Jahr 50 bis 60 Jugendliche. Und dann die Gespräche mit den Eltern der Taufkinder, die Taufvorbereitung für Schulkinder, die Wochenenden für Jugendliche nach der Firmung! Wenn man sich diese große Schar von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vergegenwärtigt, dann geht es nicht um Zahlen. Vielmehr kann deutlich werden, welche Chancen wir in den verschiedenen Bereichen der Gemeindekatechese gehabt haben. Ausgangspunkt war die Umstellung der Erstkommunionvorbereitung. Und daraus ergaben sich die vielen Möglichkeiten in den anderen Bereichen der Seelsorge.
Die Entscheidung von 1973, die Vorbereitung auf die Erstkommunion auf kleine Gruppen umzustellen, war überlegt und klar gewollt. Aber sie war mit einigen Risiken verbunden. Wenn uns das zu dem Zeitpunkt bewusst war, dann haben wir uns davon nicht sonderlich irritieren lassen. Vermutlich hat uns der Schwung des Konzils mutig gemacht. In vielen Pfarreien haben sich diese Risiken aber später als sehr schwerwiegend erwiesen und die Rückkehr zum Alten, scheinbar Bewährten, verursacht.
Zunächst war es ein Wagnis, für die Vorbereitung der Erstkommunion den Unterricht abzuschaffen. Denn „Unterricht“ war die Form, in der seit Jahrhunderten in Europa das Wissen von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Besonders die privilegierten Gruppen in der Gesellschaft legten großen Wert darauf, dass ihre jungen Mitglieder alles an Wissen und Bildung zur Verfügung hatten, wenn sie die Altvorderen in der Leitung und Verantwortung ablösten. So hatten die Orden und die Herrscherhäuser ihre Schulen. Und auch in der Ausbildung der Priester gab es einen solchen soliden Bildungsweg. – Die religiöse Bildung des „Volkes“ kam natürlich auch nicht ohne Unterricht aus. Grundgelegt wurde der Glaube zwar in der Familie. Aber die Weiterführung geschah dann durch Predigt, „Christenlehre“ und schulischen Religionsunterricht. Der wurde – so habe ich es in meiner Kindheit erlebt – in Absprache zwischen Pfarrer und Lehrpersonen erteilt. Den Bibelunterricht gab bei uns die Lehrerin, für den Katechismus kam der Pastor in die Schule. Und im „Unterricht“ muss man „lernen“. Ich habe noch ganze Passagen aus dem Katechismus auswendig gelernt, nicht nur die Fragen und Antworten, sondern auch Teile der Erläuterungen. Auch für den Beicht- und Kommunionunterricht kam der Pastor in die Schule. Er ging zwar sehr einfühlsam mit den Kleinen um, aber es war halt doch „Unterricht“. Bei dieser Tradition war es eigentlich ganz konsequent, dass in unserer Kommunionvorbereitung in Hochdahl Eltern immer wieder fragten, ob die Kinder nicht das Glaubensbekenntnis und die zehn Gebote auswendig lernen müssten.
Es war sehr mutig, gegen ein solches Gewicht der Tradition bei der Umstellung der Kommunionvorbereitung auf den Unterricht zu verzichten. Vielleicht spielte dabei auch eine Rolle, dass wir die fragwürdigen Seiten vieler „Lehrveranstaltungen“ ja auch kannten. Ich war jedenfalls froh, dass ich nicht mehr, wie in den beiden Jahren vorher, 30 bis 40 Kommunionkinder in der Willbecker Schule unterrichten musste. Demgegenüber war die kleine Gruppe von fünf bis sieben Kindern verheißungsvoll. Die Kinder hatten die Chance, eine intensive Gemeinschaft zu erleben und wegen der begrenzten Zahl der Teilnehmer auch untereinander Beziehungen und Freundschaft zu finden. Vielleicht kann man deshalb sagen, dass der Unterricht in die Schule gehört und das Gespräch der kleinen Gruppe in die Gemeinde. In der kleinen Gruppe ist die Form des Lernens das Gespräch, bei dem grundsätzlich jeder Gesprächspartner ist und durch sein Überlegen und Erzählen, durch sein Fragen und Suchen zum Wachstum des Glaubens und der Erkenntnis beitragen kann. Diese Form des Lernens ist eine grundsätzliche andere als die Form des Unterrichts. Aber das große Risiko war, dass auf die Dauer der übliche Unterricht für alle Beteiligten wieder attraktiv werden könnte, weil er einfacher und bequemer und mit weniger Einsatz zu planen und durchzuführen ist.
Ob die neue Form der Kommunionvorbereitung gelingt und ein Rückfall in alte Unterrichtsformen vermieden werden kann, hängt von allen Beteiligten ab. Dabei sind die Schwierigkeiten nicht gleichmäßig verteilt. – Die Gemeindeleitung muss bedingungslos zu der Veränderung stehen und darf sich auch nicht durch Schwierigkeiten oder Missverständnisse von Gemeindemitgliedern verwirren lassen. Die Aufgabe ist aber relativ einfach, weil sie vor allem die Rahmenbedingungen garantieren muss, von der Einladung der Eltern bis zur Gestaltung der Kommunionfeier. Und die Zuständigkeit der verschiedenen Mitglieder der Gemeindeleitung für ein oder zwei Stadtviertel (vgl.Nr.24) war eher eine Möglichkeit, „dabei zu sein“, und nicht so sehr eine Belastung. Soweit die vorgesehenen Elternabende wirklich zustande kamen, konnte es dabei hin und wieder zu Konflikten kommen, wenn die verschiedenen Vorstellungen vom Leben der Kirche aufeinandertrafen. – Die neue Form der Vorbereitung vollzieht sich natürlich vor allem in der Arbeit der Eltern, die die Kinder in der kleinen Gruppe begleiten. Es waren meistens die Mütter, die diese Aufgabe übernahmen. Und ich glaube, dass diese „Zuständigkeit“ gut war. Denn die Mütter haben in vielen Fällen aus den Erfahrungen mit eigenen Kindern eine natürliche Kompetenz entwickelt, die durch keine Schulung oder Anweisung eingeholt werden kann. Und die Entwicklungspsychologie sagt ja wohl auch, wie stark und wichtig die Bindung von Mutter und Kind in den ersten Jahren ist. Und die Erfahrungen aus dieser Zeit wirken sich sicher auch noch aus, wenn die Kinder im dem Alter sind, dass sie zur Kommunion gehen. Das gilt natürlich nicht, wenn die Eltern beide voll berufstätig sind und das schon kurz nach der Geburt eines Kindes wieder aufgenommen wird. In der kleinen Gruppe geschieht die Umstellung in der Form des Lernens. Sie vollzieht sich so, dass jeder in der Gruppe überlegt und sucht und fragt und seine Erkenntnis, mag sie auch noch so klein sein, ins Gespräch bringt. Jeder Teilnehmer ist gewissermaßen gleichzeitig Lehrender und Lernender. Die Rolle der Mutter in der kleinen Gruppe sieht dann so aus, dass auch sie sucht und fragt und ihre Erkenntnisse – in der kindgerechten Sprache der Gruppe – ebenfalls ins Gespräch bringt. Gleichzeitig muss sie im Blick haben, welche ihrer Erkenntnisse die Kinder zu neuem Fragen und Finden anregen können. Das ist nicht einfach. Es ist aber sicher näher am Leben als im Katechismus vorformulierte Sätze zum Auswendiglernen. Und deshalb kann man auch erleben, dass diese Form des Gesprächs viel Freude macht. Und alles, was auch nur von Ferne eine Beziehung zum Glauben hat, kann zum Gegenstand des Fragens und zum Ausgangspunkt des Gesprächs werden. Sehr hilfreich sind dabei die vielen Kinderbibeln und Bildhefte zum Leben Jesu. Auch Kirchen und Gottesdienst warten in der Vorbereitungszeit auf Kennenlernen und Verstehen. – Den schwierigsten Part hat der, der die Vorbereitung leitet für die Eltern, die die Kinder begleiten. Das wird im Normalfall einer der Hauptamtlichen sein, einer aus der Gemeindeleitung, vielleicht zusammen mit einem oder zwei Mitgliedern der Gemeinde, die schon Erfahrung in der Kommunionvorbereitung gesammelt haben (vgl. auch hier Nr.24). Diese Aufgabe ist vor allem deshalb schwierig, weil sie eine deutliche (vielleicht sogar radikale) Veränderung im eigenen Rollenverständnis fordert. Er muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass er der Wissende ist, der die Anderen unterrichtet. Er muss sich stattdessen wie die Anderen als ein Suchender und Fragender verstehen. Konkret heißt das, dass er seine theologischen oder allgemein menschlichen Kenntnisse nicht als Besitz verwalten darf, sondern sie neu wie beim ersten Mal befragen und bedenken und erkennen muss. Denn die ganze Gruppe soll zunächst klären, was Gott, Jesus, Kirche, Eucharistie usw. für das eigene Leben bedeuten. Dann kann man mit den eigenen Erfahrungen und Lebendbezügen den Kindern etwas weitergeben, was auch ihr Leben betrifft. Wenn dieser Prozess der Klärung offen und ehrlich vollzogen wird, dürfte sich in den meisten Fällen in der Gruppe ein gutes Klima einstellen. Gegenseitiges Vertrauen ist für die Gemeinschaft und auch für den Weg der Erkenntnis wesentlich.
17. Eine Gemeinde von 20.000 Katholiken …?
Wie schon erwähnt, sollte die neue Stadt Hochdahl nach den ursprünglichen Planungen im Endausbau 45.000 Einwohner haben. Wenn dieses Ziel auch später deutlich reduziert wurde, war es für uns doch wertvoll, bei der Planung der Seelsorge von dieser Größenordnung auszugehen. Da es sich nicht um eine „normale“ Situation handelte, durften wir auch nicht mit den „normalen“, hergebrachten Vorstellungen planen. Wir mussten sehr grundlegend suchen und fragen, wie die Zukunft dieser Pfarrei aussehen sollte. 45.00 Einwohner – das bedeutete etwa 20.00 Katholiken. Wir waren damals also schon bei einer Größenordnung, die heute durch die Fusionen zustande kommt.
Und wie sah die Konzeption aus, nach der wir den Aufbau der katholischen Kirchengemeinde in der neuen Stadt Hochdahl geplant haben? Das ist relativ gut beschrieben in einer Nummer der „Aspekte“, die im Januar 1981 erschienen ist und Informationen für eine Pfarrversammlung zum Bauvorhaben Millrath-Ost enthielt. Es ist am einfachsten, den entsprechenden Artikel hier abzudrucken (mit leichten Veränderungen wegen der vielen Jahre, die inzwischen vergangen sind).
Kath. Kirchengemeinde in der Neuen Stadt Hochdahl. Aufbau-Konzeption.
1. Eine Pfarrei oder mehrere?
Schon ganz zu Anfang (1968) musste die Frage geklärt werden, ob ganz Hochdahl eine Pfarrei bleiben oder in mehrere Pfarreien aufgeteilt werden sollte. Bei einer Größenordnung von 45.000 Einwohnern war mit ca. 20.000 Katholiken zu rechnen. Bei einer Aufteilung in mehrere Pfarreien wären also 2 – 3 Pfarreien nötig gewesen. In anderen Neubaugebieten ist man den Weg der Aufteilung gegangen, z.B. in Garath.
Nun war damals das Klima für Zusammenarbeit in größeren Einheiten günstig. Man sprach häufiger von Pfarrverbänden, d.h. Zusammenschlüssen mehrerer alter Pfarreien zu größeren Verwaltungseinheiten. Auch der Austausch und die Zusammenarbeit von Geistlichen mehrerer Gemeinden wurden empfohlen und praktiziert.
Wenn man sich heute vorstellt, es würde in Hochdahl 2 oder 3 verschiedene Pfarreien geben, dann springt in die Augen, wie unmöglich das wäre. Im Nachhinein kann man eindeutig sagen, dass die Entscheidung damals richtig war: eine Stadt – eine Pfarrei. Und das nicht nur, weil man sich inzwischen daran gewöhnt hat, sondern weil es der Einheit der Stadt und dem Lebensablauf der Bürger entspricht.
2. Die Vorteile der Groß-Raum-Seelsorge
Die große Gefahr bei kleinen Ein-Mann-Pfarreien ist die geistige Engführung. Da die Gemeinde eigenständig ist, alle wesentlichen Funktionen selbst erfüllen kann, kann das dazu führen, dass sie selbstgenügsam, abgekapselt und ohne intensiven Austausch mit der Umgebung vor sich hinlebt.
Also lautete die Entscheidung: Hochdahl bleibt eine Pfarrei, 20.000 Katholiken (nach dem ursprünglichen Planungsziel), um die Vorteile der Groß-Raum-Seelsorge wahrnehmen zu können.
Das bedeutet: wegen der Größe sind mehrere hauptamtliche Kräfte am Ort; die sind nicht für kleine abgegrenzte Bezirke zuständig, sondern gemeinsam für das Ganze. Dadurch wird ein intensiver Austausch möglich und nötig. Weiterhin wird eine gewisse Spezialisierung der Arbeit der einzelnen Kräfte möglich, man kann damit auch spezielleren Bedürfnissen bestimmter Gruppen in der Gemeinde entgegenkommen (z.B. beruflich bedingt wie bei Lehrerarbeitskreisen, oder interessenbedingt bei sangesfreudigen Jugendlichen). Auch können manche Aktivitäten, die sonst überregional wahrgenommen werden, wegen der größeren Zahl der Interessenten in der eigenen Pfarrei angeboten werden (z.B. Gruppenleiterschulungen).
Im Hinblick auf die zukünftige Größe Hochdahls war der Personalbestand bereits in der Planungsphase größer als es der aktuellen Katholikenzahl entsprach. Dadurch konnte man schon früh feststellen, dass sich diese Vorteile der Großraumseelsorge – vor allem Austausch und Spezialisierung – auch wirklich einstellen.
3. Die Notwendigkeit überschaubarer Einheiten.
Wenn ein Haufen von 15.000 Leuten (nach dem inzwischen reduzierten Planungsziel) keine Untergliederungen aufweist, muss er notwendigerweise zum Alptraum werden: riesig, atomisiert, anonym, unfähig zum Leben (deshalb „Haufen“).
Wenn Hochdahl eine Pfarrei bleibt (um der eben geschilderten Vorteile willen), muss sofort mit gleicher Intensität überlegt werden, wie man kleinere Gruppierungen, Unterteilungen, Sub-Strukturen ermöglichen kann. In einer anonymen Gemeinde von 15.000 kann man sich nicht wohlfühlen; man braucht die überschaubare Gruppe von Menschen.
Im Anschluss an die Stadtplanung bot sich an, diese überschaubare Größe in den Stadtvierteln zu suchen. Dort lebt man miteinander, dort wachsen die Kinder auf und haben ihren Lebenskreis, dort trifft man sich. Das bedeutet für die Kirchengemeinde, dass die eigentlichen Lebensvollzüge der Gemeinde ihren Ort in den Stadtvierteln haben: Gruppierungen von Erwachsenen, Erstkommunion- und Bußvorbereitung, Elternabende zu Kommunion und Buße, Nachbarschaftshilfe, Glaubens-Gesprächs-Kreise (z.B. zur TV-Serie „Warum Christen glauben“), Kinder- und Jugendgruppen (!) usw. Das ist gemeint, wenn gesagt wird, die seelsorgliche Grundversorgung vollziehe sich in den Stadtvierteln.
Das sollte ein Angebot sein, keine Fessel; d.h. ich kann mich an mein Stadtviertel halten, weil es eine Erleichterung bedeutet, d.h. nicht, dass jemand aus Willbeck nicht nach Millrath gehen dürfte. Angebot in Freiheit!
4. Grundversorgung und zentrale Aufgaben.
Wenn man die Konzeption verstehen will, nach der wir versucht haben, Gemeinde aufzubauen, muss man in „Sowohl als auch“ denken. Die Gemeinde lebt aus der ausgehaltenen Spannung zwischen 2 Polen: Großpfarrei und Stadtviertel.
In den Stadtvierteln soll sich alles abspielen, was zur religiösen Grundversorgung gehört (siehe oben), für die Gesamtpfarrei im Hauptzentrum soll sich alles abspielen, was zu den zentralen Aufgaben gehört.
Wenn man einen der beiden Pole vernachlässigt, schädigt man das Ganze: Betont man nur die Stadtviertel, wird´s kleinkariert (dann lasst uns doch sofort in einzelne Pfarreien aufteilen!) – betont man nur die Zentrale, wird´s anonym.
Anmerkung. Dieser Artikel erschien im Januar 1981. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man mit 33.000 – 35.000 Einwohnern im Endausbau. Das hätte bedeutet, dass die Kirchengemeinde etwa 15.000 Katholiken gehabt hätte. Auch diese Planung war noch zu hoch. In der Folgezeit wuchs Hochdahl nicht über 27.000 Einwohner hinaus.
Und wie sah die Praxis aus?
Eine Konzeption ist ein Entwurf in die Zukunft hinein. Und das bedeutete zwischen 1968 und 1972, Vorstellungen, Bilder, Modelle zu entwickeln, mit deren Realisierung erst in mehreren Jahren oder – in manchen Fällen – überhaupt nicht zu rechnen war. Aber das war – wie schon geschildert – eine der ganz großen Verlockungen für die Arbeit in der Neuen Stadt.
Der eine Schwerpunkt des Aufbaukonzepts: Zentrale Aufgaben.
In dieser Zeit erschien uns der Vorteil der Großpfarrei so wichtig, weil damals die Ein-Mann-Pfarrei noch der Normalfall war. Inzwischen ist durch die Fusionen die Größenordnung von 20.000 Gemeindemitgliedern die Regel. Deshalb könnte jemand auf die Idee kommen, über Großraumseelsorge brauche man gar nicht mehr zu reden. Dann besteht aber die Gefahr, dass man nur noch im Rahmen der großen Strukturen denkt: Wenn man mit dem Slogan hausieren geht „die müssen zusammenwachsen“ – gemeint sind die Leute, die bisher in mehreren verschiedenen Pfarreien gelebt haben – , dann überträgt man unreflektiert die alten Bilder vom Leben einer Gemeinde auf den neuen großen Bereich und das hat schlimme Folgen. Wie sieht die Seelsorge in einer Großpfarrei also aus?
„Zentrale Aufgaben“ war für uns damals alles, was mit der Leitung der Gemeinde zu tun hatte, also das Team der Geistlichen, Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand. – Und wenn die Seelsorger mit den Gläubigen nach dem richtigen Weg in die Zukunft suchten, wurden dazu natürlich alle Mitglieder der Gemeinde eingeladen. Pfarrversammlungen fanden zwar nicht regelmäßig statt, waren aber ein wichtiges Element im Rahmen der Leitung. Sie brachten Ideen, Klärung und oft auch Korrektur für die Planung und das gemeinsame Leben. – Für ein
zukünftiges Gebäude in der Stadtmitte hatten wir auch die Vorstellung, dass sich alle Leiter der einzelnen Gruppierungen (Frauengemeinschaft, Senioren, Jugendliche usw.) dort treffen sollten, damit eine intensive Kommunikation möglich würde. – „Zentrale Aufgabe“ war auch die Arbeit mit den Katecheten der Kommunion- und Bußvorbereitung. Bei 212 Kommunionkindern (im Jahr 1972) war deren Zahl zwar auch beträchtlich, aber es war trotzdem die Regel, dass sie sich auf der Ebene der ganzen Stadt zusammenfanden. – Und es entstanden spezialisierte Angebote für bestimmte Gruppen in Hochdahl. Viel zitiert wurde der „Lehrerarbeitskreis“, den Gerd Verhoeven und der evangelische Pfarrer Michael Schwabe ökumenisch anboten und der sich über viele Jahre einmal im Monat traf. Sangesfreudige Jugendliche kamen aus ganz Hochdahl zusammen, sangen Spirituals und andere rhythmische Lieder und hatten später den Titel „Jugendchor und Band von St.Franziskus“. Sie sangen in den besonderen Gottesdiensten für Jugendliche. Für die Kindergottesdienste probte und sang der Kinderchor. Und immer gab es eine Gruppe von Leuten, die diese Gottesdienste vorbereiteten. Das alles waren Formen des Lebens der Gesamtgemeinde. Und das setzte sich fort bei Wanderungen der Familien nach den Kindermessen sowie bei Pfarrfesten und Karnevalsveranstaltungen.
Der andere Schwerpunkt des Aufbaukonzepts: Grundversorgung in den Stadtvierteln.
20.000 Menschen können miteinander keine Gemeinschaft haben. Das bedeutet heute: für die meisten Lebensvollzüge von Kirche ist nicht die Großpfarrei der Ort, sondern die überschaubare Gemeinschaft in der kleinen Gemeinde – das heißt in den alten Pfarreien. Gibt es dort eine Kirche, müssen sich die Menschen jeden Sonntag um dieselbe Zeit dort treffen – ob mit oder ohne Priester. Häufig wechselnde Zeiten oder kurzfristig ausfallende Gottesdienste wirken auf Dauer zerstörerisch. Hier gilt auch: es muss feste Bräuche geben. Jedenfalls waren wir damals der Meinung, dass der Ort für den Gottesdienst das Stadtviertel sei. Dabei gab es nie die Idee, etwa in jedem Stadtviertel eine kleine Kirche zu bauen. Selbst für die Gemeindehäuser war es ja schon abgesprochen, dass die evangelische und die katholische Gemeinde schachbrettartig nur in jedem zweiten Viertel bauen sollten, mit der Möglichkeit der Nutzung durch die jeweils andere Gemeinde. Wichtig war, dass der Sonntagsgottesdienst im „überschaubaren Bereich“ stattfinden konnte. Und das gelang. Im Endausbau hatten wir vier Gottesdienststätten, die ziemlich gleichmäßig über die ganze Stadt verteilt waren, sodass die meisten Mitglieder der Gemeinde eine der Kirchen zu Fuß erreichen konnten. – Junge Familien mit kleinen Kindern gestalten ihr Leben vorwiegend im Nahbereich der Wohnung. Deshalb sah die Stadtplanung für jedes Stadtviertel einen oder mehrere Kindergärten vor. Die katholische Gemeinde hatte im Endausbau drei Kindergärten – in Trills, Sandheide und Millrath-Ost. Sie lagen an allen drei Standorten direkt neben einem Gemeindehaus. In Trills und Sandheide stand auch eine Kirche in unmittelbarer Nähe. Das bedeutete, dass wir drei fast vollständig ausgebaute kirchliche „Subzentren“ hatten – in drei verschiedenen „Quartieren“. Vier – und später – fünf Grundschulen gab es in Hochdahl: Sandheide, Willbeck, Millrath, Trills und später Kempen. Das bedeutete, dass nicht in jedem Stadtviertel ein Schule war, aber die Kinder liefen selbstverständlich zu Fuß zu ihrer Schule und sie brauchten nicht „Mamas Taxi“ zu benutzen. Und für jede Schule gab es Schulgottesdienste. Zu Anfang wurde für kurze Zeit ein wenig improvisiert, indem z.B. die Willbecker Kinder mit dem Bus in die Trillser Kirche gebracht wurden. In der Zeit danach war in Trills viele Jahre lang jeden Dienstag Schulmesse, an der die katholischen Kinder der dritten und vierten Schuljahre teilnahmen. Diese Kombination der beiden Jahrgänge war beliebt, weil dabei die „Kleinen“ fast von selbst den „Großen“ abschauten, was man im Gottesdienst tut. Auch in Sandheide kamen die Kinder seit 1972 zur Schulmesse in die Kirche. Sonst fanden die Gottesdienste in den Schulen statt. Immer wieder konnten wir feststellen, wie wertvoll der enge Kontakt zwischen Schule und Familien war. Davon hat auch die Kirchengemeinde profitiert. In Willbeck zum Beispiel gab es mehrere Jahre hindurch nur für die Kinder des vierten Schuljahres einen Gottesdienst. Und weil diese Kinder schon zur Erstkommunion gegangen waren, war das eine Messe. Da taten sich einige Eltern zusammen und feierten – in der Schule – mit den dritten Schuljahren einen Wortgottesdienst, der gerade in der Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion sehr wichtig war. – Die Erstkommunionvorbereitung gehörte für uns natürlich auch ins Stadtviertel. Wir haben die Kinder – wie wohl allgemein üblich – im dritten Schuljahr zur Erstkommunion geführt. In diesem Alter leben die Kinder noch deutlich im Nahbereich, in der näheren Umgebung ihrer Wohnung. Sie treffen sich mit ihren Freunden in der Schule oder beim Spielen. Und mit denen waren sie dann meist auch in der Kommuniongruppe zusammen. Deshalb gehört die gesamte Erstkommunionvorbereitung ins Stadtviertel! Und das gilt doch wohl auch für die späteren, fusionierten Großräume. Wie sollen Kinder (und auch Erwachsene) eine Heimat finden, wenn sie für die Einführung in den Glauben aus ihrer normalen Umgebung herausgerissen und „zentralisiert“ werden? Und wenn man bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion auf diese Beheimatung verzichtet, verpasst man eine – vielleicht unwiederbringliche – Chance! – Als Ende 1968 die Ehekreise gegründet wurden, fand man sich auch im Rahmen des je eigenen Stadtviertels zusammen. So gab es einen Ehekreis „Sandheide-West“, einen Willbecker und einen Althochdahler Kreis usw. Und die Teilnehmer trafen sich nicht in irgendwelchen – zum Teil sowieso noch nicht vorhandenen – öffentlichen Räumen, sondern bei einem der Paare im Wohnzimmer oder im Hobbykeller. Auf diese Einbindung der gemeindlichen Gruppen in das normale familiäre Umfeld haben wir immer sehr viel Wert gelegt. Es darf eben nicht der Eindruck entstehen, man gehe in eine abgehobene, fast jenseitige Welt, wenn man sich in „kirchlichen“ Kreisen trifft. In den späten Jahren der Hochdahler Gemeinde war die Zuordnung zu den Stadtvierteln nicht mehr möglich, wenn ein neuer Ehekreis gegründet wurde. Neue Familien zogen dann ja nicht mehr in ein abgegrenztes Wohngebiet. Deshalb kamen die an einem solchen Kreis Interessierten aus der ganzen Stadt. – Auch die Gesprächsgruppen zu den Fernsehserien (z.B. „Warum Christen glauben“) fanden in den Stadtvierteln statt. Die Teilnehmer sahen sich gemeinsam die Sendung an, die einmal in der Woche ausgestrahlt wurde, und trugen im Vergleich dazu ihre eigenen Glaubenserfahrungen und Vorstellungen zusammen. Das Interesse in der Hochdahler Gemeinde an diesen Sendungen und dem Gespräch war groß. Das zeigte sich auch bei zwei weiteren Serien, die im Laufe der Zeit angeboten wurden. – Kinder, Erwachsene und auch die ältere Generation: Über viele Jahre gab es in Sandheide, Trills und Millrath-Ost Altenclubs, die einmal in der Woche zusammenkamen. Und da ältere Menschen oft nicht mehr so gut zu Fuß sind, musste der Treffpunkt natürlich in der Nähe der Wohnung liegen.
Das Aufbaukonzept und die Arbeitsverteilung für die Seelsorger.
Das Team de Seelsorger war gemeinsam für die Leitung der Gemeinde zuständig. Daneben gab es sowohl eine thematische wie eine räumliche Zuständigkeit der Einzelnen.
Wenn es spezialisierte Angebote für alle Gemeindemitglieder gab, war klar, dass sich einer
darum kümmern und das Angebot gestalten musste. Und dafür war er oder sie dann ganz und auf längere Zeit zuständig. Wir haben zwar in den Dienstbesprechungen oft und intensiv darüber gesprochen, was der Einzelne tat, aber verantwortlich war der Betreffende, der das Angebot übernommen hatte. Dabei konnten Neigung und Fähigkeiten der verschiedenen Personen zum Zuge kommen. Bei dieser Verteilung der Zuständigkeit ging es sowohl um Arbeitskreise (für Lehrer, Kindermesse, Jugendmesse, …), als auch um Gruppen in der Gemeinde (Frauengemeinschaft, Messdiener, Kinder- und Jugendchor, …) oder um Arbeitsbereiche (Verwaltung, Sozialarbeit, Kindergärten, Krankenbesuche, Mitarbeit in Ausschüssen der Stadt, …).
Genau so wichtig war die räumliche Zuständigkeit, vor allem bei der Sakramentenvorbereitung. Bei der Erstkommunion hatte jeder die Verantwortung für ein oder zwei Stadtviertel. Er musste von der Einladung an die Eltern, über die Anmeldung, Suche nach Katecheten, Gruppeneinteilung und Elternabende für alles sorgen. Diese Zuständigkeit blieb normalerweise für mehrere Jahre gleich, sodass der Seelsorger die Möglichkeit hatte, mit den Eltern und Kindern seines Bereichs vertraut zu werden. Eine solche Vertrautheit hielten wir sowohl für die Gemeinde als auch für den Geistlichen für unverzichtbar. Die Gemeinde braucht eine „Bezugsperson“ und der Seelsorger einen Ort, wo er „hingehört“. Wenn die Geistlichen „rotieren“, werden sie bald heimatlos.
18. Das Pfarrzentrum Heilig Geist wird eingeweiht.
Gut zwei Jahre nach der Grundsteinlegung im Dezember 1969 konnte im Februar 1972 das Pfarrzentrum Heilig Geist eingeweiht werden.
Die Kirche unterschied sich nicht wenig von dem, was man bisher als die Form von Kirchen kannte. Einige Leute hatten noch längere Zeit Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen.
Vor allem die Tragkonstruktion für das Dach – ein MERO-Gerüst auf acht tragenden Säulen – provozierte noch längere Zeit die Frage: „Wann kommt denn das Gerüst aus der Kirche?“ Für viele war diese Konstruktion nicht von einem Baugerüst zu unterscheiden. Mir fiel die Schönheit dieser Idee des Architekten Gottfried Böhm nach einiger Zeit auf. Es war an einem frühen Abend. Die untergehende Sonne schien von Westen her durch das Lichtband zwischen Betonmauer und Dach. Und mein Blick fiel durch dieses Fenster auf die Bäume neben der Kirche. Und innen das Geflecht der Tragelemente und draußen das Geflecht der Zweige … ! Man kann natürlich nicht sagen, dass sich die Zweige nach innen fortsetzten – aber ich hatte den Eindruck: es passte zueinander. Bei einer anderen Gelegenheit berührte mich diese „Konstruktion“ noch mehr. Ein besinnlicher Abend „zwischen den Jahren“ – zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Kirche war von vielen Kerzen erleuchtet – auf dem Boden, auf dem Altar, auf dem Taufbrunnen, vor dem Tabernakel. Und nach einiger Zeit ein langer Blick nach oben – in die Dunkelheit, in der sich das Gerüst leicht abhob! Und die Dunkelheit, der Raum war voller Geborgenheit und Geheimnis – nichts von Angst oder Bedrohung, die sonst so oft mit Dunkelheit verbunden sind.
Auch die „Biberschwänze“ waren oft Gesprächsgegenstand, aber durchweg mit einem interessierten bis staunenden Ton. Mit dieser uralten Sorte Dachziegeln hatte Professor Böhm nämlich ein schönes Muster für den Fußboden der Kirche gestalten lassen. Auch der Altar, der Tabernakel und der Taufbrunnen wurden damit aufgemauert. Wie sehr dieses „Design“ – wie man heute wohl sagen würde – Anklang fand, kann man daran erkennen, dass das Muster bis heute immer wieder als graphischer Hintergrund bei gedruckten Texten auftaucht. Es hat sich fast zu einem Erkennungszeichen für die katholische Franziskusgemeinde entwickelt.
Und wann kommt denn die Glocke in den Turm? Noch vor kurzem hat die evangelische Gemeinde nebenan sich einen kleinen Glockenturm mit einer kleinen Glocke geleistet – nach rund 40 Jahren. Gehört das denn nicht zu einer Kirche dazu? Und die stabile Betonkonstruktion von Heilig Geist hätte die Schwingungen sicher ohne Probleme verkraftet. Für mich war die Entscheidung gegen eine Glocke grundsätzlich und ich habe meine Meinung immer wieder massiv vertreten: „Keine Glocke für Heilig Geist“. Und warum nicht? Weil wir heute leben und nicht vor 200 Jahren. Damals wartete man bis es läutete, um dann in die Kirche zu gehen. Heute hat jeder eine Uhr. Und die Stimmung aus Kindertagen ist auch nicht mehr nachzuvollziehen: nachdem die Kinder am Samstag die Straße gekehrt hatten (auf dem Dorf), läuteten die Glocken den Sonntag ein. Eigentlich sollte es auch keinen Hahn auf dem Turm von Heilig Geist geben. Irgendwann erschienen aber die Leute aus unserer französischen Partnergemeinde mit ihrem Gastgeschenk und seitdem thront ihr Hahn in luftiger Höhe. Leider kann er sich nicht drehen, um wenigstens ab und zu einmal zu sehen, wo er herkommt.
Bei den ersten Gottesdiensten, bei denen wir in Heilig Geist mit dem Jugendchor gesungen haben, herrschte eine „tolle Stimmung“. Das war sicher auch eine Folge der neuen Lieder mit ihren mitreißenden Rhythmen. Dabei waren wir uns durchaus der Gefahr bewusst, dass die Begeisterung zu bloßer „Stimmung“ werden konnte. Oft ist innerhalb des Chores der Satz gefallen: „Passt auf, dass ihr nicht euphorisch werdet!“ Zu dieser guten Atmosphäre trug aber sicherlich auch der Raum bei, der Raum der neuen Kirche. Wir standen mit dem Chor an der Seite, zwischen Eingangstür und Tabernakel, und hatten die übrige Gemeinde vor uns – damals noch von der Seite und nicht von vorne. Und genauso hatten wir den Altar und den Ambo vor Augen. Was gesagt und gefeiert wurde, daran konnten wir unmittelbar teilnehmen. Umgekehrt konnten die anderen einstimmen in das, was wir taten. Jeder hatte seine Rolle im gemeinsamen Vollzug. Im Rückblick kann man sagen: das war genau das, was ein wesentliches Ziel der liturgischen Erneuerung des Konzils war. Allen Gläubigen sollte eine lebendige und aktive Teilnahme („actuosa participatio“) an der gemeinsamen Feier möglich werden. Übrigens war es eine weitere geniale Idee des Architekten, dass er die seitliche Empore so eng bemessen hat, dass ein normaler Kirchenchor darauf nicht genug Platz hat. Unten konnten die Chöre leichter zu wirklichen Teilnehmern an der Feier werden – wenn sie es denn wollten und nicht etwa einen „Auftritt“ hatten.
Das Bild der Gemeinde, das wir hatten, war ein Bild einer Gemeinschaft aller Getauften und Glaubenden, in der jeder seinen Platz und seine Rolle hatte. Und in der neuen Kirche fanden wir einen Raum, der diesem Bild genau entsprach. Es ist schon eigenartig: woher hatte der Architekt seine Vorstellung, wie „Kirche“ nach dem Konzil gestaltet werden sollte? Eine Frage, die noch drängender wird, wenn man feststellt, wie viele Theologen von den Chancen und Veränderungen offensichtlich nicht viel mitbekommen haben. Lag das verlockend Neue vielleicht wirklich „in der Luft“? Und was man aufnahm, war dann davon abhängig, wie man atmete? – Die neue Kirche dient einem Gottesdienst, den alle Teilnehmer gemeinsam vollziehen. Der zentrale Punkt ist die Altarinsel mit dem Ambo und dem Altar – mit dem Tisch des Wortes und des Mahles. Und ringsherum sind die Plätze für die Teilnehmer – auf der einen Seite etwas mehr Plätze, auf der anderen etwas weniger. Und jeder, der es wünscht, hat einen unverstellten Blick auf die Mitte. Und wer auf einem der Stühle Platz nimmt, spürt unmittelbar, dass er in eine größere Gemeinschaft aufgenommen ist. Wer am Ambo oder am Altar spricht oder handelt, erreicht ohne große Anstrengung auch den Teilnehmer, der auf dem letzten Platz auf der langen Bank an der hinteren Mauer sitzt. An diese angenehme Überschaubarkeit des Raumes kann man sich gewöhnen. Das stellte ich fest, als ich nach Beginn des Ruhestands in der großen Basilika in Gerresheim die Messe feierte. Ich habe es nicht oft getan. Der Raum war mir viel zu groß. Und da begann ich erst zu verstehen, wie wichtig eine kleinere Kirche sein kann. Vielleicht entspricht das ja auch mehr der Situation im Abendmahl oder der Praxis der jungen Kirche, die sich zum „Brotbrechen“ in den Häusern versammelte. (Apg. 2,46)
Es gibt in dieser Kirche keinen Prozessionsweg. Es gibt keinen „Mittelgang“, auf dem der Zelebrant in wallenden Gewändern und mit zahlreicher Begleitung zum Altar geht. Aufmärsche sind in dieser Kirche nicht möglich. Bei bestimmten Gelegenheiten sind wir zwar auch durch einen der Haupteingänge in die Kirche gezogen, zum Beispiel wenn der Bischof zur Firmung da war. Aber dann hieß es immer: „Wie gehen wir nach vorne, durch den ersten oder den zweiten Gang?“ Beide Gänge, die den rechten bzw. linken Block der Stühle von dem mittleren trennen, laufen schräg auf die Altarinsel zu. Wir hätten auch keinen „normalen“ Weg bekommen, wenn wir die Stühle umgruppiert hätten. Der Raum hätte sich dem widersetzt. Denn der Weg von einer Seite der Kirche zur anderen ist in jedem Fall länger als jeder Weg von hinten nach vorne. – Der fehlende Prozessionsweg war sicher auch der Grund, weshalb Trauungen normalerweise nicht in Heilig Geist stattfanden. Abgesehen davon, dass viele Leute nur die Trillser Kirche als „richtige Kirche“ ansahen, brauchen viele Paare den langen Weg von hinten zum Altar, damit die Braut – am Arm des Vaters – langsam schreitend ihrem Bräutigam entgegengehen kann. Dieser Vorgang ist sicher mit vielen tiefen Empfindungen und wohl auch manch mythischen Vorstellungen besetzt. Diese Möglichkeit gibt es in Heilig Geist nicht. Der Raum dient eben sehr konsequent der Erfahrung und dem Vollzug von Gemeinschaft.
Es gab in dieser Kirche keinen so genannten Priestersitz. Der Geistliche und die Messdiener saßen auf den gleichen Stühlen wie die Leute und zwar an der Seite und nicht auf erhöhtem Podium. Und wir waren bis zuletzt nicht in der Gefahr, die zunehmende Klerikalisierung von Kirche und Gottesdienst mitzumachen. Es kann doch niemand ernsthaft glauben, dass das Herausstreichen der Rolle des Priesters der Botschaft Jesu und dem Glauben der Menschen dient. Und wem dient die Ideologie, der Priester handle beim Gottesdienst „in persona Christi“ – dem Priester oder Jesus Christus? Nun ist Jesus Christus aber der Gastgeber und der einzig Bestimmende, der seine Gemeinde – mit ihren verschiedenen Rollen und Diensten – um sich versammelt. Es ist immer wieder dasselbe Elend, wie eine autoritär strukturierte Kirche die immer gleichen Probleme produziert.
Wer jetzt meint, sich wehren zu müssen, lese doch einmal im Evangelium nach: Mt 23, 8 – 12. Jesus hat vorher das großspurige Auftreten der Schriftgelehrten und Pharisäer kritisiert: „Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehn: Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang, bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben, und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi nennen.“ Es muss auffallen, wie Matthäus dann fortfährt. Jesus spricht zum Volk und seinen Jüngern: „Ihr aber …“ Der spät schreibende Matthäus hat offensichtlich Erfahrungen gemacht, dass seine Glaubensgenossen sich genau so verhalten wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und dagegen wehrt er sich, weil er sicher ist, dass Jesus das nicht gewollt hat. „Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.“ Diese Ermahnungen an die Jünger und damit auch an die Christen hat nur Matthäus, die beiden anderen Synoptiker nicht. Ich begreife nicht, wieso meine Kollegen diese Sätze anscheinend unbekümmert überhören. Und woher sie das Recht nehmen, die eigene Bedeutung so hoch aufzuhängen. Natürlich ist der Dienst des Geistlichen in der Gemeinde wichtig, aber als Dienst am Glauben der Menschen! (vgl. Nr.12, Suchen und fragen)
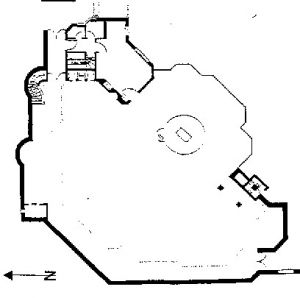
Die Heilig-Geist-Kirche öffnet sich hinter dem Altar mit einer breiten Fensterwand zum Hof hin. Dieser Übergang zwischen Innenraum und Hof ist gegliedert. Drei Flächen sind deutlich ein Stück nach vorne in den Hof hinein verschoben. Die mittlere ist mehrfach so breit wie die beiden rechts und links. Alle drei haben schräge Flanken, die zum Innenraum hin zurückgehen. Die beiden Achsen der kleinen Vorsprünge bilden im Innenraum der Kirche einen rechten Winkel und die breite Fläche ergibt zwischen ihnen eine schräge Verbindung. Wenn man sich diese Gestaltung vom Hof her genauer anschaut, dann wirkt sie sehr phantasievoll und gekonnt. Und wer möchte, kann auch den Eindruck haben, etwas wie eine Apsis erkennen zu können. Und wie an anderen Stellen in dieser Kirche wird man vorsichtig an etwas Altes erinnert und die neue Form ist keine billige Imitation! Die Fensterwand in Heilig Geist ist ein außergewöhnlicher Entwurf! Wenn man sie von innen bewusst und aufmerksam wahrnimmt, wirkt sie weit und offen. Und wenn man an einem hellen Tag von der Bank an der Rückseite der Kirche nach vorne schaut, dann kann man realisieren, wie sehr dieser Raum, samt Altarinsel mit Altar und Ambo, von dieser Idee des Architekten lebt… – Ich weiß nicht, ob es bei den vielen neuen Kirchen, die nach dem Krieg in Westdeutschland gebaut worden sind, eine irgendwie vergleichbare Gestaltung gibt. Bei den alten Kirchen wird man sowieso nichts Ähnliches finden. Das waren ja stets geschlossene – vielleicht auch bergende – Räume. Offen waren zeitweise nur die großen Portale, die die Menschen zum Eintreten aufforderten. Dass die Fensterwand mehrere Türen hat, scheint bei dieser Gestaltung einfach konsequent zu sein. Es drängt sich das Bild auf, wie nach dem Gottesdienst die Scharen der Gläubigen durch diese Türen auf den Hof strömen, vielleicht um ein fröhliches Pfarrfest zu feiern. – Anders als bei dem Gerüst, den Biberschwänzen oder der inneren Gliederung des Raumes habe ich mich mit dieser Fensterwand nie beschäftigt – und darüber sind mehr als 40 Jahre ins Land gegangen. Natürlich fand ich die Fenster gut, weil sie ja den Raum sehr hell machen. Aber statt sie richtig wahrzunehmen, habe ich mich nur an sie gewöhnt. Jetzt finde ich das sehr eigenartig. Ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwann mit irgendwem über diesen interessanten Entwurf des Architekten gesprochen zu haben. –
Diskussionen gab es stattdessen über die Vorhänge an der Fensterwand. Denn die konnte man öffnen und zuziehen. Ich hatte lieber, wenn sie beim Gottesdienst geschlossen waren, während andere für die Öffnung plädierten. Deswegen hat es immer wieder einmal Unstimmigkeiten gegeben. Wahrscheinlich war die unterschiedliche Einstellung vor allem eine Frage des Geschmacks oder eines natürlichen Gefühls für drinnen und draußen. Aber dann wurden die Debatten doch oft mit Theologie oder Ideologie aufgeladen. Hätten wir ein bisschen tiefer gebohrt, wäre das Problem wahrscheinlich zu lösen gewesen. Es geht ja um den Gottesdienst. Das, was dabei geschieht, ist einerseits die Feier der Glaubenden und Getauften, eine Feier der Gemeinde. Andererseits kann die Gemeinde die Eucharistie nicht wie einen Besitz für sich selbst beanspruchen. Was geschieht, ist immer auch ein Tun für die Anderen, für die Vielen, für alle Menschen. Was im Kelchwort des Abendmahlsberichts formuliert wird, ist der Maßstab, das Wort Jesu: „ Das ist … mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden“. Für euch und für alle! – Die Debatte um die Vorhänge könnte man dann so entscheiden: für die Gemeinde wäre es gut, die Vorhänge zu schließen, für den Blick auf alle Menschen sollten sie offen sein. Da es nur eine Feier ist, die beide Zielrichtungen enthält, müssten die Vorhänge sowohl offen als auch geschlossen sein. Diese Aussage ist unsinnig, wenn man „sowohl als auch“ mit „gleichzeitig“ verwechselt. Wenn man beide Zielrichtungen für verbindlich hält, darf man sich aber auch nicht für eine entscheiden und an dieser Auswahl hartnäckig festhalten. Stattdessen können die Vorhänge abwechselnd bei bestimmten Gelegenheiten offen und bei anderen geschlossen sein. Denn es ist ja zu vermuten, dass bei der Feier des Gottesdienstes manchmal die Geschlossenheit der Gemeinde wichtiger ist und manchmal der Blick auf die Welt und Umwelt im Vordergrund steht. Welche Gelegenheiten das sein können, wäre zu untersuchen. Im Gespräch in der Gemeinde könnten dabei ganz neue Gesichtspunkte erkennbar werden, sowohl über die Feier der Eucharistie und das Bild von Gemeinde, als auch über die vielfältigen Gemeinsamkeiten und Beziehungen mit den Menschen weltweit. – Übrigens kennt die liturgische Tradition solche Wechselvorgänge immer schon. Vom Passionssonntag (wie er früher hieß) bis Karfreitag ist das Kreuz verhüllt – die liturgischen Farben wechseln oft und sehr selbstverständlich – es gibt unterschiedliche liturgische Gewänder für unterschiedliche Gelegenheiten. – Die Fensterwand, die also gar keine Wand ist, bekommt noch einen zusätzlichen Akzent! Der Architekt hat die Eingänge in die Kirche recht eigenartig gestaltet. (In dem Grundriss erkennbar oben links und unter rechts). Auch das fällt den Besuchern wahrscheinlich gar nicht auf, weil man sich daran gewöhnt hat. Aber das sind ja nun wirklich nicht die offenen Tore der alten Kirchen. Eher wird man sie als enge Pforte bezeichnen müssen und vielleicht auch so empfinden. Enge Pforten? Sollen die vielleicht daran erinnern, dass der Zugang zur Gemeinde durch die Taufe geschieht, die nach Paulus ein Sterben und Auferstehen mit Christus ist? Mir scheint, dass der Kontrast zwischen den engen Eingängen und den Fenstern und Türen zum Hof hin die Gestaltung dieser „Fensterwand“ noch einmal sehr deutlich betont. Und die Fenster sind dann vielleicht auch nicht so sehr die Öffnung von innen nach außen, sondern mehr noch die Möglichkeit, dass das Licht und der Himmel und die Sonne von draußen den Raum erfüllen.
Es gibt in Heilig Geist keine Pfeifenorgel. Wir meinten es nicht verantworten zu können, in diesen Zeiten für ein solches Instrument eine Unsumme Geld auszugeben. Wir entschieden uns für eine elektronische Orgel, die ihren Platz in der Nische zwischen Eingangstür und Tabernakel fand. Für die Lautsprecher hatte Professor Böhm leicht erhöht eine kleine Empore vorgesehen, auf der die rot gestrichenen Eternitröhren an einen Orgelprospekt erinnerten. – Die Entscheidung gegen eine Pfeifenorgel bedeutete gleichzeitig den Verzicht auf die Pflege der großen Werke der klassischen Kirchenmusik. Das war zu der Zeit nicht beabsichtigt, aber eine unvermeidbare Folge. Für Orgelkonzerte und Messen der Wiener Klassik braucht man eben ein gutes bis sehr gutes Instrument. Nie aufgegeben hätten wir demgegenüber die Sorge um einen würdigen Vollzug der gemeinsamen gottesdienstlichen Feier. Der gemeinsame Gesang hatte dabei einen hohen Stellenwert. Dabei legten wir nie besonderen Wert auf einen Organisten mit hoher musikalischer Qualifikation. Der Dienst des Organisten war für uns eine der Aufgaben, durch die sich die Gemeinde lebendig und aktiv am Gottesdienst beteiligt. Er war Teilnehmer, nicht Künstler. Dementsprechend hatten wir über die ganzen Jahre auch immer wieder Gemeindemitglieder, die die Gemeinde im Gesang begleiteten ohne offizielle Ausbildung und Prüfung. Im Hintergrund steht hier die Frage, wie sich die Aufgabe der Kirche zur Pflege der Kultur verhält. – Die Freude an klassischer Musik war bei dieser Entscheidung nicht in Frage gestellt. Das lässt sich schon daran ablesen, dass das Sandheider Meisterkonzert seit fast vierzig Jahren Gastrecht in der Heilig-Geist-Kirche hat. Von einem Förderverein unterstützt sorgt Gabor Antalffy mit Ausdauer und Phantasie für regelmäßige Konzerte mit anspruchsvollem und interessantem Programm. Kultur in der Neuen Stadt!
Die Heilig-Geist-Kirche gewann für das Leben der Gemeinde schnell eine große Bedeutung. Und es gab Gottesdienste, die in der Erinnerung unlösbar mit dieser Kirche verbunden sind. Erwähnt wurden schon die besinnlichen Abende „Zwischen den Jahren“. – Seit 1977 hatten wir jedes Jahr in Hochdahl Firmung. Der Gottesdienst fand immer in Heilig Geist statt. Die Erinnerung an diese Firmgottesdienste gehört bis heute zum Intensivsten, was sich aus der langjährigen Tätigkeit eingeprägt hat. Das lag sicher auch daran, dass in der Vorbereitungszeit sich starke Beziehungen zwischen Jugendlichen, Begleitern und Geistlichen entwickeln konnten, die dann in der Firmung für alle sehr lebendig gegenwärtig waren. Vorbereitung und Gottesdienst waren Vollzüge gemeinsamen Lebens. – Im Ablauf des Kirchenjahres war nicht nur theoretisch Ostern das höchste Fest. Viele Jugendliche und Erwachsene erlebten auch über viele Jahre hin die Feier der Osternacht in Heilig Geist als einen solchen Höhepunkt. Und auch wenn sie schon lange von Hochdahl weggezogen waren, kamen manche jedes Jahr für diesen Gottesdienst wieder zurück.
Im Hof des Pfarrzentrums Heilig Geist haben wir viele schöne Pfarrfeste gefeiert. Die drei Platanen sind inzwischen zu beträchtlicher Größe herangewachsen und spenden – wenn nötig – Schatten für solche Versammlungen. Bei Regen war es schon etwas schwieriger, alle Teilnehmer unter den Arkaden am Kindergarten unterzubringen. Deshalb wurde immer wieder überlegt, ob es nicht möglich sei, mit einer großen Plane den ganzen Innenhof zu überspannen. Dazu ist es allerdings nie gekommen. – Kirche, Pfarrheim, Kindergarten, Küster- und Pfarrerwohnung gruppieren sich ringsherum. Ein öffentlicher Weg sorgt mit dafür, dass der Hof auch während der Woche nicht einsam und verlassen daliegt. Wenn der Kindergarten geöffnet ist, bringen Kinder und Eltern natürlich Leben auf den Platz.
Mit der Einweihung der Heilig-Geist-Kirche war schon im Jahre 1972 Planung und Aufbau der Räume für den Gottesdienst abgeschlossen. Wir hatten jetzt vier Orte, wo wir jeden Sonntag Gottesdienst feierten. Und die waren so günstig über die neue Stadt verteilt, dass jeder Besucher einen der Gottesdienste zu Fuß erreichen konnte. Im Westen der Stadt gab es in Alt-Hochdahl die evangelische Neanderkirche und in Trills die Franziskuskirche. Heilig Geist in Sandheide war sowohl für die Bewohner von Sandheide als auch für die Willbecker gut zu erreichen. Und die Millrather gingen ins Paul-Schneider-Haus. „Die Kirche“ war also mit ihrem Gottesdienst nahe bei den Menschen. Zwischenzeitlich tauchten zwar auch alte Bilder in der Diskussion auf, wenn einige Gemeindemitglieder überlegten, ob man denn nicht im Stadtzentrum einen „Dom“ bauen sollte. Das Stadtzentrum war zu diesem Zeitpunkt noch im Zustand der Planung. Ganz ernst genommen wurden solche Überlegungen allerdings nicht – wohl auch nicht von denen, die sie ins Gespräch brachten. Denn einerseits war die Zeit vorbei, in der eine Stadt sich um einen Dom gruppiert und die Mehrheit der Bevölkerung die Kirche als Mittelpunkt des Lebens ansieht. Andererseits war mit der Entscheidung für Heilig Geist festgelegt, dass die Gemeinde mehrere kleinere Zentren haben würde. – Insgesamt gab es für ganz Hochdahl sieben Messen am Wochenende, zwei Vorabendmessen (in der Neanderkirche und in Heilig Geist), zwei Messen in Trills, zwei in Heilig Geist und eine im Paul-Schneider-Haus. Die Orte und Zeiten der Sonntagsgottesdienste blieben dann bis 2008 konstant, nur in den Sommerferien fiel die späte Messe in Heilig Geist aus. Für uns war das eine Forderung von Treue und solider Arbeit.
19. Hans Meixner verlässt Hochdahl
Nach der Einweihung des Pfarrzentrums Heilig Geist machte Hans Meixner seine Ankündigung wahr und verließ Hochdahl. Er wurde Pfarrer in Köln-Rheinkassel. Das ist eine kleine Gemeinde im Norden Kölns. Viele haben diese Entscheidung von Hans Meixner bedauert und manche haben versucht, ihn umzustimmen, vergebens. Was ihn zu dieser Entscheidung gebracht hat, hat er nie ausdrücklich und offen erklärt. Deshalb haben dann manche überlegt, es könnte doch sein, dass die Anforderungen und Belastungen durch den Aufbau der neuen Gemeinde ihm zu viel geworden seien. Er war ja vermutlich bewusst in eine kleine Pfarrei gegangen, als er 1958 nach Hochdahl kam. Und auch das kleine Rheinkassel schien auf dieser Linie der Selbstbeschränkung zu liegen. Wenn ich mich allerdings erinnere, mit welcher Phantasie und Tatkraft er die ganze Zeit überlegt und diskutiert hat, welche kirchlichen Planungen und Einrichtungen für die neue Stadt richtig und notwendig seien, dann scheint mir diese Spekulation doch sehr fragwürdig zu sein. Denn wenn Überlastung der eigentliche Grund gewesen sein sollte, dann hätte er das sagen können. Eine solche Situation ist nicht ehrenrührig. – Wenn er so beharrlich zu seinen Gründen geschwiegen hat, dann scheint es viel wahrscheinlicher zu sein, dass etwas in den äußeren Umständen ihm so viele Probleme bereitet hat, dass er den Eindruck hatte, sein Weggang sei die beste Lösung für die Schwierigkeiten. Auch das ist allerdings Spekulation. Denkbar ist, dass ihm die unterschiedlichen Vorstellungen zum Gemeindeaufbau zugesetzt haben. Wir können ihn leider nicht mehr fragen, aber vielleicht würde er auch jetzt nichts dazu sagen. Sein Weggang war jedenfalls für die Gemeinde ein Verlust.
Wir waren uns einig gewesen, dass ein Team die Hochdahler Gemeinde leiten sollte (siehe Nr.6 Team). Was sollte nun mit den Resten des Teams geschehen? Wenn ich mich recht erinnere, kam keiner von uns auf den Gedanken, jetzt die Idee mit der Teamarbeit aufzugeben. Wir Restlichen hatten wohl diese Idee so stark verinnerlicht, dass wir einfach weitermachen wollten. Zunächst schien klar zu sein, dass es einen Nachfolger für Hans Meixner geben sollte. Die Personalabteilung in Köln empfahl uns, doch selbst nach jemandem zu suchen, der in unser Team passen würde und an dieser Aufgabe in Hochdahl Interesse hätte. Dabei hatten wohl alle Beteiligten die Vorstellung, dass dieser Mann dann auch die Rolle des bisherigen Pfarrers übernehmen sollte. Wir jungen Kapläne suchten also nach einem älteren Geistlichen für unser Team. Mit mehreren Interessenten kamen wir ins Gespräch und schließlich war Josef Metternich derjenige, der bei uns und in Hochdahl mitmachen wollte. Die Personalabteilung war einverstanden. Josef Metternich war bis dahin geistlicher Leiter der Frauenjugend im Bund der deutschen katholischen Jugend (BdkJ) und sein Name taucht bis heute bei allen auf, die das Lied singen „Unser Leben sei ein Fest“. Dieses Lied hat er getextet mit einer Arbeitsgruppe aus der Bundesleitung. Es folgten die üblichen Gespräche mit Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand. Die Zustimmung zur Zusammenarbeit mit ihm war allgemein. Er sollte im Herbst seinen Dienst beginnen. Und zuerst wurde schon mal das alte Pfarrhaus in Trills renoviert. Wir waren alle sehr irritiert, als die Personalabteilung uns kurz vor seinem Dienstantritt mitteilte, er werde nicht nach Hochdahl kommen. Die offizielle Begründung war der Priestermangel, der sich allerdings wirklich schon abzuzeichnen begann. Wie üblich wurde im Laufe der Zeit natürlich auch bei dieser Entscheidung phantasiert, welche anderen Gründe möglicherweise dahinter gesteckt haben könnten. Mag sein, dass es solche gab. Aber die Spekulationen brachten uns damals nicht weiter. – Wie sollte es jetzt weitergehen?
20. Team 2
Und so saßen wir denn im Wohnzimmer von Peter Nettekoven, der zu der Zeit Generalvikar in Köln war. Das war am 3.September 1972. Unser Team hatte sich erweitert. Im August 1971 war Willi Brähler zum Diakon geweiht worden. Da er schon vor Beginn seiner Ausbildung in Hochdahl wohnte, wurde er hier auch Diakon im Hauptberuf.
In dem Gespräch beim Generalvikar wollten wir überlegen und entscheiden, wie die Gemeindeleitung in Hochdahl in Zukunft aussehen und arbeiten sollte. Dabei war die Beratung „ergebnisoffen“ – wie man heute sagen würde. Peter Nettekoven war in der Lage, eine vertrauensvolle und positive Atmosphäre zu schaffen. Und wir waren sicher, dass er uns ernst nahm und gemeinsam mit uns nach einer wirklichen Lösung suchen würde. Es war klar, dass er bei seinen Überlegungen von dem Zustand ausging, der bislang in Hochdahl selbstverständlich gewesen war: die Zusammenarbeit als Team hatte die Position des „kanonischen Pfarrers“ nicht aufgehoben. Das hatte uns bei Hans Meixner keine Probleme bereitet und für die Gemeinde war er der „Herr Pastor“ und wir die beiden Kapläne. Die neuen Bedingungen bestanden darin, dass kein neuer Priester mehr kommen würde und demnach die Frage der Leitung zwischen uns „Übriggebliebenen“ ausgehandelt werden musste. Vermutlich lautete die erste Frage also schlicht: „Wer von Euch wird der neue Pfarrer von Hochdahl?“ Und diese Frage konnten oder wollten wir nicht beantworten. Inzwischen hatte sich nämlich eine neue Vorstellung in unseren Köpfen festgesetzt. Wie sie sich konkret entwickelt hat, ist unklar. Allerdings lag sie eigentlich nahe. Wenn die Leitung der Gemeinde von einem Team wahrgenommen wird, warum muss es dann innerhalb des Teams Abstufungen der Verantwortung oder der Position geben? Also schlugen wir vor, dass das Team gemeinsam die Leitung der Gemeinde übernehmen sollte, ohne Differenzierung in Pfarrer, Kaplan und Diakon. Peter Nettekoven hatte verständlicherweise mit diesem Vorschlag Schwierigkeiten. Dabei störte es ihn weniger, dass das Kirchenrecht diese Konstruktion nicht vorsieht. Er hatte eher die Sorge, dass wir auf Dauer die für diese Arbeitsform nötige Übereinstimmung nicht beibehalten könnten. Es war ja durchaus möglich, dass wir nach einiger Zeit in Streit geraten würden und dann keine Zusammenarbeit mehr möglich sein würde. Wir strotzten offensichtlich vor Optimismus, sodass der Generalvikar schließlich zustimmte. Er versicherte uns allerdings, er stehe „mit dem Verbandskasten bereit“, wenn wir doch in Schwierigkeiten geraten sollten.
„Die Hochdahler Gemeinde wird durch das Team geleitet.“ Das bedeutete, dass die Mitglieder des Teams grundsätzlich gleichberechtigt waren. Beide Kapläne bekamen den Titel „Pfarrer“. Nach außen, für die Leute, war nicht klar – und auch nicht feststellbar –, wer denn nun der „kanonische Pfarrer“ war. Das interessierte auch niemanden. Gleichzeitig haben wir die Titulatur abgeschafft und uns nur mit dem Namen anreden lassen – treu der Weisung Jesu, die Matthäus in seinem Evangelium formuliert hat (Mt 23, 8 ff). – Wenn es keinen „Pfarrer“ mehr gab, dann fiel eine beliebte Beschwerdeinstanz weg. In allen hierarchischen Systemen liegt es nahe, sich bei einem Konflikt mit einem Untergebenen an seinen Vorgesetzten zu wenden, um sich zu beschweren. Sind die Teammitglieder gleichberechtigt,
müssen die beiden Beteiligten das Problem miteinander klären. – Der Wegfall der Hierarchie bedeutet für die Gemeinde die Chance zu mehr Brüderlichkeit (Mt 23, 8c). Jedes Mitglied des Teams war für die Gemeindemitglieder in gleicher Weise ansprechbar. An wen man sich dann konkret wandte, das konnte vom Zufall abhängig sein; man sprach mit dem, den man gerade traf. Wenn es um ein Anliegen in einem bestimmten Bereich ging – zum Beispiel um Kindergottesdienst, um Fragen der Verwaltung, um Jugendchor, um Caritas usw. – dann trug man das dem dafür Zuständigen vor. Wie überall war es oft auch einfach eine Frage der Sympathie. Das ist natürlich, war aber auch nicht immer unproblematisch; schon früh ging das Gespenst mit dem Namen „Fanclub“ um.
Die gemeinsame Verantwortung des Teams wurde vor allem wirksam, wenn es um den gemeinsamen Weg der Gemeinde in die Zukunft ging. Wir waren ja 1972 noch mitten im Aufbau der katholischen Franziskusgemeinde in der neuen Stadt Hochdahl. Wie lebt eine christliche Gemeinde? Welche Strukturen braucht sie? Wie wächst sie im Glauben und in der Erkenntnis? Welche Gebäude und Räume sind nötig? Wie kann die Bauplanung und Realisierung aussehen? Wie ist die Beziehung zur evangelischen Gemeinde? Welche Kontakte haben wir zur Zivilgemeinde bzw. (ab 1975) zur Stadt Erkrath? Solche Fragen mussten sehr grundlegend und verantwortlich geklärt und entschieden werden. Und dafür war das gesamte Team verantwortlich. – Die einzelnen Arbeitsbereiche wurden demgegenüber auf die einzelnen Teammitglieder oder andere Mitarbeiter aufgeteilt. Dadurch entstand zunächst eine sachlich abgegrenzte Zuständigkeit. Gerd Verhoeven hat sich zum Beispiel über viele Jahre hin um die Verwaltung und die Arbeit mit dem Kirchenvorstand gekümmert. Viel Zeit und Phantasie widmete er einer lebendigen Liturgie, sowohl im Gemeindegottesdienst als auch für die Kindermessen. Willi Brähler sah seine Aufgabe als Diakon besonders in der caritativen Arbeit und in der Sorge um die Kranken. Für mich war die Arbeit mit dem Jugendchor und dem Jugendausschuss ein geschätztes Tätigkeitsfeld. Später kam noch Hildegard Smoch mit ins Team; sie war für die Sozialarbeit der Gemeinde zuständig. 1978 schließlich vervollständigte Bernd Schellenberger die Truppe; er übernahm die Verantwortung für die Jugendarbeit. Daneben trat eine von Zeit zu Zeit wechselnde räumliche Zuständigkeit. In der Vorbereitung auf Erstkommunion und Buße war jedes Teammitglied für ein oder zwei Stadtviertel verantwortlich. – Wer für eine bestimmte Aufgabe zuständig war, hatte auch die gesamte Verantwortung für seine Arbeit. Die übrigen Teammitglieder hatten nicht das Recht, in seine Arbeit hineinzureden oder in anderer Weise Einfluss zu nehmen. Eine solch strenge Abgrenzung der Zuständigkeiten ist unbedingt nötig. Wenn man sie in einem größeren Bereich (zum Beispiel in den heutigen Großpfarreien) nicht vornimmt, fühlen sich irgendwann alle für alles verantwortlich und die Arbeit vervielfältigt sich. Die Koordinierung der Arbeit wird schwieriger und für die Leute werden einfache Vorgänge – wie die Anmeldung einer Taufe – sehr kompliziert, weil dieser oder jener noch gefragt werden muss. – Die Einzelnen hatten im Team einen starken Rückhalt. Wenn jemand in der Dienstbesprechung den Wunsch hatte, von seiner Tätigkeit oder seinen Erfahrungen zu erzählen, dann hatte er dazu immer die Möglichkeit. Und oft haben wir dann unsere unterschiedlichen Ansichten und Meinungen ausgetauscht, haben miteinander beraten, wenn ein Problem oder ein Konflikt zur Debatte stand. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen musste am Ende aber dem Zuständigen überlassen bleiben. – Das Team übte also keine Aufsicht aus über die Arbeit des Einzelnen und der jeweils Verantwortliche brauchte vor dem Team keine Rechenschaft abzulegen. Es gab keine Anordnungen oder Verbote des Teams, an die sich der Einzelne hätte halten müssen. Selbst der Versuch, den anderen so lange zu bereden bis er schließlich klein beigab, war nicht gestattet. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich mehrmals bei einem solchen Versuch ertappte. – Wenn es möglich war, den gemeinsamen Geist bis in die einzelnen Arbeitsbereiche hinein zu erkennen, dann konnte das nur das Ergebnis von Vertrauen und gegenseitiger Offenheit sein. An der Stelle wird aber auch sichtbar, wie gefährdet dieser „gemeinsame Geist“ und damit das ganze System der Teamarbeit mit dieser hohen Verbindlichkeit war. Auf das hierarchische System, auf den bestimmenden „Durchgriff“ von oben nach unten, letztlich überhaupt auf Machtmittel zu verzichten, ist nur möglich, wenn der „gemeinsame Geist“ sehr stark ist. Jeder normale Mensch hält eine solche Lebens- und Arbeitsweise für unmöglich. Wahrscheinlich braucht man dazu den Heiligen Geist.
Wenn es um den gemeinsamen Weg der Gemeinde in die Zukunft ging, war also das Team als Ganzes verantwortlich. Das bedeutete, dass alle wesentlichen Entscheidungen mit einem Höchstmaß an Übereinstimmung getroffen werden mussten. Dabei ist die Ausgangssituation bekannt und überall die gleiche. Es gibt eine bestimmte Aufgabe und eine Anzahl von Menschen, die zur Bewältigung dieser Aufgabe sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Und dann beginnt die Diskussion. Wenn die Teilnehmer „jung, dynamisch und erfolgsorientiert“ sind, kann man gespannt sein, wer sich schließlich durchsetzt. Man kann sich auch als Beobachter verhalten und zusehen, wer ein gesteigertes Bedürfnis hat sich zu profilieren oder als der Überlegene zu erscheinen. Vielleicht ist es gut gemeint, wenn nach einer heftigen Diskussion alle nach einer Abstimmung verlangen. Und wenn eine Gruppe sich im Gespräch nicht „gefunden“ hat, gibt es möglicherweise keinen anderen Ausweg. Aber das ändert nichts daran, dass eine Abstimmung meist keine richtige Lösung garantiert, sondern nur die gerade vorhandenen Machtverhältnisse abbildet. Bei unseren Bemühungen im Team sind wir sicherlich auch oft in diese „normalen“ Abläufe geraten: einer versuchte den anderen zu übertrumpfen, wir waren rechthaberisch, uneinsichtig oder resigniert. Und nicht immer gelingt es, die eigenen Bedürfnisse und vor allem die Versuchung der Macht im Zaum zu halten. Eigentlich müsste es das Ziel sein, in einer konkreten Frage das sachlich Richtige zu finden. Dafür kann ein Team eine wertvolle Hilfe sein. Denn „vier oder acht Augen sehen mehr als zwei“ und ein lebendiger Gedankenaustausch kann davor bewahren, an einer einseitigen Sicht festzuhalten. Das setzt allerdings ein offenes und vertrauensvolles Gespräch voraus und eine Atmosphäre, in der jeder sich ernst genommen weiß. Dann kann man seine Ansicht vertreten ohne gewalttätig zu werden. Und es braucht nicht so weit zu kommen, dass man abstimmen muss. Die Eigenart einer solchen Zusammenarbeit ist geprägt von dem Vertrauen, dass die Wahrheit oder das Richtige in einer Situation grundsätzlich erkennbar ist und dass es sich immer lohnt, danach zu „suchen und zu fragen“.
Bei unserer Arbeit im Team ging es also darum, die Wahrheit suchend und fragend zu erkennen. Nicht, was wir selbst wollen, ist entscheidend, sondern das, was uns vorgegeben ist. Und das formuliert Paulus mit dem Satz: „Jesus ist der Herr“ (1 Kor 12). Diese Aussage prägt und verändert alles, was man über Leitung in der Kirche sagen kann. Wenn Jesus Christus der Herr ist, dann hat jeder, der in der Kirche Leitung wahrnimmt, als oberste Verpflichtung, nach der Meinung und der Weisung dieses Herrn zu fragen. Dann ist der Herr Pfarrer nicht mehr der „Herr“, sondern ein Suchender. Und der so genannte „Leitende Pfarrer“ muss dann mehr „suchen und fragen“ als die andern. Steht er allein, dann ist die Suche nach der Wahrheit nicht so leicht, weil die Bindung an die eigenen Prägungen und Vorstellungen so oft die Erkenntnis blockiert. Die Korrektur durch die Auseinandersetzung zwischen drei verschiedenen Leuten kann dann hilfreich sein. Und vielleicht ist unter denen auch noch einer, der den Weisungen des Herrn etwas näher steht und sie besser ins eigene und gemeinschaftliche Leben übersetzen kann. Wenn es um die Wahrheit und die Weisung Jesu Christi geht, dann ist die gemeinsame Suche der richtige Weg. Und dann ist Leitung im Team möglich und sogar erstrebenswert.
Es gibt sicherlich bis auf den heutigen Tag viele, für die dieser Weg ein Holzweg ist, aus grundsätzlichen oder praktischen Erwägungen. Eine gemeinsame Leitung durch mehrere Leute? Das kann doch nicht funktionieren. Juristen haben da ein Prinzip, das lautet: „Leitung ist unteilbar“. Im Volksmund lautet diese Formulierung etwas platter: Einer muss doch sagen, wo es lang geht. Die Möglichkeit, im Miteinander zu entdecken „wo es langgeht“, liegt für viele Menschen außerhalb ihrer Vorstellungen. Der juristische Spruch begegnete uns in den späten Jahren der Hochdahler Gemeinde in einem ganz anderen Zusammenhang. Die schwer erkrankte Leiterin eines Kindergartens sollte nach ihrer glücklichen Genesung zunächst mit einer verkürzten Arbeitszeit wieder einsteigen. Wie konnte das denn ermöglicht werden? Könnte sie sich denn mit ihrer bisherigen Vertreterin in die Leitung teilen? Aber Leitung ist doch unteilbar! Mit Rücksicht auf die gesundheitlichen Notwendigkeiten und mit der Mahnung zu genauer Absprache untereinander stimmten schließlich die Verantwortlichen der Relativierung juristischer Anforderungen zu. Es gibt offensichtlich Realitäten, die die juristische Perspektive sprengen.
Jeden Mittwoch saßen wir ab 10 Uhr für zweieinhalb Stunden zusammen. Wir hatten also genug Zeit, sowohl über Fragen aus den einzelnen Arbeitsbereichen als auch über die grundsätzliche theologische Ausrichtung der Seelsorge zu sprechen. Wieder und wieder haben wir zum Beispiel über die Gestalt und die Durchführung der Sakramentenvorbereitung gesprochen; und dann im Nachhinein über unsere Erfahrungen, und dann über notwendige Veränderungen für den nächsten Durchgang. Das weit verbreitete Argument: „Das haben wir doch immer so gemacht“, gab es bei uns nicht. Wichtig für die gemeinsame Linie im Team waren auch die so genannten Teamtage, die einmal im Monat in der Jugendbildungsstätte in Düsseldorf-Vennhausen stattfanden und bei denen oft auch der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates dabei war. Dabei war es immer wieder möglich, wichtige Fragen und Erfahrungen etwas grundsätzlicher zu klären. Allerdings ist es nicht immer gelungen, uns zusammenzuraufen. Heute können wir uns darüber amüsieren, wie bei einem der Teamtage die Wogen so hoch schlugen, dass einer der Beteiligten unter Protest die Versammlung verließ und den Übriggebliebenen zumutete, mit der Bahn statt mit dem Auto nach Hause zu fahren. – Wenn man als Team zusammenarbeitet, scheint das mehr Zeit zu fordern als ein Dienst nach Anweisung. Aber die gemeinsame Auseinandersetzung hält die Gruppe auch näher an der Realität und näher an der Botschaft.
War die Arbeit im Team ein Erfolg? In den vielen Jahren ist von Mitgliedern der Gemeinde immer wieder gesagt worden, dass sie die Unterschiedlichkeit der Beteiligten schätzten. Wie weit das auch eine Zustimmung zu der Zusammenarbeit als Team bedeutete, ist dabei nicht auszumachen. Vermutlich haben viele darüber nicht so genau nachgedacht. Selbst für uns, die Mitglieder des Teams, waren die Anforderungen und Möglichkeiten dieser Arbeitsweise am Anfang nicht klar. Hätten wir das genau analysiert formulieren sollen, hätten wir das wahrscheinlich nicht gekonnt. Erst heute, bei dem Versuch einer nachträglichen Betrachtung und Wertung, wird manches deutlicher. Allerdings waren wir von der Richtigkeit dieses Weges zutiefst überzeugt, auch wenn dann manches nicht gelungen ist.
21. Sonder-Einsatz zum Gemeindeaufbau.
Im Jahr 1972 begann ein Sondereinsatz von vier Patres aus dem Kloster der Oblaten in Gelsenkirchen. Der war noch von Hans Meixner in die Wege geleitet und wohl mit der Personalabteilung in Köln vereinbart worden. Hintergrund bei diesem Einsatz war die Erinnerung an die sogenannten „Volksmissionen“, die ja in den alten Pfarreien regelmäßig im Abstand von mehreren Jahren stattfanden. Für die Situation in Hochdahl konnte es natürlich nicht darum gehen, mit einem Predigtzyklus – möglicherweise sogar mit bedrohlichen Ansprachen – die Moral der Gläubigen anzuheben. Sinnvoll schien aber ein Einsatz zu sein, um die Arbeit in der Gemeinde an bestimmten Punkten anzuregen und in Gang zu setzen. In verschiedenen Phasen waren jeweils drei Patres in Hochdahl, wobei die Situation im Orden die Zusammensetzung der Gruppe bestimmte. Beteiligt bei dem Einsatz waren die Patres Grunwald, Knaack, Kneifel und Scheuermann. Sie mussten sich zunächst mit der Situation in Hochdahl vertraut machen und die verschiedenen Formen des Lebens in der Pfarrei kennenlernen. So übernahmen sie einige „normale“ Tätigkeiten in der Seelsorge, zum Beispiel Besuche, einige Stunden Religionsunterricht, Arbeit in den Gruppen oder in der Frauengemeinschaft. Sie feierten Gottesdienst mit der Gemeinde. Und im Sommer begleiteten sie Jugendliche bei den Ferienfreizeiten in Österreich. Mit Freude und Dankbarkeit erinnern sich auch manche Hochdahler an die Romreise, die von Pater Kneifel geleitet wurde. Den Fragen des weiteren Gemeindeaufbaus widmeten wir uns vor allem in den Dienstgesprächen und Teamtagen. Bis in die späten Jahre der Hochdahler Gemeinde gab es drei Dinge, die in dieser Zeit entstanden und auf ihre Mitwirkung oder Initiative zurückgingen: die Gestaltung der „neuen stadt“, die „Aspekte“ und der „Kontaktdienst“. Es ist zu vermuten, dass sie auch bei den Überlegungen und Planungen zur Kommunion- und Bußvorbereitung beteiligt waren, da wir die Umstellung 1973 vollzogen haben. Doch ist das nicht mehr feststellbar.
22. Gemeinde im Gespräch
Das Schweigen der Mehrheit
Für die ersten Jahre der wachsenden Franziskusgemeinde war der Satz „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“ wahrscheinlich ein gutes Motto. Es gab noch viel Aufbruchstimmung und zahlreiche Initiativen. Der Spruch machte klar, dass die Ideen der Gemeindemitglieder das Fundament für das Leben der Gemeinde sind. Und in der praktischen Ausführung, die dem Einzelnen die Realisierung seiner Ideen anvertraute, ermöglichte es das Wachsen von Vertrauen untereinander und von Zuversicht im Blick auf die Zukunft. Wie sieht aber die Situation aus, wenn sich die Gemeinde allmählich etabliert, wenn die sozialen Strukturen und die Beziehungen stabiler werden? Das kann man in vielen alten, gewachsenen Pfarreien beobachten. Dort ist es jedem auf Anhieb klar, welche Vereine und Gruppen zur Gemeinde gehören und wer in der Leitung der Gemeinde „das Sagen“ hat. Das gibt Sicherheit, aber es trägt auch dazu bei, dass sich sehr schwer etwas verändern lässt. Typisch ist dann das Jammern „Es sind immer dieselben, die die Arbeit tun“. Und dieser Satz ist ein Misstrauensvotum gegen die, die doch eigentlich dazugehören, aber sich nicht blicken lassen.
Umgekehrt jammern die andern darüber, dass sie sich in der Gemeinde nicht angenommen fühlen. Und die, die sich schweigend zurückziehen, sind in vielen Gemeinden die Mehrheit.
„Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.“ (1 Kor 12,7) Das kann sich nur vollziehen, wenn es untereinander einen lebendigen Austausch gibt.
Das „Schweigen der Mehrheit“ ist bei Paulus nicht vorgesehen. Und der Nutzen für die anderen besteht nicht in erster Linie im Bierschleppen fürs Pfarrfest, sondern im Erzählen der eigenen Lebenserfahrungen und im Austausch über den eigenen Glauben. Und zu dieser lebendigen Teilnahme ist jeder Glaubende berufen und befähigt. Und wenn sich jeder immer wieder neu für die Gaben des Geistes öffnet und die entsprechenden Erfahrungen ins Gespräch bringt, dann wird eine Gemeinde lebendig. In diesem Hören und Sprechen kommt eine Gemeinde zu sich selbst.
Ein unmögliches Ziel! Aber es ist vermutlich wie bei allen menschlichen Zielen, Idealen oder Wertvorstellungen. Man steht immer zwischen dem Ziel und dem eigenen Ungenügen oder den Nöten des praktischen Lebens. Aber wenn man das Ziel aus den Augen verliert, versinkt man im Sumpf oder im Vegetieren. Wenn man das Ziel für machbar hält, überfordert man sich. Unterwegs bleiben! Wenn man auf die Nase fällt, wieder aufstehen und die Hoffnung nicht aufgeben, dass es wächst und irgendwann mal sich vollendet.
So eine lebendige Gemeinde kann man nicht planen oder organisieren. Denn sie wird nur möglich durch die Bereitschaft jedes Gemeindemitglieds. Gespräch und lebendiger Austausch entstehen nur in dem Maß, wie jeder einzelne das will. Das einzige, was man anbieten kann, sind günstige Gelegenheiten, verlockende Chancen, Räume und Zeiten, damit Menschen sich finden können. Ob die Möglichkeiten wahrgenommen werden, ist eine Sache der Freiheit. Und die Freiheit des Einzelnen kann man nicht manipulieren und man darf auch nicht den Versuch dazu machen. Einige Hilfen für den Austausch in der Gemeinde haben wir 1972 unter Mithilfe der Oblatenpatres zu realisieren versucht.
Die „neue stadt“
Die „neue stadt“ war schon seit mehreren Jahren das Mitteilungsblatt der Gemeinde, im Format DIN A 4, beidseitig bedruckt. Dieser „Druck“ war – wie erwähnt – nicht sehr ansehnlich, dafür aber in der Herstellung aufwendig und obendrein nichts für schmutzempfindliche Mitarbeiter. Die Wachsmatrizen markierten eben noch eine Zeit unterentwickelter Bürotechnik.
Die „neue stadt“ sollte, wie wohl schon vorher, alle 2 Wochen erscheinen. Sie wurde weiterhin an den Kirchtüren zum Mitnehmen ausgelegt. Ich erinnere mich, dass wir bei den Überlegungen zur Neugestaltung intensiv darüber diskutiert haben, ob wir die Gottesdienstordnung samt Messintentionen jedes Mal abdrucken sollten. Das hätte bedeutet, dass wir die erste Seite immer damit gefüllt hätten. Wir haben uns dagegen entschieden. Die Gottesdienstordnung war ja bei uns zu dieser Zeit noch sehr stabil. Über Gottesdienste, die kurzfristig ausfallen sollten, brauchten wir nicht zu informieren. Und die Messsintentionen waren als Information für die Gesamtgemeinde nicht so wichtig. Wir gingen davon aus, dass in der Familie oder im Bekanntenkreis schon weitergegeben würde, wenn für einen Verstorbenen eine Messe bestellt worden war. So wurde die Gottesdienstordnung unabhängig von der „neuen stadt“ für jede Woche gedruckt und in den Schaukästen ausgehängt. In der „neuen stadt“ erschien sie nicht mehr. Auf die wichtigen Feste wurde natürlich ausdrücklich hingewiesen, sowohl in der Gottesdienstordnung als auch – bei den Hochfesten – durch besondere Artikel und Informationen.
Aus dem bisher Erzählten dürfte deutlich geworden sein, dass sich in dieser Zeit sehr viel ereignet hat. Vieles davon spielte sich im Bereich der Leitung der Gemeinde ab. Das bedeutete, dass vor allem die Mitglieder des Teams, sowie der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat einen beträchtlichen „Informationsvorsprung“ hatten. Die „neue stadt“ war jetzt ein wertvolles Mittel, um diese Informationen allen Gemeindemitgliedern zugänglich zu machen. Und da wir jedes Mal zwei ganze Seiten zur Verfügung hatten, brauchten wir uns auch nicht mit den Endergebnissen von Verhandlungen und Gesprächen zu begnügen. Wir konnten vielmehr die Leser auch daran teilnehmen lassen, wie sich eine bestimmte Entscheidung entwickelt hatte und warum sie schließlich so und nicht anders getroffen worden war. Eine gute und fundierte Information ermöglicht dann auch das Gespräch untereinander. Dafür muss man Sorge tragen, wenn einem eine lebendige Gemeinde am Herzen liegt. Wer Information – aus welchem Grund auch immer – für sich behält, riskiert den Vorwurf, „Herrschaftswissen“ anzusammeln.
Grundsätzlich hatte jeder in der Gemeinde die Möglichkeit, selbst einen Artikel in die „neue stadt“ zu setzen. Das war natürlich zunächst ein etwas ungewohntes Angebot, wurde aber im Laufe der Zeit zu einer absolut unauffälligen Gewohnheit. Dabei ging es weniger um Stellungnahmen in einer Diskussion, sondern um Informationen, was Einzelne oder Gruppen planten und was sie sich dabei gedacht hatten. Da stand dann also nicht nur: Gruppe XY trifft sich am Donnerstag um 20 Uhr im Pfarrheim, sondern wir (Gruppe XY) wollen uns wegen des geplanten Musicals mit Franz von Assisi beschäftigen. Hat einer Lust mitzumachen? Treffen: Donnerstag usw. So gab eine Gruppe anderen Gemeindemitgliedern die Möglichkeit, an ihren Gedanken und Überlegungen teilzunehmen. Wenn eine Gemeinde miteinander im Gespräch sein soll, dann müssen Erfahrungen, Pläne, Überlegungen, Aktivitäten einander zur Teilnahme angeboten werden. Dazu ist ein Medium wie die „neue stadt“ ein gutes Hilfsmittel. Sie kann das Gespräch nicht ersetzen, aber sie kann es stützen oder sogar anregen. Und dann stehen die Leute nach dem Gottesdienst vor der Kirche und sagen: Da steht in der „neuen stadt“ … Was hältst Du davon? Hast Du nicht Lust mitzumachen?
Die Aspekte
Die Aspekte waren neu. Die erste Nummer erschien im Dezember 1972. Das Format war DIN A 5, gedruckt wurde nach einer Vorlage, die mit der Schreibmaschine geschrieben war. Auf der Vorder- und Rückseite gab es ein Foto, immer aus der neuen Stadt. Traditionsbewusst wie wir waren, war auf dem ersten Heft die Trillser Kirche abgebildet mit einigen Hochhäusern im Hintergrund. Im Innern wurde die Abfolge der einzelnen Artikel aufgelockert durch liebevoll ausgeführte Zeichnungen von Werner Wiese. Der Titel der Schrift bekam noch den Zusatz: Informationen und Meinungen aus der Katholischen Kirchengemeinde Hochdahl. Es war geplant, dass die Hefte in loser Folge viermal im Jahr erscheinen sollten.
Der Titel der Zeitschrift war Programm. Das wurde auf der ersten Seite des ersten Heftes deutlich formuliert:
Aspekte bringen Informationen und Meinungen aus der Kath. Kirchengemeinde Hochdahl
Aspekte, die einem auffallen, wenn man das Leben dieser Gemeinde betrachtet.
, die nicht sensationell sind, die man unter Umständen leicht übersehen kann.
, die man meist nicht in Zahlen ausdrücken kann (was sagt schon der statistische Aspekt, dass diese Gemeinde etwa 8.000 Mitglieder hat?).
, die man manchmal nur richtig versteht, wenn man sie miterlebt.
, die oft Zeichen der Hoffnung sind, und die erkennen lassen, dass es auch für diese Gemeinde einen Weg in die Zukunft gibt.
Solche Aspekte können sein:
die Freude, die einer dem anderen macht,
die Not, die jemand lindert,
die Unsicherheit, die man gemeinsam durchsteht,
die Erfahrungen, die man miteinander macht,
das Leben, das man zusammen lebt.
Es ist also keine nachträgliche Interpretation, sondern von Anfang an beabsichtigt gewesen, dass die Aspekte eine Möglichkeit für den lebendigen Austausch in der Gemeinde sein sollten. Und dazu gehören die Informationen, die möglichst allen Gemeindemitgliedern in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Und dazu gehören die verschiedenen Meinungen, in denen die Einzelnen ihre persönlichen Erkenntnisse zusammentragen.
In den vielen Jahren, in denen die Aspekte erschienen sind, ist der Titel der Hefte immer gleich geblieben. Selten ist es gelungen, vier Hefte pro Jahr herauszubringen. Die Redaktion hat sich in den ersten Jahren schwer getan mit dem Heft und auch mit der Verwirklichung des selbst gewählten Auftrags. Die Mithilfe eines Fachmanns im Bereich der Druckmedien brachte uns 1975 neue Energie und dem Heft ein neues Format; von jetzt ab waren die Aspekte fast quadratisch und das blieben sie für die nächsten Jahrzehnte.
Im Nachhinein taucht die Frage auf, ob wir die Chancen einer solchen Schrift nicht besser hätten nutzen können. Die Gespräche in der Redaktion waren immer sehr intensiv und anregend. Da vollzog sich sicher auch etwas von „lebendiger Gemeinde“. Aber bei der Themenfindung und Realisierung der Artikel war es oft sehr mühsam. Das Echo aus der Gemeinde war nie sehr intensiv; Leserbriefe gab es eher selten. Trotzdem waren die Aspekte angenommen. Oft konnte man die Frage hören: „Wann kommen denn die nächsten Aspekte?“ Es ist allerdings zu vermuten, dass die Aufgabe, die im ersten Heft so deutlich formuliert war, im Laufe der Zeit nicht mehr so lebendig vor Augen stand. Für den Austausch innerhalb der Gemeinde hätten wir vermutlich noch mehr tun können.
Der Kontaktdienst
Auch der Kontaktdienst war eine neue Einrichtung des Jahres 1972. Er sollte sich deutlich von dem Besuchsdienst der ersten Jahre unterscheiden, der ja den Sinn hatte, die Neuzugezogenen zu begrüßen und ihnen einige Informationen und Hilfen für das Einleben in Hochdahl zu geben. Demgegenüber war der Kontaktdienst der Versuch, das Gespräch in der Gemeinde und den Austausch zwischen den Gemeindemitgliedern zu unterstützen. Dazu war eine dauerhafte Aktivität nötig und ein System für die ganze Gemeinde. Wir teilten also ganz Hochdahl nach Straßen in viele kleine Bereiche ein. Diese sollten im Normalfall nicht mehr als etwa 20 Haushalte umfassen. Dafür sollte dann ein Gemeindemitglied zuständig sein, das auch in diesem Bereich selber wohnen sollte. Die Aufgabe war gewaltig. Wenn die katholische Gemeinde zu der Zeit schon etwa 8.000 Mitglieder hatte, dann waren bis zu 200 Menschen nötig, um dieses Projekt durchzuführen. In der Realität werden es deutlich weniger gewesen sein, aber die Patres haben sich mit Mut und Gottvertrauen daran gemacht, die Leute zu finden und sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Mit Begeisterung erzählten sie zum Beispiel in den Ehekreisen, wie dieses Projekt aussehen und was es für die Gemeinde bedeuten sollte. Und die Aufgabe war schwierig. Denn zunächst ging es nicht um eine klar umrissene Tätigkeit. Vielmehr sollte ja das Gespräch in der Gemeinde und der Austausch gefördert werden. Aber wie macht man das? Die Leute des Kontaktdienstes sollten im Auftrag der Gemeinde Besuche machen; das war noch eine einfache Aufgabe. Dann sollten sie selbst das Gespräch mit den Menschen in ihrer Umgebung suchen. Sie mussten die Augen offen halten für Schwierigkeiten und Notlagen und sollten Hilfen anbieten, wenn es erwünscht war. Es ist leicht zu erkennen, dass das eine große Offenheit verlangte und gleichzeitig eine sehr ausgeprägte Diskretion. Denn nichts ist schlimmer als wenn jemand sich bei dieser Tätigkeit anderen aufdrängt. Die Freiheit aller Beteiligten ist oberstes Gebot.
Die Aspekte und der Kontaktdienst wurden etwa zur gleichen Zeit – Ende 1972 – realisiert. Damit war eine große Erleichterung für die Arbeit des Kontaktdienstes möglich: die Verteilung der Aspekte wurde die praktische Aufgabe, an der sich die geplante Unterstützung von Gespräch und Austausch vollziehen konnte. Dazu war nötig, das Heft nicht in den Briefkasten zu werfen, sondern es bei einem Besuch persönlich zu übergeben. Das ist in der ersten Zeit wohl auch weitgehend gelungen, natürlich von Anfang an abhängig davon, ob die Empfänger einen Besuch wünschten. In manchen Fällen sind daraus jahrelange Kontakte und Beziehungen entstanden. Kam es am Anfang nicht zu einer solchen persönlichen Begegnung, dann wussten die Besuchten doch zumindest für die Zukunft, an wen sie sich in kirchlichen Fragen wenden konnten. Deshalb war es gut, dass der Name des Besuchers auf der Rückseite der Aspekte erschien. Im Laufe der Jahre wird in den meisten Fällen das Heft nur noch im Briefkasten gelandet sein. Leider haben wir den Plan nicht ausgeführt, auf das Titelblatt einer Nummer groß die Aufforderung zu drucken, man möge sich melden, wenn man die Aspekte nicht bekommen wolle. Das wäre ein deutliches Zeichen gewesen, dass wir die Freiheit der Adressaten achten und sie nicht falsch missionieren wollten.
An diesem konkreten Verhalten lässt sich ablesen, wie die Beziehung zu den „Fernstehenden“ aussehen sollte. Über das Thema haben wir im Pfarrgemeinderat öfter diskutiert. Allein der Begriff müsste doch eigentlich schon Unbehagen hervorrufen. Erweckt er doch den Eindruck, dass man sich bei einem solchen Gespräch als der Bessere, der Überlegene vorkommt. Und dann hätte man die Aufgabe, die anderen zu seinem eigenen Verhalten zu bekehren. Müssten die Mitarbeiter des Kontaktdienstes dann nicht viel reden, die Leistungen der Kirche im sozialen Bereich erläutern, die Vorteile religiöser Gruppen beschwören, die Bedeutung einer religiösen Erziehung der Kinder nahe bringen usw. usw.? Aber genau das sollten die Besucher nicht tun. Sie sollten da sein, Nöte wahrnehmen, Information anbieten, Nähe und Gespräch ermöglichen – und vor allem die Freiheit des andern achten. Denn wenn nicht die andere Art zu leben und aufzutreten wirkt, ist alles Werben von Anhängern Manipulation. – Und wenn zurzeit die „Neuevangelisierung Europas“ propagiert wird, dann muss man sich doch fragen, wie eine Kirche das machen will, die die eigene Bekehrung zum Evangelium auf weite Strecken nicht mehr schafft.
Während ihrer Tätigkeit haben sich die Mitglieder des Kontaktdienstes immer wieder in Gruppen auf der Ebene der Stadtviertel getroffen. Sie haben ihre Erfahrungen ausgetauscht und später auch über den Inhalt der Aspekte, die verteilt werden sollten, gesprochen. Damit sollten sie die Möglichkeit bekommen, auch sachlich mit den Besuchten ins Gespräch zu kommen. Für diese Treffen war ein „Hauptverteiler“ in jedem Stadtviertel verantwortlich, der auch die Hefte für seine Gruppe besorgte.
Der Kontaktdienst war für die Gemeinde ein relativ stabiles Gebilde. Solange die Redaktion der Aspekte ihre Arbeit gut machte und die „Hauptverteiler“ sich intensiv kümmerten, brauchte die Leitung der Gemeinde nicht viel Energie zu investieren. Die Beteiligten waren sehr selbständig und unabhängig. Das war schon ein früher Beitrag für die Situation des wachsenden Priestermangels. Eine Gemeinde lebt aus eigener Kraft und nicht am Tropf des Klerus. Dabei entwickelte sich natürlicherweise auch eine Erkenntnis der eigenen Möglichkeiten und ein Bewusstsein für die Verantwortung, die man als Gemeindemitglied hat. Das machte – wie überall bei solchen Aktivitäten – eine geistliche Begleitung und Anregung nicht überflüssig, sondern verstärkte sogar das Bedürfnis danach. Bald begann dann auch die Zeit, in der „Rinsecke“ (ein kleiner Ort im Sauerland in der Nähe von Oberhundem) zum Synonym wurde für intensive Begegnung und fundierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben.
Die Arbeit des Kontaktdienstes lief gut an. Allerdings gab es im Laufe der Jahre starke Verschleißerscheinungen. Immer öfter war von „Weißen Kreisen“ die Rede. Das bedeutete, dass für bestimmte Bereiche kein Mitarbeiter mehr da war. In vielen Fällen war ein Umzug die Ursache. Und einen Nachfolger zu finden, erwies sich immer öfter als unmöglich. Vielleicht wurde die Gemeinde zu etabliert. Vielleicht hätten wir uns auch intensiver darum kümmern müssen.
23. Gottesdienst 2
Für die katholische Gemeinde in der neuen Stadt Hochdahl war Fronleichnam einer der Höhepunkte im Kirchenjahr. Ich bin Ende April 1970 nach Hochdahl gekommen und ich erinnere mich, dass ich noch eine ganz „normale“ Form der Feier des Fronleichnamsfestes erlebt habe mit feierlichem Gottesdienst in der Trillser Kirche, mit Prozession und mindestens zwei Altären unterwegs, mit geschmückten Wegen und Häusern. (Es gab sogar noch eine „Bittprozession“ vor Christi Himmelfahrt, die ich zusammen mit Pfarrer Hans Meixner begleitete.)
Diese traditionelle Art, Fronleichnam zu feiern, haben wir nicht mehr lange praktiziert. Schon 1973 trat an die Stelle der Prozession die gemeinsame Feier der Eucharistie auf dem Schulhof der neuen Hauptschule an der Sedentaler Straße. Und so wird seitdem in Hochdahl Fronleichnam gefeiert. Um 10 Uhr ist der Gottesdienst für die ganze Stadt. – Es war eine bewusste Entscheidung, die wir wahrscheinlich schon früher getroffen haben, an diesem Tag keine Prozession mehr zu machen. Und es war eine eminent theologische Entscheidung! Im Gefolge des Konzils hätten eigentlich alle begreifen können, dass der primäre Vollzug der Eucharistie die Feier der Heiligen Messe ist. Dadurch traten die im Laufe der Geschichte wichtig gewordenen Formen der Anbetungsfrömmigkeit in den Hintergrund, nämlich Andacht vor dem ausgesetzten Allerheiligsten, sakramentaler Segen, und eben auch die Prozession mit dem Allerheiligsten. Dabei mag man den Sinn dieser Prozession durchaus positiv sehen: durch die Eucharistie soll der ganzen Stadt oder dem ganzen Dorf die Nähe Jesu Christi erfahrbar gemacht und sein Segen allen Bewohnern zugesprochen werden. Und das Schmücken der Wege und Häuser war dann die gläubige Antwort auf diese Zuwendung Gottes. – Wenn wir auf die Prozession verzichtet und stattdessen eine gemeinsame Eucharistiefeier auf dem Schulhof eingeführt haben, dann war das eine gute Übersetzung der alten Absicht in eine neue Form. Der Ort für die Feier war ziemlich zentral in der neuen Stadt Hochdahl und es machte wenig Mühe, ganz Hochdahl – Katholiken und Protestanten und die übrigen Bürger – an dieser Stelle gegenwärtig zu spüren. Und immer wieder wurde davon gesprochen, wie schön es war, wenn die Leute von allen Seiten, aus allen Wohnungen zu diesem Zentrum hin pilgerten. (Natürlich kamen auch viele mit dem Auto, was vielleicht für das Moderne an diesem Bild steht). Und der Schulhof ermöglichte ein Gefühl von Gemeinschaft und stützte das gemeinsame Beten und Singen. Und als in späteren Jahren Bäume und Sträucher dichter und höher wurden, wirkten sie wie eine bergende Kulisse, die aber die luftige Offenheit nicht einschränkte. Ganz zu Anfang haben wir nach Abschluss der Messe noch den sakramentalen Segen gegeben. Aber das schien uns bald eine inkonsequente Verdoppelung zu sein. Wer die Eucharistie mitvollzieht, empfängt dabei schon allen Segen, der möglich ist. – Und es gab noch einen praktischen Vorteil auf dem Schulhof: wenn es Regen gab, wichen wir in die Aula der Schule aus. Das haben wir in vielen Jahren tun müssen.
Aus der Perspektive der späten Jahre ist es eigenartig, dass rundherum alle Pfarreien die alte Fronleichnamsprozession beibehalten haben. Spielt es keine Rolle, dass sich die Voraussetzungen für dieses Tun radikal verändert haben? Das Dorf, das die Nähe und den Segen Jesu Christi erfahren möchte und in Dankbarkeit oder Vorfreude Häuser und Wege schmückt, gibt es in vielen Gegenden nicht mehr. Und die Stadt beherbergt in der Mehrheit praktische Atheisten. Und was erleben die, wenn sie am Straßenrand stehen und die Prozession an ihnen vorbeizieht? Sollen sie durch das, was sie sehen, zum Glauben finden? Geht es den Teilnehmern um ihre Gemeinschaft mit Jesus Christus und ist das für die Zuschauer in irgendeiner Weise zu erkennen? Denn wenn Fronleichnamsprozessionen zu einem Touristentreffen verkommen, bei dem die Menschen am Rande nicht mehr innehalten und beten, sondern nur noch fotografieren, dann setzen wir Jesus Christus von neuem einer Menge aus, die sein Sterben nicht ernst nimmt. Und können wir wirklich sicher sein, dass das zugehörige feierliche Hochamt (auf einem öffentlichen Platz der Stadt) nicht von vielen Christen als Demonstration verstanden wird, dass wir in der Gesellschaft noch wichtig sind? – All die Jahre war Fronleichnam in Hochdahl ein wichtiges Fest. Noch heute meine ich etwas von der Atmosphäre zu spüren. Und manchmal erweckt ein solcher Tag den Geist und verhilft zu etwas tiefer gehenden Gedanken zu Vergangenheit und Zukunft. Vielleicht hat die eine oder andere „Grundsatzpredigt“ an diesem Tag anregend wirken können.
24. Gemeindekatechese 1
Erstkommunion
Es war anscheinend auch ein Wandel, der in der Luft lag: im Jahre 1973 haben wir die Erstkommunionvorbereitung auf kleine Gruppen umgestellt. Diese Veränderung war keine Folge unserer speziellen Situation in der neuen Stadt Hochdahl, sondern sie wurde fast zur gleichen Zeit in sehr vielen Gemeinden der westdeutschen Diözesen vollzogen. Offensichtlich hatte sich auf breiter Front die Einsicht durchgesetzt, dass die alte Form der Vorbereitung doch beträchtliche Schwächen hatte.
In den ersten Jahren in der neuen Stadt haben wir die alte Praxis noch beibehalten. Der Pfarrer und die Kapläne gaben den „Kommunionunterricht“, in den Räumen der Grundschulen, mit Gruppen von 30 bis 40 Kindern, mit klar definierten Lerninhalten und abfragbaren Ergebnissen. Ich selbst habe so noch die Kinder von Willbeck in der Grundschule unterrichtet, als ich 1970 nach Hochdahl kam. Diese Praxis hatte eindeutige Nachteile. Die jeweilige Gruppe war zu groß, um eine Gemeinschaft mit intakten Beziehungen werden zu können. Die Vorbereitung war auf den Pfarrer zentriert. Und die Rolle der Eltern bei der Weitergabe des Glaubens drohte sich zu verflüchtigen. Im bisherigen Rahmen hatten die Eltern den Glauben der Kinder in der Familie grundgelegt und der Pfarrer wurde dann beim Beicht- und Kommunionunterricht tätig. Das war eine passable Arbeitsteilung zwischen Eltern und Pfarrer. Aber mit der Auflösung des katholischen Milieus waren offensichtlich immer weniger Eltern fähig oder bereit, ihren Kindern den Glauben in der Familie zu vermitteln.
Deswegen haben wir uns für die Umstellung entschieden. Die normalen Gemeindemitglieder haben den Auftrag, die Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion zu übernehmen. Und das wollen die auch und sie können es. Und wir, die Gemeindeleitung und schon trainierte Gläubige, müssen sie dabei unterstützen, ermutigen und befähigen. Dieser Perspektivenwechsel ist doch eigentlich ganz einfach, macht aber offensichtlich bis auf den heutigen Tag allen Verantwortlichen große Schwierigkeiten. Das Prinzip lautet: Erstverantwortlich ist die Gemeinde, der Klerus muss Hilfestellung geben.
Im Jahre 1973 hatten wir in Hochdahl 194 Kommunionkinder. Die fanden sich in kleinen Gruppen von fünf bis sieben Kindern zusammen. Ein oder zwei Erwachsene begleiteten jede Gruppe auf ihrem Weg zur ersten heiligen Kommunion. Diese Begleiter waren grundsätzlich Eltern von einem der Kinder; in diesem Alter ist es noch normal, dass ein Kind in der Gruppe ist, die vom Vater oder der Mutter begleitet wird. Diese Gruppe der Eltern – es gab nur eine für ganz Hochdahl – war also rund 30 Personen stark. Sie trafen sich alle zwei Wochen, um sich auf die beiden dann anfallenden Treffen mit den Kindern vorzubereiten. Im Laufe der Jahre war es üblich, dass einer der Geistlichen und ein oder zwei Gemeindemitglieder, die in der Arbeit schon Erfahrung gesammelt hatten, die Vorbereitung der Begleiter verantworteten. Dabei ist es sicher auch immer wieder vorgekommen, dass „die Stunden vorbereitet“ wurden. Selbst vorgefertigte Stundenentwürfe soll es gegeben haben. Besser war es allerdings, wenn der Inhalt des nächsten Treffens mit den Kindern zunächst einmal für die Eltern zum Thema gemacht wurde. Denn weitergeben kann man ja nur das, was man zuerst für sich selbst in Frage gestellt und ein Stückchen weit geklärt hat. Wenn ein Kind zum Beispiel fragt, ob es auf die Hostie beißen darf (ein Problem aus eigenen Kindertagen), dann setzt die Antwort ein einigermaßen geklärtes Verständnis von Eucharistie voraus. Und diese Klärung kann auch für Erwachsene spannend sein. Da gehen einem ganz neue Einsichten auf! Belastende Missverständnisse lösen sich auf und man erlebt, dass der Glaube gut tun kann. – Die Begleiter hatten auch immer eine Mappe oder ein Buch als Hilfe für ihre Arbeit. Auch beim Umgang mit dieser Anleitung war es wichtig, nicht feste Vorgaben zu übernehmen, sondern sich die angebotenen Möglichkeiten intensiv anzuschauen, um mit der Thematik vertraut zu werden, um dann einen eigenen Leitfaden für das Treffen mit den Kindern zu entwickeln.
1973 verteilten sich die etwa 30 Gruppen auf vier Stadtviertel: Trills, Millrath, Willbeck und Sandheide. Für jedes Viertel war ein Seelsorger zuständig. Er hatte schon vor Beginn die Kinder mit Brief an die Eltern eingeladen und musste die Zusammenstellung der Gruppen in seinem Viertel organisieren. Wir legten in den ganzen Jahren Wert darauf, dass die Kinder sich für die Zugehörigkeit zu einer Gruppe selber entscheiden konnten. In jedem Viertel trafen sie sich zur Gruppenfindung in der Kirche oder im Pfarrsaal oder in der Schule. Nach einer kurzen Einführung verteilten sich die Katecheten im Raum. Und dann hieß es für die Kinder: „Entscheidet, zu welcher Mutter (Vater) ihr in die Gruppe wollt, geht zusammen mit euren Freunden dahin und achtet darauf, dass die Gruppe nicht mehr als fünf bis sieben Kinder hat.“ Und dann ging die Rennerei los. Diese Einteilung war nicht immer ganz einfach und es gab auch oft Tränen, wenn die spontane Entscheidung der Kinder eine Gruppe von 12 Mitgliedern zustande gebracht hatte, die dann mit viel Mühe und zahlreichen Lösungs-vorschlägen aufgeteilt werden musste. Diese Schwierigkeiten haben wir in Kauf genommen, damit die Gruppe eine Chance hatte, zu einer guten Gemeinschaft zu werden.
Kinder und Begleiter trafen sich zwischen Januar und Mai einmal in der Woche, üblicherweise in der Wohnung der Begleiterin, damit die Kommunionvorbereitung in den familiären Rahmen eingebettet war. Die Gruppen gingen ihren eigenen Weg auf die Erstkommunion zu. Sie wurden nicht kontrolliert, weil sie für ihr Zusammensein und ihre Arbeit eine Atmosphäre des Vertrauens erleben sollten. Wir haben die Leiterinnen der Gruppen normalerweise Katecheten genannt, aber vielleicht ist dieser Ausdruck noch zu sehr mit der Vorstellung von Unterricht verbunden, so dass „Begleiter“ das bessere Wort ist, das wir dann später in der Firmvorbereitung ausnahmslos verwendet haben.
Wichtig war uns verständlicherweise das Gespräch mit den Eltern. Der zuständige Geistliche lud die Eltern von zwei Gruppen ein, und zwar zwei oder drei Mal während der Zeit der Vorbereitung. Jeder hatte dann also zwölf oder vierzehn oder noch mehr abendliche Termine für diese Gespräche. Das war ein sehr hoher Arbeitsaufwand. Aber der überschaubare Kreis und die familiäre Umgebung machten es möglich, dass die wirklichen Fragen und Probleme zur Sprache kamen, die die Menschen mit ihrem Glauben hatten. In der Realität mussten wir natürlich Abstriche an diesem Programm vornehmen, aber es blieb dabei trotzdem klar, wie wichtig uns diese Form der Erstkommunionvorbereitung für den Aufbau einer lebendigen Gemeinde war.
Die Feiern der Erstkommunion waren nicht am Weißen Sonntag, sondern normalerweise an den Sonntagen im Mai. Dabei hatten wir im Laufe der Jahre bis zu acht verschiedene Feiern. Die Kinder von Sandheide und Willbeck feierten ihre Kommunion in Heilig Geist, die Kinder von Trills und Millrath in St.Franziskus. Eigenartigerweise waren die Eltern von Millrath in all den Jahren nie bereit, die Erstkommunion im Paul-Schneider-Haus zu feiern, obwohl das für sie der Ort der Sonntagsmesse und der gesamten Vorbereitung war. Für die Erstkommunion wollten sie in jedem Fall eine „richtige Kirche“ und deshalb musste es Trills sein. Für mich ist das auch ein Symptom, wie schlecht man von alten Bildern loskommt.
Diese Form der Vorbereitung hat einige deutliche Vorteile. 1. Die Eltern übernehmen die Hinführung ihrer Kinder zur Erstkommunion. Das war nicht so neu wie es auf Anhieb scheint. Die Eltern haben immer für die Grundlegung des Glaubens gesorgt – bis in unsere Tage. Ich erinnere mich, wie meine Mutter mit mir – damals vermutlich etwa fünf Jahre alt – vor der Krippe in der Wohnung stand und mir alles erklärte, was es zu sehen gab – Schafe und Hirten, der Brunnen im Hang, der Stall und Ochs und Esel, Maria und Josef und das Christkind. Und welche Bedeutung hat es, wenn an Weihnachten vor dem Auspacken der Geschenke gemeinsam die Weihnachtslieder gesungen werden! Und wenn die Eltern Sonntag für Sonntag die Kinder mitnehmen in die Kirche! Das hat auch nicht alles nur der Pfarrer gemacht. Und wenn dann die Eltern die Vorbereitung auf die Erstkommunion übernehmen, dann ist das nur eine neue Form einer uralten, selbstverständlichen Verantwortung der so genannten Laien. – 2. Die Kinder treffen sich in einer kleinen Gruppe. Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass die Vorbereitung sich im Lebenshorizont der Kinder vollzieht. Sie können von sich erzählen, sie können Beziehungen untereinander aufnehmen oder intensivieren, sie können miteinander überlegen und fragen und sich gegenseitig Antworten geben. Sie können miteinander etwas erleben. Die Botschaft des Glaubens kann Bedeutung gewinnen in den normalen Lebensvollzügen der Kinder. Die Erfahrung der Gemeinschaft war für die Kinder sehr wertvoll. Wir haben deshalb in dieser Zeit öfter überlegt, ob wir nicht vor der Kommunionvorbereitung einen Kurs anbieten sollten, um Vertrauen, Beziehungen und Gemeinschaft noch ausdrücklicher zu trainieren. Leider ist es dazu nie gekommen. – 3. Die Treffen finden in den Wohnungen statt. Das bedeutet, dass man die Erfahrungen des Glaubens nicht nur in den Räumen der Pfarrei, sondern entscheidend auch im familiären Umfeld macht. Damit ist die Chance verbunden, dass Glaube und Leben nicht so selbstverständlich auseinander fallen.
Wenn diese Form der Erstkommunionvorbereitung ihre ganzen Möglichkeiten entfalten soll, muss sie allerdings konsequent durchgeführt werden. Man muss zulassen, dass die Eltern ihre Aufgabe eigenständig und selbstverantwortlich wahrnehmen dürfen. – Man verpasst den Sinn der Umstellung, wenn jemand dem Pfarrer Arbeit abnehmen will und deshalb bereit ist, eine Kindergruppe zu begleiten. Das war eine Begründung, die in den ersten Jahren häufig vorgebracht wurde. Es ist ja lobenswert, wenn Gemeindemitglieder hilfsbereit sind. Aber bei dieser Begründung bleibt die Vorbereitung der Kinder „die Arbeit des Pfarrers“ und die Gemeinde kann ihrem Auftrag nicht nachkommen, zu dem sie durch Taufe und Firmung berufen und befähigt ist. – Die Katecheten sollten jedes Jahr neu aus den Eltern angeworben werden. Es macht zwar eine Menge Arbeit, die Thematik in jedem Jahr neu zu erarbeiten, aber Eltern und Kinder profitieren davon. Und im Laufe der Jahre wächst in der Gemeinde die Schar derer, die sich mit ihrem Glauben intensiv auseinandergesetzt haben. Wenn man den Eltern vermitteln kann, wie viel man bei diesem Einsatz für sich selbst gewinnt, dann werden sie mit innerer Genugtuung – wenn auch vielleicht mit einiger Mühe – dabei sein. Jedenfalls ist das eine Erfahrung, die wir in vielen Jahren mit der „Gemeindekatechese“ gemacht haben.
Die Umstellung der Erstkommunionvorbereitung war eine massive Veränderung. Von den Reaktionen in der Gemeinde berichtet ein Artikel von Günter Schuster in der zweiten Nummer der Aspekte vom März 1973. Darin heißt es: „Selten hat es in den vergangenen Jahren in unserer Pfarrgemeinde eine derart heftige Diskussion gegeben wie zu diesem Experiment. Von hochgestimmter Bejahung bis zur absoluten Verneinung ging es quer durch die Pfarre.“ – Vielen Gemeindemitgliedern war die Neuerung willkommen. Sie waren inzwischen daran gewöhnt, sich für die Zukunft der Franziskusgemeinde mitverantwortlich zu fühlen. Sie betraten allerdings auch Neuland. Denn es handelte sich ja nicht um die Teilnahme an einer Pfarrversammlung oder um eine Aufgabe in Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand. Sie übernahmen jetzt Mitverantwortung für die Weitergabe des Glaubens und das als Dienst der Gemeinde, also nicht mehr wie früher im Umfeld der Familie. Dass man ihnen das zutraute, hat viele stolz und mutig gemacht. Bis auf den heutigen Tag wird etwas von Begeisterung und Freude hörbar, wenn über die Zeit damals gesprochen wird. – Es gab auch heftigen Widerstand. Der ergab sich zum Teil daraus, dass die Eltern meinten, bei der alten Form würden die Kinder besser vorbereitet. Noch nach Jahren, als sich die Gruppenarbeit längst durchgesetzt hatte, gab es immer wieder Anfragen, ob die Kinder denn nicht das Glaubensbekenntnis und die zehn Gebote auswendig lernen müssten. Und das Bild des Pfarrers, der sich liebevoll um „seine“ Kommunionkinder kümmert und sie durch seine Persönlichkeit an die Kirche bindet, wurde auch immer wieder beschworen. Und immer wieder ertönte der Ruf nach dem „Fachmann“, weil viele Eltern sich nicht für fähig hielten, den „Unterricht“ zu geben. Dafür war doch der Pfarrer zuständig, der hat ja schließlich Theologie studiert. Dass es bei der Hinführung zur Erstkommunion nicht in erster Linie um Vermittlung von Katechismuswissen geht, sondern um die Weitergabe des eigenen Glaubens, war auch nach Jahren oft nicht zu vermitteln. – Bei dem Widerstand haben manchmal vielleicht auch zwischenmenschliche Probleme eine Rolle gespielt. „Ehe ich mein Kind dieser Frau anvertraue, mache ich es doch lieber selber.“ Den Satz habe ich zwar nie wirklich gehört. Aber wenn jemand sich selbst nicht zutraut, eine Gruppe zu begleiten, dann liegt die Frage nahe, wieso die andere Mutter meint, sie wäre dazu in der Lage. Solche Unsicherheit hat sicher bei der Findung der Katecheten oft eine Rolle gespielt. In den meisten Fällen war das Vertrauen dann stärker als die Sorge. Das bedeutet allerdings nicht, dass es hin und wieder nicht wirklich besser gewesen wäre, jemand hätte die Begleitung nicht übernommen. Aber Pannen und Fehler sind bei keinem Konzept auszuschließen, auch nicht, wenn der Pfarrer alles selber macht.
25. Gemeindekatechese 2
Buße
Von 1973 an haben wir die Bußvorbereitung nach der Erstkommunion angeboten und wir haben diese Reihenfolge bis 2006 beibehalten. Dafür gibt es triftige Gründe, die wir auch immer wieder den Eltern und der Gemeinde erläutert haben. Der Widerstand gegen diese Praxis war heftig und manchmal hatten wir den Eindruck, wir müssten uns verteidigen, so als ob wir etwas Unrechtes täten.
Wie schon erwähnt, haben wir die Kinder des dritten Schuljahres zur Vorbereitung auf die Erstkommunion eingeladen. Die Bußvorbereitung folgte dann im vierten Schuljahr. Diese Reihenfolge war Anfang der 70-er Jahre kurzzeitig als Experiment offiziell erlaubt. Und sie war von der Sache her geboten, weil dieses eine Jahr in der Entwicklung der Kinder ein deutliches Wachstum bedeutet. Sie können dann schon besser über sich und ihr Verhalten nachdenken. Ferner ging es uns um eine Entkopplung von Kommunion und Buße, um endlich die alte Vorstellung zu durchbrechen, man müsse – weil man ja vielleicht doch im Zustand der Todsünde leben könnte – vor jedem Empfang der Kommunion beichten. Weiterhin sollte die Buße nicht „auf dem Rücken der Erstkommunionvorbereitung mitfahren“. Immer wieder wurde nämlich darauf hingewiesen, dass viele Kinder bei dieser Reihenfolge nicht mehr an der Bußvorbereitung teilnehmen würden. Und dann wurden wir gefragt, wie viel Prozent denn noch weitermachten. Aber wenn der „Beichtunterricht“ die Voraussetzung für die Teilnahme an der Erstkommunion ist, dann wird er unter Umständen nur in Kauf genommen, denn den Eltern ist vor allem die Teilnahme an der Erstkommunion wichtig. Bei uns meldeten die Eltern deshalb ihre Kinder zunächst nur für die Kommunionvorbereitung an und nicht gleichzeitig für den Bußkurs und die Katecheten verpflichteten sich nur für die Kommunionvorbereitung. Eltern und Katecheten wurden dann zu Beginn der Bußvorbereitung ausdrücklich gefragt, ob sie und die Kinder weitermachen wollten. Wenigstens da wollten wir eine ausdrückliche Entscheidung, wenn schon die Teilnahme an der Kommunionvorbereitung mehr oder weniger „selbstverständlich“ war. Wir wollten wie in der gesamten Seelsorge so auch hier die Eigenständigkeit und Selbstverantwortung der Gläubigen stützen. Glaube ist nur in Freiheit möglich.
Es gibt keinen Grund, weshalb Kinder vor der Kommunion beichten müssten, auch wenn das langjährige Übung war. Das Konzil von Trient (im 16.Jahrhundert) hat festgelegt, dass ein Christ dann beichten muss, wenn er eine „Todsünde“ begangen hat. Diese Aussage muss man ernst nehmen, ist doch dieses Konzil die Institution, die nach der Reformation die katholische Lehre wieder deutlich und verbindlich festlegen wollte. Nach der alten, gut katholischen Tradition gehören drei Dinge zu einem solch schweren Vergehen: eine wichtige Sache, klare Erkenntnis und freier Wille. Bei der „wichtigen Sache“ wurde in den folgenden Jahrhunderten geschlampt. Der Begriff „Todsünde“ wurde in der Unterweisung durch „schwere Sünde“ ersetzt, obwohl beides nicht identisch ist, und alles Mögliche wurde zur schweren Sünde erklärt, sogar Fleischgenuss am Freitag. So sehr das auch eingebläut wurde, so sicher ging es an der Sache vorbei. „Todsünde“ bedeutet die volle Abkehr, den totalen Bruch mit Gott. Und das kann nicht durch nebensächliche Dinge oder vielleicht durch Unachtsamkeit geschehen; solche Ängste waren ja in der katholischen Kirche auf Grund dieser falschen Erziehung weit verbreitet. Deswegen ist „Todsünde“ nicht der Normalfall, sondern ein Vollzug, bei dem alle personalen Kräfte eingesetzt werden. Ein Kind im Alter von neun Jahren ist zu einem solchen personalen Akt auf Grund seiner Entwicklung grundsätzlich nicht in der Lage. Und deshalb kann es keine Verpflichtung geben, dass Kinder vor der Erstkommunion beichten müssten. Bei dieser umstrittenen Thematik war sehr hilfreich, was Anno Quadt 1978 in drei Artikeln in der Kölner Kirchenzeitung zur Entwicklung des Bußsakramentes geschrieben hat. Wir haben uns immer wieder auf diese Ausführungen gestützt.
Diese unsere Praxis hat vielen Eltern Probleme bereitet und es gab immer wieder heftige Auseinandersetzungen. Vor allem die Christen, die in den 80-er Jahren aus Polen und Schlesien zu uns kamen, konnten ihre strenge Erziehung an dieser Stelle oft nur schwer oder gar nicht überwinden. Immer wieder hieß es bei diesem Thema, die Kinder sollten „ganz rein“ zur Kommunion gehen. Ich hatte bei dieser Formulierung oft ein mulmiges Gefühl und der Verdacht drängte sich mir auf, dass da ungeklärte mythische Bilder eine Rolle spielten. Natürlich legten wir Wert darauf, dass die Vorbereitung gut war und dass die Kinder mit offenem Herzen und mit viel Einsicht ihre Erstkommunion feierten; aber was bedeutete darüber hinaus „ganz rein“? Es war in dieser Zeit ein offenes Geheimnis, dass manche Eltern in eigener Verantwortung ihre Kinder vorher doch beichten ließen und sie vielleicht dazu zu den angeblich stark nationalistisch eingestellten polnischen Seelsorgern nach Düsseldorf-Wersten brachten. Die Not war manchmal groß; die Eltern hatten Angst sich zu versündigen, wenn sie nicht so handelten. Der Weg in die Freiheit ist oft durch große Ängste blockiert.
Anfang der 70-er Jahre gab es bei mehreren Verlagen Mappen als Hilfsmittel für die Bußvorbereitung. Die Vorbereitung war genau so umfangreich wie für die Kommunion und ihr Inhalt war auf die Fassungskraft von Kindern im vierten Schuljahr abgestimmt. Und dann verfügten die vatikanischen Behörden, dass die Bußvorbereitung nicht mehr nach der Erstkommunion stattfinden dürfe. Die alte Ordnung wurde wieder verbindlich gemacht. Mir ist nicht bekannt, dass irgendwo versucht worden ist, einen ausführlichen Bußkurs vor der Erstkommunion anzubieten; das hätte ja auch bedeutet, die Kinder im zweiten Schuljahr beichten zu lassen. Stattdessen war es offensichtlich allgemeine Praxis, die Buße in den Kommunionkurs zu „integrieren“. Das bedeutete, dass in der ersten Zeit nach dem römischen Verbot sich im Kommunionkurs vier Stunden zum Thema Buße fanden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diese Verkürzung für verantwortbar hielt. Inzwischen scheint sich der „Tag der Versöhnung“ durchgesetzt zu haben, der ein noch dürftigeres Angebot darstellt. Rom hat entschieden und (fast) alle machten mit!
Wir haben bis 2006 die Bußvorbereitung weiter nach der Erstkommunion angeboten. Der Dechant in der Nachbarpfarrei machte es ebenso. Der bekam dann – ein paar Jahre vorher – einen Weihnachtsgruß von seinem Weihbischof. Darunter stand die Anordnung, die Reihenfolge sofort umzustellen. Eine zusätzliche Bemerkung lautete: „Das ist eine Order“.
Als ich davon hörte, habe ich gemault: „Ich hätte beim Weihbischof mal angefragt, was denn das Wort ´Order´ bedeute. Dieser Begriff sei mir in der theologischen Sprache unbekannt.“
Hätte ich den Mut gehabt, mich auch dieser ausdrücklichen „Order“ zu widersetzen? Es wäre wohl nötig gewesen. Erst bei meinem Nachfolger hat der Nachfolger des genannten Weihbischofs die Umstellung gegen die guten Argumente des Pfarrgemeinderates durchgesetzt.
Wir haben die „Krise des Bußsakraments“ ernst genommen und haben jahrelang versucht, die Ursachen zu verstehen und einen Weg zu einem gelingenden Vollzug der Buße zu finden.
Zu Anfang ging es uns vor allem darum, die verbreiteten Ängste abzubauen, die mit der Beichte verbunden waren. Die Eltern, deren Kinder Mitte der 70-er Jahre zur Kommunion gingen, hatten oft sehr belastende Erinnerungen an ihre eigene Beichte. Immer wieder tauchte die Frage auf: „Wie kann ich meinem Kind nahe bringen, was mir selbst solche Probleme gemacht hat?“ Bei der Bußvorbereitung der Kinder mussten wir also gleichzeitig die Erfahrungen der Eltern zu klären versuchen. Das war besonders für die Eltern wichtig, die auch in der Bußvorbereitung eine Kindergruppe begleiten wollten. Beim ersten Treffen dieser Katecheten ging es immer um die persönlichen Erfahrungen und Einstellungen zu Beichte und Buße. Und es tat gut, erzählen zu können, was die Einzelnen dabei bedrückte und belastete. Und da meine eigenen Erinnerungen an Kinder- und Jugendtage genau so problematisch waren, war ich nicht in Gefahr, die Nöte der Eltern beiseite zu schieben oder zu bagatellisieren. Warum hat die alte Beichtpraxis so viel Angst produziert? Es scheint, dass in der Unterweisung einiges schief gelaufen ist.
Der grundlegende Fehler war wahrscheinlich die Vorstellung, Kinder könnten eine „Todsünde“ begehen (siehe oben). Relativ gängig war bei uns im Dorf die Drohung: „Wenn du das tust, kommst du in die Hölle“. Und viele Ältere kennen noch den Satz: „Ein Auge ist, das alles sieht …“. Hochproblematische Sprüche, die mit der jenseitigen Autorität die eigenen Erziehungsversuche abstützen sollten. Kinder mit einer stabilen seelischen Konstitution werden diese Situation vielleicht unbeschadet überstanden haben. Aber ängstliche Gemüter konnten dadurch ernsthaft verletzt werden. Anscheinend haben viele Eltern und auch Geistliche die Ungereimtheiten und Gefährdungen dieser Glaubensvermittlung nicht erkannt. Haben sie nicht darüber nachgedacht oder hatten sie Angst, sich zu versündigen, wenn sie vom gewohnten und vorgeschriebenen Weg abwichen? Ich weiß es nicht. Ein genauso schwerwiegender Fehler ist die Praxis, Kindern bis zum Alter von etwa vierzehn Jahre alles beibringen zu wollen, was sie für ihr ganzes religiöses Leben bis zum Tode brauchen. Ich vermute, dass solche Erziehung die Ursache ist, wenn es Leuten schwer fällt, etwas in Frage zu stellen, was sie gelernt haben. Manchmal ist der Übergang zum Glauben eines Erwachsenen kaum zu vollziehen. In der Erziehung der Kinder hat das die schlimme Folge, dass man ihnen etwas von „Todsünde“ erzählen muss, obwohl sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Und von einer ungültigen Beichte, obwohl es nicht vorkommt. Das macht Angst. Auch die folgende kleine Begebenheit, an die ich mich noch sehr genau erinnere, ist eine Folge dieser falschen Praxis. Wir hatten einen Pastor, der sehr beliebt war und der mit seiner Musikalität die Pfarrei in Schwung gebracht hat. Im Beichtunterricht hat er uns vermittelt, dass man keine „schwere Sünde“ in der Beichte auslassen dürfe. Das sei nämlich eine neue Sünde und alle folgenden Beichten seien ungültig. Das sei wie bei den Knöpfen der Soutane (ich weiß nicht, ob er dieses beispielgebende Kleidungsstück dabei anhatte). Die Soutane habe dreiunddreißig Knöpfe. Wenn man nun beim Zuknöpfen oben einen Knopf überschlagen hätte, habe man unten einen zu wenig. Dann müsse man alle Knöpfe bis oben wieder aufmachen, damit die Soutane richtig geschlossen sei. So sei das auch bei einer ungültigen Beichte. Diese Theorie mag stimmen, wenn jemand eine „Todsünde“ zu beichten hat. Aber
warum muss man Kinder damit belasten, wenn diese Situation für sie überhaupt nicht zur Debatte steht. Die Folgerung ist eindeutig: Die Unterweisung für Kinder und Erwachsene kann nicht die gleiche sein und, um den Erwachsenen eine eigene Unterweisung zuteilwerden zu lassen, muss man sich etwas einfallen lassen! – Die Schwächen der Unterweisung für die Kinder waren damals offensichtlich eingebettet in ein einschüchterndes Gesamtklima in der Kirche. Man hatte mehr Angst vor der Sünde als Vertrauen auf die befreiende Nähe Gottes.
Ein Symptom dafür ist die Beichtpraxis der Erwachsenen in dieser Zeit. Ich habe es noch nach dem Krieg erlebt, dass „praktizierende Katholiken“ einmal im Monat zur Beichte gingen. Am anderen Morgen gingen sie in die „Frühmesse“ und kommunizierten und dann vier Wochen nicht mehr. Normalerweise ging man nicht in die Frühmesse, sondern um 10 Uhr ins „Hochamt“; aber da wurde nicht die Kommunion ausgeteilt.
Wie kann man bei einer neuen Form der Bußvorbereitung erreichen, dass für Kinder – und natürlich auch für Erwachsene – die Beichte zu einem Vollzug von Vertrauen werden kann?
Auch wenn man die „Beichtväter“ als sehr hilfsbereit und verständnisvoll erfahren hat, macht das die Beichte noch nicht zu einem Instrument von Befreiung und Ermutigung zum Leben. Ich hatte in der ganzen Zeit der Beichtpraxis und der Überlegungen zur Beichtpastoral die Vorstellung, dass das eigentliche Problem nicht der Beichtende mit seinen Akten der Umkehr sei, sondern die andere Seite. Die Kirche wird allgemein und insbesondere in diesem Vorgang nicht als glaubwürdig erlebt in ihrem Anspruch, eine Institution der Erlösung zu sein. Sicher ist bei solchen Überlegungen zu berücksichtigen, dass es in jeder Beziehung sehr schwer ist,
die Ursache des Misslingens zu definieren: kann ich nicht richtig vertrauen oder ist mein Gegenüber nicht vertrauenswürdig? Die erste Mappe, mit der wir 1973 in die Arbeit mit den Katecheten eingestiegen sind, haben wir selbst entworfen. Sehr viel später haben wir dann eine Mappe für die Kinder erarbeitet, die zunächst von der Schönheit des Lebens erzählte, um das grundsätzliche Vertrauen in das Leben und die anderen Menschen zu stützen. „Das Leben ist schön – und trotzdem fällt man immer wieder mal ins Loch – und wie kommt man da wieder raus?“ So war der innere Aufbau der Mappe. Nicht die Sünde ist das Entscheidende, sondern das Leben und die Welt und die Menschen, die von Gottes Liebe Zeugnis geben. Die Sünde ist eine Störung, sie ist die Folge von gestörtem Vertrauen (vgl. Gen 3,1).
Ein anderes wichtiges Anliegen in der Bußvorbereitung bestand darin, die Vielfalt der Bußformen zur Geltung zu bringen und für Kinder erlebbar zu machen. Vielerorts wird die Beichte ja als die einzige Möglichkeit wahrgenommen, Vergebung zu finden. Dabei gibt es viele Formen, die viel mehr im Leben von Kindern verankert sind und deshalb auch viel leichter als Vergebung erfahren werden. Im Gespräch mit den Bußkatecheten musste immer wieder die Frage geklärt werden, ob diese verschiedenen Formen wirklich Vergebung ermöglichen. Da war zum Beispiel das Gespräch mit der Mutter. Wenn ein Kind einen schweren Tag mit Konflikten und Versagen hinter sich hat und die Mutter abends an seinem Bett sitzt, dann ist es oft für das Kind möglich, von diesen Erfahrungen zu erzählen. Und wenn dann das Kind seine Not der Mutter anvertrauen kann, kann es dabei Erleichterung und Befreiung erleben. Das ist nicht automatisch und in jedem Fall auch Verzeihung von Gott her. Es kann aber dazu werden, wenn die Mutter diese Situation in gemeinsamem Gespräch und Gebet vor Gott bringt. Und das ist dann wirklich Vergebung. Ob es an der Stelle bei einem zwischenmenschlichen Verstehen und Annehmen bleibt (und wie wertvoll wäre auch das schon!) oder zur Erfahrung des Erbarmens Gottes weitergeführt wird, hängt also von der Intention und dem Vorgehen der Mutter ab. Ein anderes Thema war das Beispiel von Frau Müller (Name geändert!) Frau Müller war eine Katechetin der Bußvorbereitung. In einer Gruppenstunde hat sie die Kinder angeleitet, über sich und ihr Versagen nachzudenken. Dann hat jeder das, was ihm eingefallen ist, auf einen Zettel geschrieben. Frau Müller hat mit ihnen über Schuld und Vergebung gesprochen. Dann haben sie miteinander gebetet und anschließend die Zettel in einer Schale verbrannt. Wir haben oft über diesen Vorgang diskutiert und die Frage gestellt: war das echte Vergebung? Es war meist nicht leicht, andere Katecheten davon zu überzeugen. Dass da irgendetwas wie Vergebung geschehen war, wurde akzeptiert, aber immer wieder die Unsicherheit, ob das wirklich gültig und verbindlich sei. Ich vermute, dass diese Unsicherheit eine Folge der alten Fixierung auf die Beichte war. Diese Unsicherheit wird heute noch für mich deutlich. Ich beobachte manchmal, dass nach einer Erstbeichte (am „Tag der Versöhnung“) die entsprechenden Zettel aller Kinder in einer großen Schüssel verbrannt werden. Dieser Vorgang ist bedenklich, weil er dabei seiner Bedeutung entleert wird. Ist das Verbrennen der Zettel wirklich eine Möglichkeit von Sündenvergebung, dann darf man es nicht an die Beichte anhängen, weil die Sündenvergebung ja schon vorher stattgefunden hat. Ist er nur frommes Spiel, dann sollte man darauf verzichten. Ganz widersprüchlich sind ja auch die Antworten auf die Frage, ob bei der Bußfeier Versöhnung geschieht. In Hochdahl waren die Bußfeiern für Erwachsene vor Weihnachten und Ostern immer gut besucht – auch von vielen Aussiedlern. Sie wurden an zwei Abenden angeboten und beide Male war die jeweilige Kirche gut besetzt. Man darf die Teilnahme nicht abwerten und behaupten, die Leute wären nur froh gewesen, dass sie nicht mehr zu beichten brauchten. Ich glaube nicht, dass es sich bei der Bußfeier um eine sakramentale Form der Vergebung handelt, aber Sündenvergebung braucht auch im Normalfall nicht sakramental zu sein. Hier muss wiederholt werden, dass laut Konzil von Trient die Beichte nur verpflichtend ist, wenn jemand eine Todsünde begangen hat. (Siehe oben.) Für die Kinder machten wir zum Abschluss der Bußvorbereitung das Angebot einer (gut vorbereiteten) Bußfeier. Danach sollte jeder für sich überlegen, ob er seine Sünden auch noch in der Beichte aussprechen wollte. Wir hatten während des Bußkurses dabei deutlich gegenübergestellt, welche Möglichkeiten und Grenzen die eine und die andere Form hat. Eigentlich hätten wir auf die Beichte ganz verzichten können, wenn Kinder denn grundsätzlich keine Todsünde begehen können. Faktisch haben mich die Erfahrungen immer verunsichert: gingen alle Kinder nach der Bußfeier zu Beichte, hatte ich den Verdacht, dass sie dem Herdentrieb gefolgt waren. Ging keiner zur Beichte, hatte ich Angst, dass sie etwas verpasst haben könnten. Das Argument, die Kinder sollten beichten gehen, damit sie es lernten und für den Notfall könnten, hat mich nie überzeugt. Diese Empfehlung entspringt nämlich einem (gut gemeinten) pädagogischen Anliegen und hat mit der theologischen Frage nichts zu tun. Im Augenblick glaube ich, dass der Weg über die Vielfalt der Bußformen (es gibt ja noch einige andere) zu einer Verlebendigung der vertrauenden Haltung und zu einer Erneuerung der Pastoral der Buße hätte führen können. Aber auch hier: eine verpasste Chance!
26. Ökumene 2
Im Jahr 1974 beschlossen die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Hochdahl eine „Ökumenische Grundsatz-Vereinbarung“. Diese vertragliche Bindung war einerseits das Ergebnis von mehreren Jahren intensiver Beratung und Klärung in der Zusammenarbeit der beiden Gemeinden, andererseits verbindliche Leitlinie für die Zukunft.
Zu diesem Zeitpunkt war im Zusammenleben der beiden Gemeinden schon viel geschehen. Der Reformationstag 1968 markierte den Punkt, von dem ab ein gemeinsamer Weg auch nach außen sichtbar wurde. Damals begann das Ökumenische Bildungswerk seine Arbeit, die evangelische Gemeinde stellte das Paul-Schneider-Haus für einen regelmäßigen Sonntagsgottesdienst der katholischen Gemeinde zur Verfügung. Schon vorher hatten die beiden Pfarrer Reinhard Berchem und Hans Meixner mit vielen Initiativen die Annäherung der beiden Gemeinden betrieben. 1972 wurde auch in der Neanderkirche eine regelmäßige katholische Vorabendmesse möglich. Und zur gleichen Zeit traf die katholische Gemeinde schon die Entscheidung, in Millrath-Ost keine Kirche mehr zu bauen und stattdessen das großzügige Angebot der evangelischen Gemeinde im Paul-Schneider-Haus auf Dauer zu nutzen.
In den Jahren, von denen hier die Rede ist, haben wir in Hochdahl einen intensiven ökumenischen Aufbruch erlebt. Das war - zumindest in der katholischen Kirche – vor allem eine Folge des Konzils. Der neue Frühling, den Johannes XXIII. der Kirche gewünscht hatte, brachte auch eine deutlich andere und neue Beziehung zwischen den Konfessionen. In der unmittelbaren Begegnung war es dadurch möglich, dass die alten festgefahrenen Vorurteile zurücktraten zu Gunsten einer vertrauensvollen gegenseitigen Wertschätzung. – In Hochdahl hatten wir für diesen Aufbruch sehr günstige Bedingungen. Im Endausbau der neuen Stadt mussten ja für beide Gemeinden die Strukturen und Einrichtungen vorhanden sein, die sie für ihre pastorale Arbeit brauchten. Und um dieses Ziel zu erreichen, war eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Konfessionen und mit der Stadtplanung und der Entwicklungsgesellschaft nötig. Auch durch dieses Bemühen wuchs bei uns die Ökumene. – Eine solche lebendige Begegnung war zu der Zeit in vielen Städten möglich. Vor allem in Neubaugebieten wurde über neue Formen des Zusammenlebens nachgedacht. Es ging dabei immer wieder auch um die Frage, wie man ökumenische Kirchen- und Gemeindezentren bauen und gestalten könne. Und es hat an vielen Orten in ganz Deutschland zahlreiche solche Versuche gegeben. In den meisten Fällen entschied man sich dabei für eine so genannte „additive Lösung“. Das bedeutete, dass die beiden Gemeinden zwei aneinander grenzende Grundstücke erwarben und dann ihr jeweils eigenes Haus bauten. Das Gemeinsame konnte dann ein gemeinsames Dach oder vielleicht ein gemeinsamer Eingangsbereich oder auch nur die gemeinsame Brandmauer sein. Manchmal war es auch ein öffentlicher Platz, der das Verbindende zwischen getrennten Gebäudekomplexen darstellte. Das ist allerdings eine Lösung, bei der das „Ökumenische“ des Bauens weniger deutlich wird. – Wir waren also mit vielen anderen evangelischen und katholischen Gemeinden auf ein gemeinsames Ziel hin unterwegs. Wir erfuhren davon durch die Berichte und Anregungen, die die Ökumenische Centrale in Frankfurt am Main herausgab. Das war die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (AcK). Schon seit den ersten Nachkriegsjahren standen diese Institutionen im Dienst der ökumenischen Sache.
Wenn man den Text der „Ökumenischen Grundsatzvereinbarung“ heute liest, dann registriert man mit Wehmut oder mit immer noch dankbarer Freude, was damals in der Ökumene möglich war. Und man fragt sich mit einer gewissen Bangigkeit, woher die Verfasser ihren Mut und ihre große Zuversicht nahmen. Hatten sie vergessen, dass vor noch gar nicht so langer Zeit die Kinder auf dem Schulhof sich wegen ihrer unterschiedlichen Konfession mit Steinen bewarfen? Und hatten sie keine Angst davor, dass Gleichgültigkeit und Trott irgendwann in der Zukunft die Beziehungen zwischen katholischen und evangelischen Christen bestimmen würden?
Vielleicht war doch ein anderer Geist am Werk, wenn sie in der Einleitung die Grundlage für ihr Vorhaben beschreiben: „Im Bewusstsein der in dem einen gemeinsamen Herrn Jesus Christus begründeten Zusammengehörigkeit beider Kirchengemeinden und ihrer Glieder und geleitet von dem Wunsch nach umfassender Gemeinsamkeit …“. Wenn man daran glaubt, dass man auf einem solchen Boden steht, dann kann man mit Gelassenheit und Energie die Weichen für die Zukunft stellen.
Der folgende erste Abschnitt des Dokuments formuliert noch einmal die Absicht, eine enge Zusammenarbeit „bei der Erfüllung des eigentlichen Auftrags“ der beiden Gemeinden anzustreben. Die Möglichkeiten einer gemeinsamen Wahrnehmung spezieller Aufgaben in den Bereichen der Bildungs-, Jugend-, Alten- und Sozialarbeit sollen ausfindig gemacht werden. Davon erhoffen sich die Verfasser auch Einsparungen bei den zukünftigen Investitionen. – Über die Planung, Errichtung, Unterhaltung und Nutzung von Gebäuden und Räumen wollen beide Gemeinden sich gegenseitig fortlaufend unterrichten, gemeinsam beraten und entscheiden. – Die bewährte Praxis, der jeweils anderen Gemeinde Räume zu gelegentlicher oder dauernder Mitbenutzung zu überlassen, soll beibehalten und vertraglich abgesichert werden. – Bei Neubauvorhaben soll diese Möglichkeit schon vorher überlegt und gegebenenfalls eingeplant werden. Auch soll die Möglichkeit geprüft werden, Gebäude oder Gebäudeteile gemeinschaftlich zu planen, zu bauen und zu unterhalten. – Die Verfasser gehen davon aus, dass zur Verwirklichung der Grundsatzvereinbarung Einzelverträge abgeschlossen werden müssen.
Im zweiten Abschnitt des Textes geht es um die gemeinsame Errichtung eines Ökumenischen Zentrums im Hauptzentrum der neuen Stadt Hochdahl. In diesem frühen Stadium des Aufbaus der Stadt wird für dieses Zentrum eine sehr umfangreiche Liste von Funktionen und Angeboten aufgeführt. Dafür wollen die beiden Gemeinden im Stadtzentrum ein gemeinsames oder zwei benachbarte Grundstücke erwerben. In jedem Fall soll eine einheitliche Bebauung der gesamten Fläche sichergestellt werden. – Zum Schluss weisen die Verfasser darauf hin, dass diese Vereinbarung durch das Erzbischöfliche Generalvikariat und das Landeskirchenamt der ev. Kirche genehmigt werden muss.
Die Grundsatzvereinbarung wurde am 24.Juni 1974 vom Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde und am 8.Juli 1974 vom Kirchenvorstand der Katholischen Kirchengemeinde beschlossen. Und wie es dann mit der hoheitlichen Genehmigung weiterging, erzählt Gerd Verhoeven in den Aspekten vom September 1986 (wo auch die Grundsatzvereinbarung abgedruckt ist). Die Kirchenleitungen hatten Schwierigkeiten, vor allem das Generalvikariat in Köln. „Eine völlig neue, nichtssagende Fassung wurde im Generalvikariat erstellt und den Kirchengemeinden unterbreitet. Diese Fassung war unannehmbar. Es bedurfte einiger Briefe und einer sehr gründlichen Auseinandersetzung der Hochdahler Delegation unter Leitung von Dr.Kiefer (Pfarrgemeinderat) und Dr.Böckenförde (Kirchenvorstand) mit Kardinal Höffner und seinem damaligen Generalvikar Nettekoven, um den ursprünglichen Vertrag dann doch noch unter Dach und Fach zu bringen. Im September 1974 wurde er von beiden Kirchenleitungen unterschrieben.“
27. Eine Gemeinde traut sich …
Wir betonen immer und immer wieder, dass ein Mensch durch Taufe und Firmung zu einem voll handlungsfähigen Christen wird. Das nutzt alles nichts, wenn diese Fähigkeit nicht als wirklich vorhandene erfahren wird. Wenn wir für die Begleitung der Kommunionkinder Katecheten gesucht haben, dann hörten wir von vielen Müttern und Vätern den Satz: „Das kann ich nicht“. Die Sorge war echt und die Bedenken waren meistens begründet. Wie soll man auch begeistert zu etwas „Ja“ sagen, was man noch nie gemacht hat und deshalb nicht kennt. Und wem eine gute Vorbereitung der Kinder am Herzen liegt, wird nicht leichtsinnig eine solche Aufgabe übernehmen. In dieser Situation entscheidet sich, ob die Gemeinde eine Chance hat, mündig und eigenständig zu werden. Und für das einzelne Gemeindemitglied entscheidet sich, ob die Sache mit dem „voll handlungsfähigen Christen“ Realität werden kann. Der verantwortliche Geistliche muss zwei Dinge vermitteln können: 1. Ich traue dir zu, dass du das schaffst, und 2. Alles, was du dazu brauchst, werden wir gemeinsam erarbeiten. Wenn ein Gemeindeleiter den Menschen nur die Wartung der Heizung oder den Austausch der Beleuchtungskörper in der Kirche zutraut, wird keine Gemeinde wachsen können. – Eine junge Frau, die als gut Zwanzigjährige nach Hochdahl zuzog, war nach kurzer Zeit Begleiterin in der Firmvorbereitung – eine in der Tat anspruchsvolle Tätigkeit. Sie sagt heute im Rückblick: „Ihr habt uns das zugetraut“ und das war für sie die Tür zur Gemeinschaft und zu wertvollen Erfahrungen. – Ähnlich war es mit der Praxis bei der Vorbereitung und Gestaltung der Kindermessen. Wenn in einer Vorbereitungsgruppe der erste Abend der Besprechung und dem Verständnis des jeweiligen biblischen Textes gewidmet war, dann war die Ausgestaltung der Katechese im Gottesdienst die Aufgabe von zwei oder drei Gruppenmitgliedern. Und die waren dafür allein zuständig, der „theologische Fachmann“ war dann nicht dabei. Das konnte man den Mitgliedern des Arbeitskreises ohne weiteres zutrauen. – Ein zweiter „Arbeitskreis Kindergottesdienst“ bereitete die Katechese ganz eigenständig vor und warf den Entwurf dem Geistlichen vor dem Wochenende in den Briefkasten. Und dem Vorschlag entsprechend wurde die Katechese gehalten, wenn auch manchmal mit gewissen Veränderungen. Solche Veränderungen führten ab und zu auch im Nachhinein zu leichten Verstimmungen, aber dabei blieb immer klar, dass wir dem Kreis zutrauten, die Vorbereitung kompetent und mit einem guten Ergebnis zu machen. Nicht alle in der Gemeindeleitung sahen das gleich unbekümmert. Es gab auch die Meinung, es sei besser, wenn der „Theologe“ bei der Vorbereitung mit im Gespräch sei.
Es ist unbedingt nötig, eine solche seelsorgliche Praxis über viele Jahre durchzuhalten. Denn die Folgen für das Selbstbewusstsein der Gemeinde und die Bereitschaft zur Mitarbeit in Eigenverantwortung stellen sich nicht nach ein, zwei Jahren ein. Aber im Laufe der Zeit entwickelt sich eine Mentalität, die getragen und legitimiert ist von vielfältiger Erfahrung.
Und viele in der Gemeinde – wenn auch nicht alle – erleben mit Freude und Dankbarkeit, dass sie miteinander und mit der Gemeindeleitung sich und die Gemeinde am Leben erhalten.
28. Eine Gemeinde lernt …
Wir haben Menschen in der Gemeinde ermutigt, eine Gruppe von Kommunionkindern oder eine Gruppe von Jugendlichen in der Vorbereitung auf die Firmung zu begleiten, indem wir ihnen vermittelt haben: 1. Ich traue dir zu, dass du das schaffst, und 2. Alles, was du dazu brauchst, werden wir gemeinsam erarbeiten. – Man darf niemanden in eine verantwortungsvolle Aufgabe hineinwerfen und es dann ihm allein überlassen, wie er damit klar kommt. Eine gemeinsame intensive Vorbereitung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist unverzichtbar. Das bedeutet aber, dass diese Tätigkeit einen tief greifenden Lernprozess fordert und ermöglicht. Und dieser Lernprozess ist nur dann ein gemeinsamer, wenn auch der „Theologe“ nach jedem Abend etwas dazu gelernt hat. Wer wollte, konnte in Hochdahl in Bezug auf seinen Glauben sehr viel lernen. Manche werden einen ganz neuen und beglückenden Zugang zum Glauben gefunden haben.
Die größten „Lernerfolge“ hatten wir zweifellos im Zusammenhang mit der Gemeindekatechese. Jedes Jahr fanden sich etwa 20 bis 30 Personen, die sich bereit erklärten, Kinder auf dem Weg zur Erstkommunion zu begleiten. Viele von denen machten anschließend im Bußkurs weiter. Später – ab 1977 – waren jedes Jahr knapp 20 Begleiter bei der Firmvorbereitung tätig. Und wenn man mit jeder Gruppe jedes Jahr neu und intensiv um die richtigen Einsichten und den richtigen Weg ringt, dann wächst im Laufe von vielen Jahren ein großer Schatz an Erkenntnissen, Fähigkeiten und Bereitschaft. Und wo ich persönlich in dieses Ringen eingebunden war, habe ich es einerseits zwar als Arbeit und Mühe erlebt, aber viel entscheidender als Nahrung für die Seele. – 1978/79 kam noch ein anderer Kreis dazu, der die Eltern bei der Vorbereitung auf die Taufe ihrer Kinder unterstützte. Dieser Taufarbeitskreis war allerdings stabil; die Teilnehmer wechselten nicht jedes Jahr (vgl. Nr.49, Gemeindekatechese 4, Taufarbeitskreis). Aber die Vorbereitung auf diese Tätigkeit war genau so anspruchsvoll wie bei den anderen Kreisen. Bevor die Gespräche mit den Eltern begannen, haben sich 15 Gemeindemitglieder ein Jahr lang regelmäßig getroffen. Ernst Werner von der Abteilung Gemeindekatechese der Diözese hatte die Leitung bei diesem Kurs. Und während der ganzen Jahre, in denen die Mitglieder des Kreises die Eltern begleiteten, war die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und mit den Formen und Grundlagen ihrer Arbeit selbstverständlich. Einmal im Jahr fuhren sie nach Rinsecke, wo sie Wolfgang Kraft bei seinen biblisch-theologischen Vorträgen mit offenem Herzen zuhörten (!). Drei- oder viermal im Jahr traf sich der Kreis in Hochdahl, um Erfahrungen auszutauschen und erneut nach den richtigen Themen und Methoden zu suchen.
Die Verkündigung im Sonntagsgottesdienst kann man sicher auch unter dem Gesichtspunkt eines Lernprozesses sehen. Eine einzelne Predigt wird wahrscheinlich keine große innere Entwicklung beim Hörer in Gang setzen. Aber immer wieder haben Gemeindemitglieder erwähnt, dass sie beim Mittagstisch noch über die Predigt diskutiert hätten. Vielleicht trägt das dann doch über die Jahre dazu bei, dass der Glaube und die theologischer Kompetenz wachsen.
Wie bei der Vorbereitung der Gottesdienste für Kinder waren auch die Jugendmessen Anlass, sich über Thema und Inhalt der Verkündigung im Gottesdienst intensiv Gedanken zu machen. Die Zahl der Jugendlichen, die dabei beteiligt waren, war zwar normalerweise nicht sehr groß. Aber vielleicht hatte das sogar zur Folge, dass die Gespräche intensiv wurden.
Es wurde schon erwähnt, dass 1971 die Gemeinden eingeladen waren, in Gesprächskreisen die Themen der Würzburger Synode zu besprechen. Dazu gab es gutes und ausführliches Arbeitsmaterial. In den Ehekreisen haben wir intensiv miteinander überlegt und diskutiert. Und wir haben dabei manches gelernt.
In der ersten Hälfte der 70-er Jahre kam uns eine Situation im Bereich der Schule entgegen. Für die Grundschule und den Sekundarbereich eins gab es nicht genügend Lehrer, die Religionsunterricht geben konnten. Die Schulverwaltung war bereit, Katecheten mit einer kirchlichen Ausbildung als Religionslehrer einzusetzen. Eine ganze Reihe von Mitgliedern der Hochdahler katholischen Gemeinde war bereit, eine solche Ausbildung mitzumachen. Und der Kurs war so aufgebaut und ausgerichtet, dass die Teilnehmer anschließend befähigt waren, in der Schule tätig zu werden. Diese Chance hat nicht lange Bestand gehabt, weil die Schulverwaltung verständlicherweise bemüht war, im Laufe der Zeit den Religionsunterricht wieder durch die Lehrer erteilen zu lassen. Einige hatten allerdings die Möglichkeit, auch danach als Religionslehrer in der Schule zu bleiben.
Die Bereitschaft, sich mit seinem Glauben zu beschäftigen und über die Erkenntnisse aus Kindertagen hinauszukommen, war in der Hochdahler Gemeinde die ganzen Jahre über sehr groß. Von vielen wurde deshalb die Gelegenheit genutzt, die die beiden Fernsehserien 1980 und 1984 anboten. Das Thema der ersten Sendereihe lautete: „Warum Christen glauben“. In den „Aspekten“ von Dezember 1979 wird die Art der Darstellung so beschrieben: „Die Sendungen versuchen durch Spielhandlungen und Dialog Fragen und Probleme des jeweiligen Themas aufzureißen und Ansätze für die Beantwortung zu bieten. Die kritische Besinnung ist in die Spielhandlung so eingebaut, dass die Akteure selbst Argumente für und gegen eine bestimmte Glaubensüberzeugung oder Lebenseinstellung einbringen.“ Eine solche Darstellung verlangte nach einer weiteren Diskussion. Deshalb wurden Begleitgruppen gebildet, in denen die Teilnehmer über die Sendung und die dort angeschnittene Thematik sprechen konnten. Als Arbeitsmaterial gab es ein Lese- und Arbeitsbuch, das Anregungen und Hilfen beim Selbststudium oder für die Begleitgruppe geben sollte. Dieses „Angebot im Medienverbund“ – wie es hieß – war eine gelungene Sache. Es ging nicht um fertige Antworten, es ging nicht um Katechismuswissen. Die Vielfalt des Lebens wurde ernst genommen und die „Gemeinde Jesu Christi“ suchte im Austausch und Gespräch ihren Weg.
Die Beteiligung war groß. Ungefähr 150 katholische und evangelische Christen machten mit. Zum Teil waren es schon bestehende Gruppen, aber bei dem ersten Treffen aller Interessierten in der Sandheider Kirche konnte man sich auch zu neuen Gruppen zusammenfinden. Manche Beziehungen, die bei diesen Gesprächen entstanden sind, blieben lange lebendig. Und der Zeit- und Arbeitsaufwand wurde nicht als Belastung empfunden – immerhin hatte die Sendung 13 Folgen!
Die zweite Fernsehserie, die 1984 ausgestrahlt wurde, hatte den Titel „Christsein im Alltag“. Es ging um das richtige christliche Verhalten. In sechs Folgen wurden Szenen aus dem Alltag dargestellt, in denen Menschen vor der Frage standen, wie sie sich entscheiden sollten. Die Situation war immer komplex und in keiner Szene war schnell zu erkennen, was richtig war. Deshalb lag der Schwerpunkt wieder auf den Gesprächen in den Begleitgruppen. Und dabei wurde den Teilnehmern deutlich, wie schwierig heute der Weg ist, wenn man moralische Normen erkennen und richtiges Verhalten praktizieren will. Das Auswendiglernen der 10 Gebote beseitigt ja nicht alle Unklarheiten und das Leben ist nicht einfach schwarz oder weiß. Und man findet sich oft in Situationen wieder, die vielschichtig, undurchsichtig und verwirrend sind. – In diesem Bereich hätte die Gemeinde ein großes Lernprogramm durchlaufen müssen. Schon am Schluss des Artikels über die Erfahrungen mit der Fernsehserie („Aspekte“ Dezember 1984) steht der Satz: „Über Fragen des Glaubens wird in dieser Gemeinde schon relativ oft gesprochen. Die Fragen christlichen Handelns stehen demgegenüber selten zur Debatte. Eine Aufgabe für die Zukunft.“ – Diese Aufgabe haben wir nicht erfüllt.
29. Eine Gemeinde erkennt ihre Würde
Manchmal kamen Leute aus dem Urlaub nach Hause und meinten: „Och, was sind wir froh, dass wir in Hochdahl leben.“ Und dieser Spruch war die Folge ihrer Erfahrung beim Gottesdienst an ihrem Urlaubsort. Oder man traf sich bei einer Wochenendveranstaltung mit Mitgliedern anderer Pfarreien und war entsetzt über deren Ansichten. Es stimmt schon, dass wir stolz waren auf das kirchliche Leben in Hochdahl.
Bei vielen derartigen Bemerkungen haben wir aber auch versucht, uns gegenseitig auf den Teppich herunterzuholen. Weil die Gefahr eben groß ist, dass man sich etwas einbildet. Und wenn man nur stolz ist auf die eigene Leistung, fällt alles bald in sich zusammen. Und natürlich meldet sich da auch der Apostel Paulus zu Wort, der davor warnt, mit den eigenen Fähigkeiten oder Erfolgen anzugeben. „Denn nicht, wer sich selbst empfiehlt, ist bewährt, sondern der, den Gott empfiehlt.“ Es ist nicht leicht, den Weg zwischen falscher Bescheidenheit und Arroganz zu finden. Vielleicht muss man prüfen, wie viel Dankbarkeit in dem Selbstbewusstsein vorhanden ist – Dankbarkeit für das, was uns auf dem gemeinsamen Weg geschenkt worden ist. Deshalb lautet die Überschrift nicht: Eine Gemeinde entwickelt Selbstbewusstsein, sondern: sie erkennt ihre Würde. Denn diese Würde kann man sich nicht erarbeiten oder verdienen, diese Würde ist Gabe und Geschenk. Sie wird in dem Maß verliehen, wie man sich der Zuwendung Gottes bewusst wird. Glaubende Erkenntnis verleiht Würde.
Diese Würde macht frei, sie relativiert Abhängigkeiten.
Wir sind gegenüber dem Bischof und seiner Diözesanleitung selbstbewusst aufgetreten. In der ersten Zeit des Hochdahler Gemeindeaufbaus brauchte das nicht zum Konflikt zu führen, weil eine erfreuliche Übereinstimmung in den Vorstellungen und Plänen bestand. – Als wir 1975 „Ave Eva“ gesungen haben, versuchte der Generalvikar im Auftrag von Kardinal Höffner, uns die Aufführung zu verbieten. Er wurde mit einer Flut von Protestbriefen überschüttet, so dass er herablassend meinte, er könne ja für die Beantwortung der Briefe eine extra Kraft einstellen. Wir waren in diesem Fall der festen Überzeugung, dass wir besser über Inhalt, Sprache und Musik dieses Stückes Bescheid wussten als der vom Bischof Hermann Volk von Mainz mit der Bewertung Beauftragte. Denn wir hatten uns für das Neue mit Begeisterung geöffnet und das Stück intensiv einstudiert. – Derartige Konflikte gab es immer wieder. Dabei spielte sicher auch ein gutes Stück temperamentbedingte Aufmüpfigkeit eine Rolle. Aber es war mehr noch die Überzeugung, dass nicht der Bischof oder sonst ein Würdenträger die Wahrheit gepachtet hat, sondern dass wir alle gemeinsam dem Maßstab des Neuen Testaments verpflichtet sind. Heute vertreten wieder manche die Position, der Bischof habe zu bestimmen und im Notfall sei sogar Denunziation gefordert. Nach diesem verbindlichen Maßstab ist das eindeutig falsch.
An dieser Stelle hören Priester dann oft: „Aber Sie haben doch dem Bischof Gehorsam versprochen“. Da ist es dringend nötig zu fragen, was für einen Gehorsam man denn meint. Und ich befürchte, dass in vielen Fällen ein militärisches Bild im Hintergrund lauert. Kardinal Meisner hat in den ersten Jahren als Bischof von Köln davon gesprochen, dass er sich unter den Priestern einen „Chorgeist“ wünscht. So geschrieben kann man annehmen, dass das eine Wirkungsweise des Heiligen Geistes ist. Erst nach einiger Zeit kam ich dahinter, dass man dieses Wort vielleicht anders schreiben muss, nämlich „Corpsgeist“. Auch der Geist im Offizierscasino hält die Truppe ja zusammen. Aber militärische Bilder und Handlungsweisen decken sich ja nun wirklich nicht mit der Botschaft Jesu. Auffällig ist allerdings, dass selbst im Neuen Testament relativ häufig militärische Bilder benutzt werden, zum Beispiel wird das gläubige Bemühen mit einem „Kriegsdienst“ verglichen und die Tugenden sind die verschiedenen Teile einer Rüstung. Ich bin zwar nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass ein solches Bild in der Verkündigung Jesu vorkommt. In der Kirchengeschichte sind dann nicht nur kriegerische Bilder benutzt worden, sondern man hielt sich für berechtigt, kriegerisch zu handeln – natürlich im Dienst des Glaubens. Und als in der jüngeren Vergangenheit die Vorbehalte gegen die Kirche zunahmen, meinten gewisse Kreise, die Kirche müsse mit der Geschlossenheit einer Phalanx – einer Schlachtreihe – auftreten. Treffen solche Vergleiche die Realität der Kirche, dann braucht sie natürlich auch eine klare Befehlsstruktur samt der Möglichkeit, uneingeschränkt von oben nach unten durchzugreifen. Und dann ist der Oberbefehlshaber der eigentlich Bestimmende und allein Verantwortliche. Soll ein Priester in diesem Rahmen und auf Grund einer solchen Mentalität gehorsam sein? Dazu habe ich mich nie verpflichtet gefühlt und ich halte eine solche Forderung für nicht erlaubt!
Eigentlich müsste es doch selbstverständlich sein, dass eine Gemeinde eine Würde hat, die nicht angetastet werden darf. Und wenn wir uns als Gemeinde Jesu Christi verstehen, ist diese Würde jedem Glaubenden eigen, vom stillen Beter in der letzten Bank bis zum Papst. Und dann sind die hier formulierten kritischen Anmerkungen notwendig. Schwierig wird es, wenn unterschiedliche Meinungen oder Wertungen zum Konflikt führen. Wir sind gewöhnt, dass solche Konflikte per Machtwort gelöst werden, dem man dann unter Umständen mit Verweigerung antwortet. Wie wäre es, die Lösung in einem Gespräch mit gegenseitigem Vertrauen zu suchen? Das fordert vor allem den Verzicht auf die Vorstellung von der Kommandostruktur. Und die übliche Praxis, dass der Delinquent (Priester) „zitiert“ wird und zu seiner Verteidigung oder Aburteilung erscheinen muss (und die Urteilenden sind dabei zu zweit!), ist unwürdig, und zwar für beide Seiten. Man könnte ja auch verabreden, sich zu einem Gespräch zu treffen, um über das aufgetauchte Problem zu reden. Und wie wäre es, wenn dazu der Weihbischof sich ins Auto setzen würde, um zu diesem Gespräch zu fahren? Eine verrückte Idee? – Oder wenn es nicht um den Leiter der Gemeinde geht, sondern um die Gemeinde selbst. Was macht eine Gemeinde, die sich ihrer Würde bewusst wird, wenn das dem Bischof nicht gefällt? Der könnte ja auf die Idee kommen, dass diese Gemeinde nicht mehr wirklich katholisch, ja dass sie vielleicht sogar evangelisch ist. Er sähe sich dann vielleicht gezwungen, jemanden zu schicken, der diese Gemeinde wieder auf den rechten Weg zurückbringt. Und das wäre die Lösung? Wenn wir nicht eine Teilgruppe der Gesellschaft, sondern wirklich die Gemeinde Jesu Christi sein wollen, gibt es noch viel zu tun. Wir dürfen auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben!
Die Würde befähigt die Gemeinde, die Abhängigkeit von der Gesellschaft zu relativieren. Das Konzil hatte eine große Offenheit für die Belange der Menschen in der Welt von heute. Und auf diese Offenheit reagierten viele mit Interesse und vertrauensvoller Erwartung. Zu dieser Zeit war die Kirche dazu in der Lage, weil das Konzil sich eindeutig auf die Wurzeln der christlichen Botschaft besonnen hatte und den Auftrag Jesu ins Zentrum stellte. Wenn wir begreifen, was uns als Aufgabe anvertraut ist, haben wir keinen Grund, hinter der Gesellschaft her zu laufen und um ihre Gunst zu buhlen. Inzwischen hat der Abbruch der Kirchlichkeit hierzulande ein solches Ausmaß angenommen, dass die Angst umgeht, man habe in dieser Welt und in dieser Gesellschaft nichts mehr zu sagen. Die Reaktionen sind zum Teil recht eigenartig. Da sucht man nach einer Nische für die Vorbereitung auf die Erstkommunion, obwohl die Mehrheit der katholischen Eltern dieses Fest – aus welchen Gründen auch immer – noch will. Da meint ein Kirchenvorstand bei der Umgestaltung der Grundschule zur „Offenen Ganztagsschule“ eifrig mitmachen zu müssen, obwohl es die Gemeinde den gut laufenden Hort kostet. Man will doch nicht, dass der Zug ohne einen selbst abfährt. Da soll sich eine Gemeinde auf dem Handwerkermarkt darstellen. Und die gut aufgemachte Zusammenstellung der Ostergottesdienste soll von vielen Gläubigen in viele Briefkästen, Vereine und Arztpraxen getragen werden. Die Krise der Kirche heute ist sicher schwer und die richtigen Antworten zu finden, macht Mühe. Aber so billig sollte man sich trotzdem nicht verkaufen.
An dieser Stelle muss auch die hoch gehandelte und immer für wichtig gehaltene Öffentlichkeitsarbeit auf den Prüfstand. Wenn man nicht mag, dass der Bericht über das Pfarrfest unmittelbar neben der Leistungsschau des Kaninchenzuchtvereins erscheint, dann ist das vielleicht etwas hochmütig. Aber wenn Reklame nur deutlich machen soll, dass man auch noch da ist, dann ist das sicher zu wenig. Es ist nicht leicht, in einem Bericht über ein kirchliches Ereignis durchscheinen zu lassen, worin das Besondere christlichen Lebens besteht. Aber davon schweigen, das darf man auch nicht.
Eine Gemeinde, die sich ihrer Würde bewusst ist, wird nicht dem Trend nachjagen. Das mussten wir in Hochdahl oft deutlich machen. Denn was alle tun, scheint manchen Leuten ein durchschlagendes Argument zu sein. So haben wir es zum Beispiel erfahren, wenn es um den schon ausführlich beschriebenen Konflikt um die Reihenfolge von Kommunion und Buße ging. Wie oft mussten wir uns da anhören, dass es aber überall sonst anders gehandhabt würde als in Hochdahl. Eigenständigkeit ist angreifbar!
30. Eine Gemeinde wird Heimat
Wir leben in einer mobilen Gesellschaft. Will man ins Kino gehen, sucht man sich einen Film aus, steigt ins Auto und fährt dahin, wo der Film gezeigt wird. Will man einkaufen, besteigt man ebenfalls das Auto und fährt zum Laden, wo man das findet, was man haben möchte. So lebt man heute und auch die Kirche muss oder kann solches Verhalten voraussetzen, wenn es um den Gottesdienst oder sonstige kirchliche Angebote geht. Die Vorstellung von einer Gemeinde, in der man zusammen lebt, ist Romantik von vorgestern. So die modernen Propheten!
Eine leitende Mitarbeiterin im Hochdahler Hospiz verabschiedete sich, um eine neue Tätigkeit anzutreten. Sie bedankte sich bei mir, dass sie so schnell in der Gemeinde heimisch geworden sei, als sie einige Jahre vorher nach Hochdahl kam. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass ich dazu etwas beigetragen hatte. Doch! Ich hätte sie kurz nach ihrer Ankunft in Hochdahl gefragt, ob sie bei der Firmbegleitung mitmachen möchte. Das sei für sie die Möglichkeit gewesen. – In der Tat war die Firmbegleitung eine der zahlreichen Chancen, in Hochdahl Leute kennen zu lernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen über das eigene Leben und den eigenen Glauben. Vor allem die Phase der Vorbereitung vor dem Beginn der Gruppenarbeit war dazu sehr hilfreich. Das Programm sah in dieser Phase drei Treffen vor, ein Abend, ein Samstag und ein Wochenende. Das Wochenende war kurz vor Beginn der Gruppenarbeit mit den Jugendlichen. Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag ging es intensiv um die Thematik; die Begleiter wollten sich darüber klar werden, wie sie die Arbeit mit den Jugendlichen anpacken sollten. Und sie wollten auch zueinander finden, auch weil sie zum Abschluss sich mit zwei anderen Leuten zum Begleiterteam zusammenfinden mussten (zur Firmvorbereitung ausführlich Nr.59). Nach einem solchen Treffen herrschte in der Begleiterrunde oft eine ausgesprochen euphorische Stimmung. Und was immer wieder staunend genannt wurde: Leute, die sich vorher kaum oder gar nicht gekannt hatten, wuchsen in so kurzer Zeit zu einer tragfähigen Gemeinschaft zusammen. Und das „Ja“ zu dieser Gemeinschaft hielt auch, wenn die Arbeit sich als mühsam oder enttäuschend erwies. – Was in der ganzen Gemeinde Menschen immer wieder so zusammenführte, waren die unzähligen Gespräche, Diskussionen und gemeinsamen Erlebnisse – in der Katechese, in der Vorbereitung des Gottesdienstes, bei Fest und Feier usw. Und das ist keine Romantik von vorgestern, sondern reale Erfahrung. Und eine beglückende Erfahrung, weil dadurch Heimat im Glauben und in der Kirche möglich wurde.
Manchmal klagen Neuzugezogene nach einiger Zeit darüber, sie würden keinen Zugang zur Gemeinde oder zu einzelnen Gruppen finden. Diese Klage gab es natürlich auch in Hochdahl. Aber wenn es viele Aufgaben und Gruppierungen gibt, hat man sicher eher eine Möglichkeit Anschluss zu finden. Übrigens ist der Weg über die Mitmachmöglichkeiten auch recht clever: die Leute finden Heimat und gleichzeitig sind viele bereit, sich für die Verlebendigung der Gemeinde einzusetzen. Im Prinzip ist beides für wache Menschen wichtig.
(Zum Thema vgl. auch: Wohlwollende Vertrautheit. Nr.60)
31. Der Dienst des Knechtes
Bei dem Versuch, die Erinnerungen an unsere Arbeit in Hochdahl aufzuschreiben, ging es immer wieder um das Thema der Leitung. Wie haben wir die Leitungsvollmacht des Bischofs erlebt? Wie ist die Diözesanverwaltung mit uns umgegangen? Fast noch häufiger haben wir zu klären versucht, wie wir uns als Gemeindeleiter verhalten haben und welches Bild und welchen Maßstab wir dabei hatten. Und bei diesem Thema gab es plötzlich eine ganz neue Möglichkeit der Deutung und die soll im Folgenden beschrieben werden.
Es war wieder einmal der 19.Sonntag im Jahreskreis und gelesen wurde als Evangelium Lukas 12, 32-48. Ziemlich schnell drängte sich der Eindruck auf, dass in diesem Text von der Aufgabe des Gemeindeleiters die Rede ist. Das war der Anlass, dass ich mich mit diesem Evangelium etwas intensiver beschäftigt habe. Und die Botschaft, auf die ich dabei stieß, erschien mir sehr anspruchsvoll. Und sie war mir keineswegs geläufig, obwohl ich den Text im Laufe meines Lebens immer wieder gehört oder selbst vorgelesen habe. Und die Anwendung auf den Gemeindeleiter (Vers 41 ff) ergab ebenfalls eine neue Perspektive. – Die folgenden Überlegungen sind eine Interpretation. Wenn man sie verstehen will, muss man gleichzeitig das interpretierte Evangelium (Lk 12, 32-48) vor Augen haben.
Das beherrschende Bild des gesamten Textes sind die Jünger, die auf ihren Herrn warten. Im Vers 36 wird es so formuliert: „Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft!“ Die Jünger Jesu sollen wie Menschen sein, die auf ihren Herrn warten! Wenn er kommt und sie wach findet, dann wird er sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und sie werden selig genannt, wenn sie wach sind, auch wenn er erst in der zweiten oder dritten Nachwache kommt. Und dieses Warten muss eine dauernde Haltung sein, „denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.“ Dieser letzte Satz klingt auf Anhieb paradox: auch wenn sie warten, kommt der Herr trotzdem überraschend.
Dieser Stein des Anstoßes führte zu der Frage, was mit diesem Text eigentlich gemeint ist. Und eine naheliegende Interpretation wurde bald sehr fragwürdig. Fast immer verband sich nämlich beim Lesen dieses Evangeliums das „Kommen des Herrn“ mit der Vorstellung von der Wiederkunft Christi. Das ist nicht überraschend. Wenn der Advent naht, dann sprechen die Katecheten von der ersten Ankunft Christi bei seiner Geburt. Das endgültige Kommen geschieht bei seiner Wiederkunft am Ende der Geschichte. Und jeder Glaubende begegnet ihm im Augenblick des Todes. Bei genauerem Hinsehen kann man aber schnell erkennen, dass dieser Zusammenhang hier nicht gemeint ist. Die Rede über die Endzeit steht bei Lukas im 21.Kapitel, und hier sind wir im 12.Kapitel. Und die Texte vor und nach dieser Erzählung sprechen von der neuen Art zu leben, die Jesus Christus fordert und möglich macht. Dann dürfte es in diesem Text um die gleiche Frage gehen. Welche neue Möglichkeit zu leben wird in diesem Evangelium angeboten?
Vielleicht hat Lukas schon vorausgesehen, dass der Leser auf die falsche Deutung mit der Wiederkunft kommen könnte. Denn er sagt ausdrücklich, dass es sich bei diesem Text um ein Gleichnis handelt. In Vers 41 fragt Petrus nämlich: „Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder auch zu allen?“ Es ist auffallend, dass Lukas an dieser Stelle diese Erzählform (Gleichnis) wählt. Es ist nämlich das einzige Gleichnis in einer Reihe von Texten im 11.-13. Kapitel. Alle anderen sind Aufforderungen zu Glauben und Vertrauen, Weisungen an das Volk oder Stellungnahmen zu dem Verhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten. Nur am Anfang des 11.Kapitels (Vers 5-8) und im 13.Kapitel (Verse 18-21) gibt es noch andere Gleichnisse. Es könnte sein, dass die Botschaft dieses Evangeliums durch ein Gleichnis am besten zu vermitteln ist. – Die Beschreibung, wie die Jünger das Kommen ihres Herrn erwarten sollen, gehört zur Bildebene des Gleichnisses, sie ist nicht die eigentliche Aussage, sondern der Vergleich, der in einem Gleichnis immer benutzt wird. Dann muss man die Formulierung genau nehmen: „Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten“. So wie solche Menschen sollt auch ihr sein, von solcher Art und innerer Haltung, von solcher Bereitschaft und Offenheit. Lukas will mit dem Gleichnis eine Mentalität beschreiben, die für die Glaubenden grundlegend und lebensentscheidend ist. Und das ist eine wache, erwartungsvolle Grundhaltung. Und die Spitze des Gleichnisses, was es vermitteln will, wäre dann die Aufforderung: „Seid wach, schaut aus nach dem Mehr in eurem Leben, rechnet mit Fülle und Herrlichkeit und Ewigkeit!! Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten!“ Und eine solche Mentalität ist dann allerdings wirklich die Voraussetzung für alles, was man vom Leben, von Gott, von Jesus Christus erwarten kann. – Dazu fiel mir dann Stephanus ein: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen (Apg 7,56). Auch das ist ein Bild, wie ein Geisterfüllter erkennt, was über alle so genannte Realität hinaus Wirklichkeit ist. – Und wenn man diese Mentalität nicht zu leben versucht, fällt alles hinunter in die Trivialität der vom Menschen produzierten Pseudo-Realität. Denn ohne diesen offenen Blick und das erwartungsvolle Herz kann man weder Jesus Christus zur Rechten des Vaters sehen noch sein Kommen im Geist wahrnehmen – im Leben und in der Gegenwart der Kirche heute.
Wenn es uns bei einer solchen Perspektive schwindelig zu werden droht, dann sollten wir auf die Stellen im Text zurückgreifen, die Lukas vielleicht deshalb an den Anfang gestellt hat, weil sie die Voraussetzung und die Quelle für eine solche Haltung sind. Die Perikope beginnt: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben.“ Steht da im Hintergrund vielleicht die Erfahrung des Lukas, dass schon zu seiner Zeit es für die kleine Herde schwierig war, unbekümmert in die Zukunft zu gehen? War vielleicht damals schon deutlich, wie gefährdet der Glaube in einer auftrumpfenden Welt ist? „Fürchtet euch nicht!“ In der Entscheidung und Macht des Vaters seid ihr geborgen, er hat beschlossen, euch das Reich zu geben. – Und auch die beiden folgenden Verse kann man als Stärkung in schweren Zeiten verstehen. Wer seinen Schatz im Himmel hat, braucht die Bedrohungen des Tages nicht zu fürchten. Und diesen Schatz kann man sich verschaffen, indem man den Besitz verkauft und Almosen gibt. Das ist eine Botschaft, die im Evangelium immer wieder auftaucht: nicht der Besitz an Geld und Macht rettet, sondern der „Himmel“. Wer seinen Schatz dort hat, ist gesichert. Dort findet ihn kein Dieb und frisst ihn keine Motte.
Mit der Frage des Petrus in Vers 41 kommt der „Gemeindeleiter“ in den Blick. Petrus fragt: „Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder auch zu allen?“ Und Lukas benutzt zwei verschieden Titel für den, der die Verantwortung hat für andere Glaubende. Er nennt ihn Verwalter oder Knecht. „Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde einsetzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt“. Das Wort „Tagesration“ ist für mich eine ärgerliche Entgleisung in der neuen Einheitsübersetzung. Das Wort kann man benutzen, wenn der Küchenchef berechnet, wie viel er für seine 300 täglichen Gäste bestellen muss. Im Text des Lukas wird der Verwalter eingesetzt, damit er seinem Gesinde Tag für Tag gibt, was sie zum Leben brauchen. Und selig ist der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. – Dieser Knecht, dieser Verwalter muss in seinem Dienst genauso geprägt sein von der erwartungsvollen Mentalität, die der Text von allen Glaubenden fordert. Und was er ihnen Tag für Tag gibt, dient dem gleichen Ziel. Die Haltung, die er selbst hat, soll in seinem Dienst darauf ausgerichtet sein, dass die Glaubenden nicht nachlassen in ihrem erwartungsvollen Ausschauen. Er muss sie immer wieder ermutigen und befähigen. „Seid wach, schaut aus nach dem Mehr in eurem Leben, rechnet mit Fülle und Herrlichkeit und Ewigkeit!! Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten!“ So ähnlich könnte seine Verkündigung an dieser Stelle lauten. So ähnlich kann er seinen Dienst vollziehen, um den Gläubigen den Weg in das „Mehr“ des menschlichen Lebens offen zu halten – mit hellem Blick, offenem Geist und brennendem Herzen.
Dieser Dienst des Knechtes ist gefährdet durch persönliches Versagen oder vielleicht auch durch gemeinsame kirchliche Verkümmerungen. Die Nähe des Herrn und die Offenheit für die Fülle des menschlichen Lebens geraten in Vergessenheit, die Spannkraft erlahmt: mein Herr kommt noch lange nicht zurück! Dann werden die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Machtphantasien zum Maßstab. Dann endet es schlimm! Lukas formuliert das auch sehr drastisch: der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. – Bei den letzten Versen (47+48) habe ich den Eindruck, dass Lukas mit diesem Horrorszenario nicht schließen wollte. Er formuliert den Unterschied zwischen einem Knecht, der den Willen des Herrn kennt und nicht danach handelt und einem, der den Willen des Herrn nicht kennt. Und für das Versagen droht dann nicht mehr das „in Stücke hauen“, sondern mehr oder weniger Schläge. Den Vers, mit dem er schließt, kann dann wohl jeder wieder unterschreiben: Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen.
Von Anfang an bin ich ganz unbekümmert davon ausgegangen, dass man dieses Evangelium auf die Mentalität und Aufgabe des Gemeindeleiters anwenden kann. – In Vers 41 fragt Petrus: „Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder auch zu allen?“ Mit „allen“ sind eindeutig alle gemeint, die der Verkündigung Jesu zuhören. Mit „uns“ meint Petrus zweifellos die Jünger, die eine Leitungsfunktion haben. So ist ja auch die Antwort Jesu zu verstehen, die sofort von dem „Verwalter und seinem Gesinde“ spricht. – Im Bild des Gleichnisses hat man spontan den Eindruck, dass es sich bei dem „Gesinde“ um eine überschaubare Gruppe handelt. Und der „treue und kluge Verwalter“ gibt ihnen Tag für Tag, was sie zum Leben brauchen, das heißt er kümmert sich in andauerndem Dienst um „seine Gemeinde“. Und dadurch kann er dem hohen Ziel seiner Aufgabe gerecht werden, dass die Seinen nicht nachlassen in dem erwartungsvollen Ausschauen. Die Botschaft dieses Evangeliums muss man in die heutige Zeit und in die Situation der Kirche heute übertragen. Dabei dürfte es unverändert um die überschaubare Gruppe gehen, in der der Verwalter seinen Dienst vollzieht. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die Großstrukturen wie Diözese oder sogar Weltkirche einen solchen Dienst leisten können. Dann ist es aber berechtigt, das Evangelium auf die Gemeinde und ihren Leiter anzuwenden. – Demnach muss dann der Gemeindeleiter – wie alle anderen Glaubenden – sein wie ein Jünger, der auf seinen Herrn wartet. Er muss diese erwartungsvolle Mentalität haben. Und in dieser Haltung muss er der Gemeinde dienen, ihr immer wieder geben, was sie zum Leben braucht, was ihr hilft, ihrerseits die Augen und das Herz offen zu halten. Verhält er sich so, wird ihm eine große Belohnung zuteil, der Herr wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Verliert er diese Offenheit, dann ist sein Leben in Gefahr. Erwartungsvolle Mentalität und Dienst an der Gemeinde – das ist die Aufgabe des Gemeindeleiters.
Zum Schluss ein paar Beispiele, wie eine solche Mentalität im Gottesdienst der Gemeinde und in manchen tiefgehenden Erlebnissen erfahren und gestärkt werden kann.
Die Gemeinde hat ihren Mittelpunkt in der Feier des Gottesdienstes. In der Feier der Eucharistie empfängt sie immer wieder den Geist und die Kraft für das gemeinsame Leben. Dort empfängt sie immer wieder ihren Maßstab und ihre Orientierung. Und es scheint, dass der Gottesdienst auch der bevorzugte Ort für den „Dienst des Knechtes“ ist. Die Verkündigung kann etwas haben von der Ermutigung: „Seid wach, schaut aus nach dem Mehr in eurem Leben, rechnet mit Fülle und Herrlichkeit und Ewigkeit!! Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten!“ Und die Kraft zu solcher Stärkung der Glaubenden kann er empfangen aus einem vertieften Verständnis der Botschaft des Evangeliums, das ihm ermöglicht, selber die erwartungsvolle Mentalität zu leben. – Und wie müsste dann die Feier der Eucharistie vollzogen werden, die ja diesen weiten, ewigen Horizont gegenwärtig werden lässt gerade in der tiefsten, tödlichen Not? Dabei kann es doch nicht in erster Linie um das genaue Einhalten von Vorschriften gehen. „Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes“ lautet ein Satz im Einsetzungsbericht. Der ist ein Zitat aus dem Propheten Jeremia (Jer 31,31 – 34). Und der Prophet verheißt dem Volk Israel einen neuen Bund, in dem die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk aus dem tiefsten Innern gelebt wird, eine Gemeinschaft des Geistes und des Herzens. Die erwartungsvolle Mentalität, von der Lukas spricht, vollzieht sich offensichtlich in der Eucharistie, indem die Gläubigen essen und trinken und darin ihren Glauben an den nahen Herrn und die Fülle des Lebens bezeugen.
Gibt es für diese theologische Interpretation auch Erfahrungen, in denen man diese Offenheit und diese Sehnsucht nach der Fülle des Lebens lebensmächtig erlebt? Solche Erfahrungen würden uns ja den Zugang zu diesem Evangelium erleichtern. Ein paar Versuche:
Vor kurzem war ich in einem Konzert, in dem ein junger Pianist die zwei Klavierkonzerte von Mendelssohn spielte. Und beide, der Pianist und das begleitende Kammerorchester, waren technisch perfekt. Aber sie waren mehr als perfekt! Es war, wie wenn alle Mitwirkenden (40 bis 50 Personen) von einem gemeinsamen Geist getragen wären. Und dabei hatte das Orchester nicht mal einen Dirigenten – und der war auch überhaupt nicht nötig. Nicht „Musik vom Besten“, sondern Musik über Technik, Perfektion, Können hinaus – und über alles andere, was man in Begriffe fassen kann. – Eine Erfahrung von der Fülle und Schönheit des Lebens, die den Wunsch nach dem „Mehr“ weckte.
Oder wenn wir „Ave Eva“ oder „Franz von Assisi“ gesungen haben. In den Erzählungen darüber habe ich oft geschrieben, es sei ein Fest des Glaubens gewesen. Was man davon definieren kann, ist einiges: die hervorragenden Texte von Wilhelm Willms, die schmissige Musik von Piet Janssens, die Choreografie mit Blumen und Wein (bei Ave Eva) oder mit dem Leichenzug (bei Franziskus). Weiter beschreibbar ist, welche Rolle die innere Beteiligung von Chor und Combo und die Aufnahmefähigkeit des Publikums spielt. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer mittelmäßigen Aufführung und einem solchen Fest des Glaubens? Da muss noch etwas sein, was sich der Definition entzieht, was im Erleben froh macht oder in der Tiefe begeistert – eine Erfahrung von Fülle und Schönheit des Lebens, die offen macht für das nicht Definierbare, das Wunder, das Menschliche über das hinaus, was wir selber produzieren.
Oder manche Firmgottesdienste. Auch da lässt sich manches beschreiben, was in der Vorbereitung auf die Firmung geschieht und was an Erhebendem in die Feier eingeht. Eine große Rolle spielen die Erfahrungen von Gemeinschaft und Begegnung und Kennenlernen in den Gruppen und bei den Wochenenden. Und die Erkenntnis, dass solche Begegnungen mehr sind als das, was man in Gruppenanalysen oder sozialen Beschreibungen lesen kann. Und die ganze Zeit geht es auch thematisch um das „Mehr“ im menschlichen Leben. Die Begegnung mit dem Evangelium macht dann vielleicht schon den Blick offen für die Möglichkeit der Begegnung mit dem Unsagbaren. Und dann ist die Firmung die Zusage und Annahme dieser Wirklichkeit über alles hinaus. Wer es kann, wird vielleicht spüren, dass die Sprache vom Geist Gottes und der Befähigung der Glaubenden etwas meint, was über alles nur Menschliche hinausführt, was etwas verheißt von Fülle und Herrlichkeit und Größe Gottes.
32. Der Gemeindeleiter ist auch nur ein Mensch.
Als ich vor einigen Jahren in den Ruhestand ging, war es sehr schwer, den Menschen in der neuen Umgebung den „Herrn Pfarrer“ abzugewöhnen. Auch nach einigen Jahren konnte es immer noch passieren, dass jemand „Herr Pfarrer Staßen“ sagte. Irgendwann habe ich dann nur noch geantwortet: „Ich habe einen Namen, ich brauche keinen Titel.“ Und als ich dann 2017 nach Hochdahl (in die Seniorenwohnanlage) zurückkehrte, wurde ich immer mit meinem Namen angeredet, wenn ich Leute aus der Gemeinde traf – mit wenigen Ausnahmen. Das haben wir gut hinbekommen, habe ich mir gedacht. Das begann 1972. In dem Jahr haben wir mit Einverständnis von Generalvikar Nettekoven beschlossen, dass das Team als Ganzes die Leitung der Gemeinde übernehmen sollte (vgl.Nr.20, Team 2). Dadurch fiel die Differenzierung in Pfarrer, Kaplan und Diakon weg. Und deshalb war es dann auch nicht mehr möglich, diese Titel in der Anrede zu benutzen. Der Name genügte. – Warum ist die Titulatur im Klerus der Kirche nach wie vor so selbstverständlich? Und wie will man bei dieser Praxis verhindern, dass der Geistliche doch wieder im Heiligenschein erscheint? – Ich vermute, dass diese Gewohnheit der Intention des Neuen Testaments widerspricht. Zumindest an einer Stelle wird das ausdrücklich gesagt. In Mt 23,8-10 heißt es: „Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.“ Wenn man diese Anweisung ernst nimmt, weiß ich nicht, wieso allenthalben in der Kirche Titel, Amtsbezeichnungen und Ehrenerweise eine solche Rolle spielen. – Die Entscheidung in dieser Frage ist nicht nebensächlich, wenn es um eine brüderliche Gemeinde geht. In einer solchen Gemeinde ist nämlich jedes Mitglied gleich wichtig. Und die Gemeinschaft wird lebendig, wenn jeder seine ihm eigene Fähigkeit, die ihm geschenkte Gabe des Geistes, im Dienst an den Anderen verwirklicht. Und dann stört es, wenn einer ein besonderer Bruder ist.
„Ihr alle aber seid Brüder“. Wir, die Gemeindeleiter, haben uns die ganzen Jahre hindurch als Mitglieder der Gemeinde erlebt und interpretiert. Wir hatten nie die Vorstellung, außerhalb der Gemeinde zu stehen. Und wir waren nie der Meinung, würdiger, besser oder gar heiliger als die Anderen zu sein. Ab und zu tauchte bei älteren Leuten zwar noch die Erwartung auf, die Geistlichen müssten doch eigentlich das – vorbildhaft – leben, was der normale Sterbliche nicht kann. Diese Vorstellung habe ich aber nie übernommen. Ich konnte weder die darin enthaltene Ehrerbietung schätzen noch die geforderte Untadeligkeit leisten. – Im 10. Kapitel der Apostelgeschichte wird erzählt, dass der Hauptmann Cornelius sich vor Petrus zu Boden wirft. Und Petrus hebt ihn auf mit dem Satz: „Auch ich bin nur ein Mensch“. Als das wieder einmal vorgelesen wurde, erzählte jemand hinterher, er habe im Fernsehen gesehen, wie sich der neu ernannte Kardinal vor dem Papst niedergekniet habe. Er hätte sich gewünscht, der Papst hätte das verhindert mit der gleichen Bemerkung: „Auch ich bin nur ein Mensch“. – Auch in der Verkündigung sind wir davon ausgegangen, dass unsere Lebenssituation grundsätzlich die gleiche ist wie die der anderen Glaubenden. Wenn ein Prediger so tut, als habe er alle Lösungen in der Tasche und brauche sie nur hervorzuzaubern, dann ist er unglaubwürdig. Es kann auch nicht richtig sein, die ewigen Wahrheiten so zu formulieren, als ob sie im eigenen Leben schon verwirklicht würden. Der Verkündiger steht nicht über den Anderen, gewissermaßen neben dem Throne Gottes, und schaut von oben herab auf die Niederungen des einfachen Volkes. Wenn schon „Niederungen“, dann steckt er genauso im Sumpf wie alle anderen. Das bedeutet auch, dass in der Verkündigung die Unsicherheit des Glaubens und die Grenzen der menschlichen Erkenntnis vorkommen müssen. Keiner hat Gott je gesehen (Joh 1,18). Und wenn das „Wort“ uns Kunde gebracht hat, dann ist das eine Sache von Glauben und Vertrauen diesem Jesus Christus gegenüber und nicht von Beweisen im üblichen Sinne. Und wir haben auch keine Möglichkeit, über die Todesgrenze hinauszugreifen und diese Not belastet alle Glaubenden. Der Prediger muss aus seinem Leben heraus versuchen, die Balance zu halten zwischen der Verkündigung des Lebens und der Realität dieser Hinfälligkeit. Wenn er sich selbst immer wieder dieser Spannung aussetzt, kann das für die Hörer zur Ermutigung werden. Wir alle haben für unser Leben dieselben Bedingungen und wenn man das verschweigt, hilft das keinem.
Wir wollten und konnten immer mit der Gemeinde leben. Man kann zwar auch als „Pfarrherr“ seinen Platz in der Pfarrei finden. Aber uns war es wichtig, in einem Geflecht von Beziehungen mit den Menschen verbunden zu sein und Belastungen und Hoffnungen miteinander zu teilen. Das ergab sich sicher auch aus dem grundlegend menschlichen Bedürfnis nach Geborgenheit und Beheimatung. Aber in der heutigen Situation der Großpfarreien ist eine der größten Gefahren, dass Geistliche zu Funktionären werden, wenn sie keine unmittelbare Anbindung an eine überschaubare Gemeinschaft von Glaubenden mehr haben. Warum ist die vertrauensvolle Gemeinschaft zwischen Gemeinde und Gemeindeleiter verdächtig? Warum soll es gut sein, dass der Geistliche seine Stelle wechselt, wenn er anfängt, sich an einem Ort wohl zu fühlen? Warum muss der alt gewordene Mensch seine vertraute Umgebung verlassen, wenn er in den Ruhestand geht? Die zugrundeliegende Ideologie muss auf den Prüfstand!
33. Keine Ministersessel!
Von Pius X soll der Ausspruch stammen: „ Der Priester ist so hoch über den Gläubigen wie der Himmel über der Erde.“ Diese Aussage wurde in den Zeiten des Konzils zitiert, um die Stärke des Umbruchs zu verdeutlichen, der mit der wiederentdeckten Würde aller Gläubigen und der Einheit des gesamten Gottesvolkes stattgefunden hatte. Der Spruch macht auch deutlich, wie sehr zeitgebundene Vorstellungen die Botschaft des Evangeliums verdecken können. Denn das Evangelium sagt etwas ganz anderes als Pius X.
Jakobus und Johannes haben einen Wunsch. Nachzulesen im Markusevangelium Mk 10, 35 – 45. Bei dem lebens- und kirchenerfahrenen Matthäus ist es die Mutter der beiden, die den Wunsch äußert. Die beiden sollen bzw. wollen rechts und links neben Jesus sitzen in seinem Reich. Sie wollen sich Ministersessel reservieren. Man kann diesen Wunsch verständlich finden. Denn wer möchte nicht wichtig sein und etwas zu sagen haben. Und da unterscheiden sich die Jünger offensichtlich überhaupt nicht von uns allen. Zudem wollen sie ja neben dem Meister sitzen. Sie wollen in seiner Nähe, in seinem Auftrag handeln; gehören sie doch schon seit einiger Zeit zu seiner Gefolgschaft.
„Ihr wisst nicht, um was ihr bittet.“ Die Reaktion Jesu ist deutlich. Gegen das Ansinnen der beiden stellt er sein eigenes Lebensschicksal, seine Hingabe bis zum Tod. Und Jesus verteilt keine Ministersessel!
Und dann folgt die grundsätzliche Regel für den gesamten Jüngerkreis, verbindlich für die Apostel, die Gemeindevorsteher der jungen Kirche und die Amtsträger der Kirche heute. „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein…“
Es gibt im Evangelium noch mehrere Stellen, wo erzählt wird, wie groß die Gefahr für die Jünger Jesu ist, herrschen zu wollen. „Sie hatten unterwegs darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei.“ (Mk 9,34) Und es ist für Jesus offensichtlich ein großes Anliegen, sie vor dieser Gefährdung zu bewahren. An dieser Stelle bei Markus ist es ein Kind, das ihnen die richtige Haltung vor Augen führen soll.
Das Wort „Ministersessel“ könnte dazu verführen, diese Gefährdung für uns heute zu unterschätzen. Wer will schon Minister werden? Aber in der Kirche Karriere zu machen, ist doch offensichtlich für manche etwas durchaus Positives. Ich denke, dass dieses Bedürfnis auch unter das Verdikt Jesu fällt. Viel verbreiteter scheint mir allerdings die Gefahr, dass man in der Pfarrei einem autoritären System vorsteht. Das ist deshalb so gefährlich, weil der betreffende Leiter der Pfarrei (ich habe ihn schon öfter mit dem Titel „Pfarrherr“ versehen) sich eines Herrschaftsverhaltens überhaupt nicht bewusst ist. Man hat die Aufgabe der Leitung, man hat die theologischen Kenntnisse, man hat die Weihe, man hat die Verantwortung und man hat die Verpflichtung zu entscheiden. Und wer die Verantwortung dann als Druck erlebt – und wenn Enttäuschung und Angst dazu kommen – dann erscheint ein autoritäres Verhalten oft als Rettung in der Not. Man meint es gut und gibt sich viel Mühe und prägt einen autoritären Laden. Denn auch die „Untergebenen“ eines solchen Leiters reagieren systemkonform. Schüler wissen zum Beispiel sehr schnell, wie sie mit einem autoritären Lehrer umgehen müssen, damit sie schadlos über die Runden kommen: sich ducken, wenn es Gewitter gibt – sagen, was der Chef wahrscheinlich hören will – nicht erkennen lassen, was man wirklich meint – wissen, wer in der Gruppe auf der eigenen Seite steht und wer nicht. Die weniger cleveren Typen werden sich vor allem ängstlich in sich selbst zurückziehen. Die Schüler reagieren angepasst und unterstützen dadurch das System.
Es gibt deutliche Anzeichen, wenn eine Pfarrei autoritär strukturiert ist. Dann haben Gemeindemitglieder Angst, dass ihre Meinung öffentlich werden könnte und bitten in der entsprechenden E-Mail, doch dies oder jenes nicht weiterzugeben. Dann taucht immer wieder im Gespräch das Argument der „Tradition“ auf: „das haben wir immer so gemacht“. Das erspart den Gesprächspartnern die Klärung, was jetzt besser getan werden sollte. Denn dabei könnte man ja dem anderen unterlegen sein. Dann wird wichtig, welche Position man in der Pfarrei einnimmt; und die erworbene Position stärkt man immer wieder durch erkennbare Anstrengungen. Dann werden Zuständigkeiten wichtig – auch wenn die Zuständigen das, was man von ihnen erwartet, überhaupt nicht leisten können. Man mault und wäscht sich die Hände in Unschuld. Der Fehler liegt im System und nicht an der Bosheit der Menschen.
Hat sich ein solches System aber etabliert, ist es sehr schwer zu heilen. Das erste ist sicher die Erkenntnis, dass es sich um ein Herrschaftssystem handelt. So lange man den Status quo verteidigt, indem man auf den eigenen guten Willen verweist, gibt es keine Chance. Die befreiende Alternative heißt vermutlich Kommunikation. Und damit ist nicht gemeint die Information über die Veranstaltungen in der Pfarrei und auch nicht der große Plan im Büro, in dem alle diese Veranstaltungen eingetragen werden. Gemeint ist ein anderes Bild von Gemeinde, in dem jeder mit seiner Gabe zu Wort und Wirkung kommen kann und wo die vielen Gaben sich zu einem gemeinsamen Erkenntnis- und Entscheidungsprozess vereinigen können. Über diesen Weg ist ja schon hinlänglich gesprochen worden.
34. Die Praxis der Gemeindeleitung
Wir kamen nach Hochdahl mit dem Auftrag, die zukünftige Pfarrei St.Franziskus aufzubauen. Wir haben zwischenzeitlich immer wieder darüber gesprochen, von wie viel Zufälligkeiten diese Beauftragung abhängig gewesen ist. Aber wir haben den Auftrag angenommen und danach nie ernsthaft in Frage gestellt. Und obwohl wir uns immer als Mitglieder der Gemeinde gefühlt und interpretiert haben, waren wir uns trotzdem bewusst, dass wir eine andere Aufgabe hatten als die vielen anderen Gemeindemitglieder. Wir sollten ja die Gemeinde leiten. Dabei sind wir sicher auch nicht der Gefahr entgangen, uns manchmal wie die Herren zu benehmen. Vor allem meine lautstarken emotionalen Stellungnahmen haben oft die Gesprächsteilnehmer belastet. Ich hoffe aber, dass zwischendurch auch immer wieder erfahrbar geworden ist, dass wir uns eigentlich als Diener der Gemeinde verstanden haben.
Wie haben wir die Gemeinde geleitet? Dazu ist sicher in dem bisher Erzählten schon vieles angeklungen (Suchen und fragen – Wer mitmacht, erlebt Gemeinde – Gemeindekatechese – Team usw.). Hier soll es um einige Grundlinien gehen.
Wir haben an die Menschen geglaubt und das nicht nur theoretisch und grundsätzlich, sondern ganz konkret und praktisch. Wir haben daran geglaubt, dass jeder in der Gemeinde seine spezielle Gabe von Gott hat, die für den Aufbau der Gemeinde unverzichtbar ist. Und wir haben immer wieder einzelne Leute gefragt, ob sie nicht bei der Vorbereitung auf die Sakramente, bei der Liturgie, bei der Verwaltung eine Aufgabe übernehmen wollten. Vielfach waren das Eltern von Kindern oder Jugendlichen, die sich auf Kommunion oder Firmung vorbereiteten. Oft waren es aber auch Männer oder Frauen, die uns in irgendeinem anderen Zusammenhang aufgefallen waren. Wenn jemand ablehnte – aus Zeitmangel oder auch ohne weitere Erklärung – haben wir das fraglos akzeptiert. Wenn jemand sich eine bestimmte Tätigkeit nicht zutraute, haben wir das miteinander besprochen und ihm Mut gemacht. Und die, die mitmachten, haben wir dann intensiv begleitet. Das hielten wir für eine wichtige Aufgabe, die wir als Leiter der Gemeinde hatten. Sehr erfreulich war, dass im Laufe der Jahre immer mehr Leute aus der Gemeinde auch in Leitungsfunktionen hineinwuchsen. Die „Begleitung der Begleiter“ bei Kommunion, Buße und Firmung war dann immer eine gemeinsame Arbeit von einem Geistlichen und ein oder zwei Mitgliedern der Gemeinde. Und vor allem bei der kindgerechten Gestaltung eines Themas, bei der Umsetzung in Bilder und Symbole, waren manche Laien dem Theologen haushoch überlegen. Das hat Spaß gemacht, sowohl dem Theologen als auch den beteiligten Katecheten. Manche Gruppen, wie zum Beispiel der Taufarbeitskreis, haben nie einen der offiziellen Gemeindeleiter für ihre Arbeit benötigt.
Wir haben an die Botschaft geglaubt. Kein Mensch wird die ganze Fülle der Botschaft Jesu in seinem Leben realisieren können. Wenn ich heute überlege, welche Elemente für mich wichtig waren, dann springt zuerst die Botschaft von der Kirche in den Blick. Wir haben daran geglaubt, dass man in der Kirche, so wie wir sie durch das Studium und das Konzil kennen gelernt hatten, leben konnte. Es war das Angebot einer Gemeinschaft, in der jeder mit seinen Möglichkeiten und tiefsten Wünschen zu Wort kommen konnte. Die Vielfalt und Verschiedenheit war nicht vor allem Problem, sondern gottgewollt und von unschätzbarem Wert. Und die Verheißung lautete, dass diese Verschiedenheit nicht zum Kampf aller gegen alle führen musste, sondern zu einem gegenseitigen Dienst. Was ist das für ein Kontrastprogramm zu der fast allein herrschenden Ideologie der gewaltsamen Beseitigung aller Unterschiede! Und in dieser Kirche sollte nicht mehr Über- und Unterordnung das wichtigste Verhaltensmuster sein. Befehl und Gehorsam sollten durch die gemeinsame Bereitschaft ersetzt werden, sich vom Geist Gottes führen zu lassen. Die skrupulöse Angst, sich gegen irgendeine moralische Vorschrift vergangen zu haben, sollte durch das kindliche Vertrauen auf den liebenden Vater geheilt werden. – Ebenso wichtig war die Erneuerung der Liturgie durch das Konzil. Ich habe in jungen Jahren noch die verkümmerten Formen der Messfeier erlebt. Der Priester vollzog zum Beispiel vorne am Altar leise das heilige Geschehen und im Kirchenraum beteten die Frauen den Rosenkranz. Als Jugendlicher habe ich – nicht ohne Anwandlungen von Stolz – die liturgischen Texte auf Deutsch vorgelesen, die der Priester gleichzeitig vorne lateinisch betete. Und die Erinnerung an das „Asperges me“, den immer gleichen Beginn des Hochamts, wenn der Priester Weihwasser versprengend von vorne nach hinten und wieder nach vorne ging, ruft bis heute ärgerliche Reaktionen hervor. Und demgegenüber der Vollzug des gemeinsamen Gottesdienstes, in der Muttersprache, für alle verständlich! Das Entscheidende war nicht mehr die vermeintlich ehrwürdige Geschichte, sondern das Leben heute in der aktuellen Begegnung mit dem lebendigen Gott. – Aus dem Studium blieb wichtig die zentrale Bedeutung der Heiligen Schrift. Ich bin relativ schnell davon losgekommen, die Bibel als „fromme Geschichten“ zu deuten. Was Heinrich Schlier in seinen Vorlesungen und Seminaren vermittelt hat, prägt mich bis heute. Und auch die samstäglichen Einführungen in den Sonntag durch Joseph Falke, den Direktor des Leoninums in Bonn, erschlossen die Botschaft für das Verständnis eines denkenden Menschen. Es sind heute natürlich Selbstverständlichkeiten, dass man die Eigenart biblischer Sprache, die literarische Eigenart eines Textes, die „Spitze“ eines Gleichnisses berücksichtigen muss, um die biblische Erzählung richtig zu interpretieren. Aber es bedarf nach wie vor einer beträchtlichen Anstrengung, um die Botschaft für uns heute fruchtbar zu machen.
Wir hatten einen verbindlichen Maßstab. Wir wollten nicht irgendeine Kirche, sondern eine Gemeinde nach dem Willen und den Vorstellungen Jesu Christi. Über dieses Fundament haben wir nie mit uns verhandeln lassen. – Wie weit es uns gelungen ist, die Gemeinde in Hochdahl nach der Botschaft des Evangeliums zu prägen, ist natürlich nicht nachweisbar. In Gesprächen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, wurden manchmal Zweifel laut, ob wir nicht zu hoffnungsvoll oder sogar selbstsicher gewesen sind. – An anderer Stelle tauchte manchmal der Vorwurf auf, wir hätten zwischen den in der Theologie formulierten Merkmalen der Gemeinde – Verkündigung, Liturgie und Diakonie – kein ausgeglichenes Verhältnis entstehen lassen. Die Verkündigung habe die Gemeinde in entscheidendem Maße geprägt. Dabei sei die Diakonie deutlich zu kurz gekommen. „Wir kümmern uns um die Ärmsten der Armen“, ließ sich dazu eine Stimme aus dem SKFM hören. Ich habe das als Kritik aufgenommen und die Aussage hat mich beunruhigt. Aus der Distanz von heute glaube ich, dass es durchaus richtig war, wenn die Verkündigung im Vordergrund stand. Denn das bedeutet doch, dass die Botschaft des Glaubens der Maßstab der Seelsorge ist. Dann hätte sich allerdings der Glaube in der Liebe zeigen und verwirklichen müssen. Wenn das im Gesamtbild der Gemeinde nicht so deutlich sichtbar geworden ist, dann hat vielleicht doch etwas gefehlt. Allerdings sollte man bei dieser Betrachtung nicht vergessen, dass nicht alles, was an gegenseitiger Hilfe und an Beistand in Notfällen geschieht, auch an die Öffentlichkeit dringt.
Manches, was möglich gewesen wäre, haben wir nicht gewollt. Als Gerd Verhoeven und ich in München studiert haben, gingen wir manchmal um 10 Uhr nach St.Michael in den Gottesdienst. Und es hieß, viele der Gottesdienstbesucher kämen mit dem Konzertführer unter dem Arm in die Messe. Denn die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatte ein hohes Niveau. Manche Menschen begrüßen es, wenn sie eine solche Pflege der Schätze der Vergangenheit erleben dürfen. Und manche Gemeinden scheinen sich diesen Dienst ausdrücklich auf ihre Fahnen geschrieben zu haben. Das war nicht unsere Vorstellung von der Aufgabe der Gemeinde. Der Auftrag Jesu: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ ist der Grund, weshalb wir Gottesdienst feiern. Und Musik – und alle Kunst – hat ihre Berechtigung, wenn sie dieser Erinnerung dient. – Ähnlich war unser Bewertung der religiösen Bedürfnisse der Gläubigen. Vor Jahren unterhielt ich mich mit einem Kollegen über die richtige Form der Seelsorge. Er meinte, die Leute brauchten den „Stallgeruch“, um sich in der Kirche wohlzufühlen. Etwas Ähnliches taucht für mich auf, wenn in katholischen Gegenden landläufig mehr „Feierlichkeit“ gewünscht wird. Der „fromme Schauer“, der einem den Rücken hinunterläuft, ist dann nicht mehr fern. Es geht nicht darum, Bedürfnisse grundsätzlich schlecht zu machen. Aber die Gefahr ist groß, dass die tieferen, eigentlichen Bedürfnisse zugeschüttet werden, wenn man allzu leichtsinnig auf Emotionen setzt. – Auch gegenüber der politischen Verantwortung der Gemeinde war ich sehr skeptisch. Wir haben zwar in den Ausschüssen des Stadtrates mitgewirkt, aber ich habe dieser Tätigkeit nie allzu große Bedeutung beigemessen. Dahinter stand die Vorstellung, dass wir das Beste für die Stadt tun würden, wenn wir unseren eigentlichen Auftrag nach Kräften erfüllen. – An anderer Stelle wurde schon erwähnt, dass wir auch gegenüber den kirchlichen Lebens- und Organisationsformen der letzten Jahrhunderte sehr zurückhaltend waren. Der Verbandskatholizismus und das kirchennahe oder kirchenferne Vereinsleben schien uns für die neue Stadt nicht zukunftsfähig zu sein. Wir wünschten uns Gemeinschaften, die sich auf dem Boden der Gemeinde aus der Kraft des Glaubens finden würden
Wir haben nicht für die Menschen gedacht, sondern mit ihnen. Als Beispiel kann das Heft der Aspekte „Zu Millrath-Ost“ von Januar 1981 dienen, aus dem schon an anderer Stelle das Gemeindekonzept zitiert wurde. Dieses Heft diente der Vorbereitung einer Pfarrversammlung, bei der über die Frage diskutiert und entschieden werden sollte, was aus dem Bauvorhaben Millrath-Ost werden sollte. Die Redaktion der Aspekte schrieb zur Einleitung: „Diese Entscheidung sollte nicht von einigen Wenigen getroffen werde, von der Gemeindeleitung, dem Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand, oder von denen, die immer vorne dabei sind. Je größer die Beteiligung der Gemeinde, umso besser (auch deshalb, weil die finanzielle Belastung von einigen wenigen überhaupt nicht zu verkraften ist).“ Und dann folgen in dem Heft sehr vielfältige Informationen und Überlegungen, damit die Mitglieder der Gemeinde sich ein Bild machen und eine möglichst sachgerechte Entscheidung treffen können. Und die Gemeinde hat die Aufforderung zum Mitdenken und Mitentscheiden aufgenommen. Ein großes Interesse an dem Bau, eine sagenhafte Spendenfreudigkeit und ein Unmaß von freiwilliger Arbeitsleistung waren das Ergebnis. Und für viele war deshalb nach der Fertigstellung das Roncalli-Haus „Unser Haus“. – Dieses Vorgehen haben wir an vielen Stellen praktiziert. Stießen wir als Gemeindeleitung auf eine wichtige Frage, dann haben wir natürlich auch im Team, im Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand darüber diskutiert. Aber immer wieder haben wir dann die Gemeinde informiert und gemeinsam nach der Antwort gesucht. Den Leuten nur fertige Lösungen zu präsentieren, hielten wir für eine Missachtung der „mündigen Christen“. – Und wenn wir uns vor Ostern zur Vorbereitung der Kar- und Ostertage zusammensetzten, kam keiner mit einem fertigen Konzept oder gar einem ausgearbeiteten Ablauf – weder der Pfarrer noch sonst einer der Teilnehmer. Was hätte dann auch der Heilige Geist oder unsere Kreativität noch für eine Chance gehabt? Es ging um die Frage, wie wir Sterben und Auferstehung Jesu in diesem Jahr verstehen könnten – und dann haben wir danach gesucht, wie wir es deuten und formulieren und in Bilder bringen konnten.
Wir wollten ermutigen, nicht kontrollieren. Das Motto „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“ war für diese Haltung eine griffige und einprägsame Formulierung. Da die Mitglieder der Hochdahler Gemeinde von Anfang an sehr intensiv miteinander im Gespräch waren, tauchten natürlich auch viele Ideen und Wünsche auf. Aber dieses Gespräch war auch eine Möglichkeit der Klärung. Allzu viele abwegige Vorstellungen sind nach meiner Erinnerung überhaupt nicht formuliert worden. Und wenn es einmal vorkam, dann konnte man damit rechnen, dass im Miteinander Brauchbares und Unbrauchbares erkennbar wurde. – Wir selbst waren in dieses Gespräch immer eingebunden und haben auch viel „Ermutigendes“ hinein gegeben, Anregungen durch die Verkündigung, durch eine lebendige Liturgie, durch Lieder und Texte und durch die vielen anderen Möglichkeiten der normalen Seelsorge. Die Mitglieder der Gemeinde zu kontrollieren, kam uns nicht in den Sinn. Wir hatten die ganzen Jahre hindurch kaum Ängste, dass im Glauben und Leben der Menschen etwas so schwerwiegend falsch wäre, dass man es nur durch hartes Eingreifen und nicht durch Argumente in Ordnung bringen könnte. Es gab allerdings Stimmen, die uns gerade diese Zurückhaltung zum Vorwurf gemacht haben. Sie hätten sich bei bestimmtem – vor allem moralischem – Fehlverhalten eine eindeutigere Stellungnahme gewünscht. Wie auch immer. Vielleicht waren wir manchmal auch etwas zu vorsichtig, weil wir die Leute nicht vergraulen wollten. Sicher entsprang unsere Haltung aber auch einer großen Hochachtung vor der Eigenverantwortung der Menschen. – Wenn Gemeindeleiter diese Haltung über Jahre durchhalten, kann in einer Gemeinde eine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen. Und wenn dann ein Nachfolger in der Leitung der Gemeinde sich darüber dankbar wundert, dass die Leute offen und rücksichtsvoll mit ihm umgehen, dann darf man wohl darauf hinweisen, dass sie eine solch vertrauensvolle Beziehung zu ihren Seelsorgern gewohnt sind. – Es hat auch immer wieder mal „geknallt“. Das heißt, wir haben trotz des guten Einvernehmens oft auch deutlich unsere Meinung gesagt. Ich erinnere mich an einige Situationen im Kirchenvorstand. Da bringen ja Menschen ihre beruflichen Fähigkeiten für die Leitung und Verwaltung der Kirchengemeinde ein. Und da musste dann schon mal gesagt werden, dass in einer Kirchengemeinde das eine oder andere nicht gestattet ist, was im normalen Leben allenthalben praktiziert wird.
Wir haben die Freiheit der Menschen respektiert. Es hat im Laufe der Zeit viele Menschen gegeben, die mit dem nicht einverstanden waren, was wir für richtig hielten. – Da waren zum Beispiel die Eltern aus Schlesien, die ihre Kinder unbedingt vor der Kommunion zur Beichte führen wollten. Ich habe heftig geredet, um ihnen nahezubringen, weshalb wir das als Gemeinde nicht tun. Und ich habe auch gesagt, dass ich es nicht richtig finden würde, wenn sie eine Gruppe geschlossen zur Beichte führen würden. Denn die Gruppe leiten sie ja im Auftrag der Gemeinde. Aber ich habe mich gehütet, es einzelnen Eltern zu verbieten, wenn sie das eigene Kind beichten lassen wollten. Die Freiheit der Eltern in der Erziehung ihrer eigenen Kinder war mir wichtig. – Ein weniger grundsätzliches Beispiel: natürlich wussten wir, dass manche Hochdahler immer wieder (oder auch regelmäßig?) gern nach St.Max in Düsseldorf zum feierlichen Hochamt gingen. Die Freiheit dazu hat ihnen natürlich niemand abgesprochen. – Ganz entscheidend war die Frage nach der Freiheit des Einzelnen beim so genannten „Kontaktdienst“(Nr. 22). Wir hatten natürlich den Wunsch, dass alle Hochdahler Katholiken mit den Kontaktdienst-Besuchern ins Gespräch gekommen wären. Und wenn die Besucher dann erzählten, wie oft die Türen verschlossen blieben oder die Aspekte vermutlich sofort in dem Papierkorb neben dem Hauseingang gelandet sind, dann hatten wir kritische Empfindungen gegen diese Mitbürger. Eigentlich hätte der Respekt vor ihrer Freiheit stärker sein müssen als die Enttäuschung über ihre Unzugänglichkeit. – Und selbst wenn mir einer begegnet, der meinen Glauben ablehnt, dann darf ich ja, wenn er es zulässt, mit ihm diskutieren; aber ich darf ihn nicht ablehnen, wenn er unzugänglich bleibt. Seine Freiheit ist zu achten. Denn Glaube ist nur in Freiheit möglich; jede Form von Manipulation, Überredung oder Anpassung führt zu einem Ergebnis, das nicht Glauben ist.
Ein Angebot zum Nulltarif hatten wir nicht. Jahrelang ist über das Ende der Volkskirche geredet worden und manche meinten, jetzt könne sich die Kirche „gesund schrumpfen“. Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, im Verlust des Glaubens bei so vielen Menschen eine positive Entwicklung zu sehen. Wir haben jedenfalls diese Situation als Anforderung erlebt. – Wenn das Milieu nicht mehr trägt, müssen die Menschen wissen, was und warum sie glauben. Unser Ziel waren die „mündigen Christen“. – Nach dem Weggang von Hans Meixner kam für ihn kein Nachfolger mehr nach Hochdahl. Als Grund wurde der wachsende Priestermangel genannt. Wir haben versucht, die Gemeinde auf die priesterlose Zeit vorzubereiten. –Irgendwann konnten wir nicht mehr damit rechnen, dass die Kinder in der Familie in die Anfänge des Glaubens eingeführt werden. Wir haben versucht, sie durch Gottesdienst und Katechese ein wenig mit Jesus Christus und der Gemeinschaft der Glaubenden vertraut zu machen. – Das erfordert natürlich viel Mühe und kostet eine Menge Zeit und Kraft. Aber unverantwortlich ist es, so zu tun, als ob man sich gar nicht besonders anstrengen müsste. Manchmal kann man den Eindruck haben, dass es unter den Christen so etwas wie eine frustrierte Müdigkeit gibt. Die äußert sich auch in dem verbreiteten Argument, alle seien in Beruf und Familie schon bis an die Grenze gefordert und könnten deshalb nicht noch zusätzlich Kinder und Jugendliche in der Vorbereitung auf die Sakramente begleiten. Und die Zukunft der Kirche ist garantiert, wenn wir ein bisschen wie bisher weitermachen? – Mit dem Aufbruch des Konzils hätten wir die Krise der Kirche in Europa vielleicht abfangen können (eine persönliche Überzeugung eines einfachen Dorfpfarrers). Das hätte allerdings eine intensive Auseinandersetzung und einen massiven Einsatz gefordert. Man blieb lieber beim Alten und Gewohnten – auch weil es bequemer war? – Auch in Hochdahl gab es Stimmen, die die Vorbereitung von Erstkommunion, Buße und Firmung mit weniger Aufwand betreiben wollten. Das sei modern und nehme die Lebensumstände der Menschen ernst. Wir glaubten, dass man den Glauben nicht an der Ecke kaufen oder als billige Zugabe beim Erwerb eines Handys einstecken kann. Der Glaube erschließt sich nur dem, der sich müht. Und manchmal ist ein langer Weg nötig, bis man hier und da versteht, wie das ist mit Gott und der Welt und dem eigenen Leben.
35. Beseelen statt befehlen
Auch dieses Motto haben wir nicht selber erfunden. „Beseelen statt befehlen“ war der Titel eines Buches, das 1958 in deutscher Übersetzung erschienen ist und die Arbeit der CAJ, der Christlichen Arbeiterjugend, reflektierte. Dabei ging es konkret darum, in welchem Stil und mit welcher Mentalität die Priester im Bereich der CAJ mit den jugendlichen Mitgliedern der Gruppen arbeiten sollten. Der deutsche Titel war keine Wiedergabe des französischen Originals. Aber diese prägnante und treffende Formulierung hatte es uns auf Anhieb angetan. Ich habe das Buch nie gelesen und wir haben über das Motto auch nie ausführlicher diskutiert. Wir haben den Titel übernommen und ihm dabei vermutlich den Inhalt gegeben, der uns wichtig war.
„Beseelen statt befehlen“ sind offensichtlich zwei Verhaltensweisen, wie man eine Leitungsfunktion wahrnehmen kann. Und ob es sich um eine Gruppe, eine Organisation oder eine Gemeinde handelt, an vielen Stellen wird per Befehl oder Anordnung geleitet. Als wir schon im Theologiestudium weit fortgeschritten waren, mussten wir bei Eingaben an das „Hochwürdigste Erzbischöfliche Generalvikariat“ noch mit „Gehorsamst“ unterschreiben. Und bis auf den heutigen Tag sind viele Gemeinden unverkennbar autoritäre Gebilde. Solche Erfahrungen machen mir aus der heutigen Sicht verständlich, was uns an dem „Beseelen“ so angesprochen hat.
In der Einzelseelsorge ist das, was mit dem Motto gemeint ist, schon immer praktiziert worden. Und für viele Priester war es ein wichtiger und geschätzter Bereich ihres Bemühens – ob als Beichtvater oder „Seelenführer“ oder väterlicher Freund. Wenn noch nach dem Krieg vor den großen Festtagen sich lange Schlangen vor den Beichtstühlen bildeten, dann war es vielleicht nur in Einzelfällen möglich, auf die Menschen ausführlicher und persönlicher einzugehen. Vieles wird bei dieser Praxis formalisiert und routiniert abgelaufen sein. Aber es war immer klar und wurde oft auch ausdrücklich angeboten, dass man um ein eingehendes Gespräch bitten konnte, wenn man religiös oder moralisch in einer schwierigen Situation war. Ein solcher intensiverer Austausch war auch möglich, wenn jemand nicht bei den alltäglichen Verrichtungen stehen bleiben wollte, sondern einen Weg zu einem vertieften Glauben suchte. – Ob es dabei nun um ein Beichtgespräch mit Einschluss von Bekenntnis und Absolution oder eine einfache Beratung geht, die Rollenverteilung ist zunächst eindeutig. Der „Suchende“ – wenn man ihn so nennen will – kommt mit seiner Lebenssituation, seinem Bemühen und seinem Versagen zum Priester, der versucht, sich in die Situation hineinzuversetzen, zu raten und zu helfen. Wenn man den Vorgang analysieren will, ist entscheidend, wie weit es dem Suchenden gelingt, sein Leben durchsichtig werden zu lassen. Wie erlebt er seine Beziehung zu Gott, welche Bedingungen sind ihm vorgegeben, welche Wünsche treiben ihn um, wo erlebt er Versagen und Scheitern. Dabei geht es sowohl um einfaches Erzählen als auch um den Versuch einer Deutung. Der „Leitende“ kann durch kluges und einfühlendes Fragen helfen. Je transparenter das Leben wird, umso eher kann geschehen, was mit „beseelen“ gemeint ist. Der „Seelenführer“ gibt nicht – gewissermaßen von außen – irgendwelche Anweisungen, guten Ratschläge oder fachmännische Einsichten. Seine Erfahrung als Glaubender wird ihn in den Schilderungen erkennen lassen, wo sich Lösungen oder nächste Schritte für den „Suchenden“ andeuten. Und dann wird es ein gemeinsames Erkennen geben, bei dem die zunächst eindeutige Rollenverteilung gar nicht mehr so eindeutig ist. Im gemeinsamen Tun wird den beiden vielleicht die verborgene Weisung Gottes erkennbar. Und auch wenn die Beteiligung des „Leitenden“ klar ist – so dass man von einer wirklichen „Leitung“ sprechen kann – so wird es doch keine Leistung sein, auf die sich der „Seelenführer“ etwas einbilden könnte. Er hat beigetragen zum inneren, seelischen Wachstumsprozess des „Suchenden“.
Wir waren von dem Motto „Beseelen statt befehlen“ deshalb so angetan, weil wir es als einen Impuls für die Leitung einer ganzen Gemeinde ansahen. Wir wollten die Gemeinde führen durch Weisung, Deutung und Rat für das innere, geistliche Leben der Menschen. Auch bei diesem Vorgang wird das Gespräch der wichtigste Weg sein. Dabei kann es nicht auf die Zahl der Gespräche ankommen. Nicht die Summierung von Einzelgesprächen führt zum Ziel, abgesehen davon, dass bei einem solchen Versuch sehr schnell die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit erreicht werden. Im Laufe der Zeit kann sich in einer Gemeinde eine „Gesprächskultur“ entwickeln. Man lernt, dass man nicht nur über die Erfahrungen im Urlaub, den letzten Ärger in der Familie oder die Kirchenpolitik sprechen kann. Wenn die eigene Lebenssituation zur Debatte stehen darf mit allen Unsicherheiten, Wünschen und Hoffnungen, dann ist „beseelen“ möglich. Und dann kann das zur Gabe und Aufgabe vieler in der Gemeinde werden. Der Leiter oder die Leiter der Gemeinde müssen nur eindeutig dazu stehen, dass solche Gespräche zum Zentrum des gemeinsamen Lebens gehören. – Eine Gemeinde „beseelen“ kann sich auch in der Predigt vollziehen. Auch hier ist die Voraussetzung, dass die Lebenssituation der Menschen zur Debatte stehen darf und dass der Prediger dazu in der Lage ist. Manches wird er in Gesprächen und Diskussionen erfahren können. Manches wird er mit einem offenen Blick wahrnehmen. Und vielfach wird die eigene Lebenssituation mit der der Hörer übereinstimmen. Er ist also nicht auf die reine Spekulation angewiesen. Und in der Predigt muss die eigene Lebenssituation transparent werden – in einer Art und Weise, dass sich die Hörer selbst darin wiederfinden. Das muss natürlich mit aller Diskretion geschehen. Dann erleben sich alle – Prediger und Hörer – gemeinsam als Suchende. Und in der Auslegung der Botschaft kann etwas von der reinigenden und heilenden Kraft des Wortes Gottes erfahrbar werden.
In Hochdahl hat das „beseelen“ sich vor allem in der Gruppenarbeit vollzogen. Davon war in der Beschreibung der Arbeit mit den Katecheten der Sakramentenvorbereitung schon die Rede. Wir wollten ja nie, dass die Katecheten die Stunde für die Kinder oder die Jugendlichen nur „abspulten“ (was bei Jugendlichen sowieso kaum möglich ist). Denn bei keinem stimmt die Botschaft, die zu verkündigen ist, mit dem eigenen Wissen und dem eigenen Leben einfach überein. Die Rede war schon von der kindlichen Frage, ob man auf die Hostie beißen darf. Wie viel an Unsicherheit, Ungeklärtem und Angezweifeltem verbirgt sich da oft im Hintergrund. Das notwendige Wissen kann man vielleicht mit ein bisschen Information liefern. Aber für den Fortschritt des inneren Lebens ist mehr nötig. Und in der gemeinsamen Vorbereitungsrunde der Katecheten kündigt sich die Situation des Suchens oft nur ganz vorsichtig an (zum Beispiel: „Ich habe schlechte Erinnerungen an meine erste Beichte“). Wenn der Leiter der Runde – ganz vorsichtig – darauf eingeht, kann es passieren, dass die Lebenssituation von vielen Beteiligten plötzlich transparent wird. Das allein kann schon eine beglückende Erfahrung sein. Man ist mit seiner Hilfsbedürftigkeit nicht allein.
Und dann wird manchmal ein genauso schöner gemeinsamer „Durchblick“ möglich. Und dabei haben mehrere dazu beigetragen, die „Suche“ zu verdeutlichen, und mehrere hatten die Gabe, die Gruppe zu „beseelen“.
36. In der Gemeinde liegt die Zukunft
Die Krise der Kirche in Deutschland ist offensichtlich. In der Wahrnehmung der deutschen Bischöfe scheint sie sich vor allem im Priestermangel zu manifestieren. Dementsprechend suchen sie auch die Lösung über die Rolle des Priesters. Die Größe der Bereiche der Seelsorge wird der schwindenden Zahl der Priester angepasst. Je weniger Priester umso größer die Seelsorgsbereiche. Und inzwischen ist an vielen Stellen deutlich, dass dieses System nicht funktioniert. Und dieser Versuch belastet und erschwert, was an Lebensäußerungen in den Gemeinden noch vorhanden ist.
Sollten wir nicht stattdessen mit der Erneuerung der Gemeinde beginnen? Und dabei halten wir uns am besten an die Vision, die Paulus hat (und über die in Nr.13 „Die Gaben des Geistes“ schon ausführlich gesprochen worden ist). „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.“ (1 Kor 12, 4 – 6) Die Fähigkeiten, Kräfte und Dienste des Gläubigen sind demnach nicht Privatsache oder ein Ergebnis von Erbe und Veranlagung. In einer geradezu hymnischen Sprache betont Paulus, dass Gott der Urheber und Geber ist: ein Geist – ein Herr – ein Gott. Und Gott teilt jedem (!) seine besondere Gabe zu, wie er will (Vers 11). Man sollte sich einmal seiner Phantasie überlassen und sich vorstellen, welche Fülle des Lebens in jeder Gemeinde angelegt ist. Und wie in einem Film sollte man einmal die vielen Gesichter der Gemeindemitglieder, die man kennt, an sich vorbei ziehen lassen. Und in jedem dieser Menschen stecken noch ungeahnte verborgene Schätze – Fähigkeiten, Hoffnungen, Bereitschaft. Sie können nur sichtbar werden und sich entwickeln, wenn im gegenseitigen Dienen die Gaben des Geistes geweckt werden. Wie kommt es, dass dieser Weg als Möglichkeit zu einer lebendigen Kirche nicht ernsthaft zur Debatte steht? Wie kommt es, dass die Gaben, die doch Gaben Gottes sind, im Leben der Kirche (fast) nirgendwo eine Rolle spielen? Ob es vielleicht auch daran liegt, dass man immer von „Charismen“ gesprochen hat? Und Charismen wurden nicht als Wirkung des Geistes Gottes im Leben des Getauften interpretiert, sondern als „Begabung“ und Ergebnis von Vererbung. Wir werden bei dem Bemühen um diese verborgene Vielfalt zwar nicht den Himmel auf Erden erreichen, aber sicher kann der Geist Jesu im Leben der Gemeinde seine verwandelnde Kraft erweisen.
Bei diesem Erneuerungsprozess kommt den Seelsorgern in den Gemeinden eine Schlüsselrolle zu. Sie müssen die verborgenen Schätze ans Tageslicht bringen. Die Frage ist allerdings, wie viel Kraft und Energie den heutigen Seelsorgern noch bleibt. Viele sind ja durch die Organisation und die Logistik in den Großbereichen jetzt schon bis über ihre Kräfte gefordert. Ein weiteres Hindernis entsteht, wenn in einer Pfarrei von 20.000 Katholiken alle vorhandenen Seelsorger für den gesamten Seelsorgebereich zuständig sein sollen. Dann kann diese Konzeption nicht funktionieren. Denn das Wecken der Gaben setzt voraus, dass man sich kennt und miteinander im Gespräch ist. Auf dem Weg über öffentliche Ausschreibungen kann das nicht glücken. Das bedeutet, dass der Raum für diese Erneuerung die alte Pfarrei, die überschaubare Gemeinde ist. Nach den Erfahrungen, die wir in Hochdahl mit dem Wecken der Gaben des Geistes gemacht haben, ist die Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente eine große Chance. Bei Kommunion und Buße begegnet man den Eltern der Kinder. Und bei denen sind viele gottgegebene Fähigkeiten vorhanden – oft im Verborgenen und unentdeckt, ebenso bei den Jugendlichen, die sich auf die Firmung vorbereiten. Wenn eine Gemeinde diese Aufgaben wahrnimmt und viel Zeit und Kraft und Glaubenssinn investiert, dann kann auch heute noch der Glaube lebendig werden und Freude bereiten.
Was die Leiter der Gemeinde bei diesem Erneuerungsprozess tun, ist ein Dienst. Die Gabe der Leitung ist wie alle anderen Gaben dazu gegeben, damit sie anderen nützt. Sie dient dem Aufbau des Lebens der Gemeinde. Und dabei können ganz neue Formen des Dienens sichtbar werden.
.
- Es ist eine Form des Dienens, die Gaben des Geistes in der Gemeinde zu erkennen. Was schon gelebt wird, springt natürlich ins Auge. Aber es gibt sehr viele verborgene Gaben, die nur deshalb nicht wirksam werden, weil keiner sie zu finden versucht. Zukunft der Kirche? Auf die verborgenen Gaben der Gläubigen setzen!
- Es ist eine Form des Dienens, andere zu ermutigen, ihren Gaben und vor allem dem Geber zu trauen. Es kann eine wunderbare Erfahrung sein, wenn in der Kommunionvorbereitung so etwas geschieht: eine Frau traut sich nicht zu, im Gottesdienst mit Kindern ein kleines katechetisches Gespräch zu führen. Sie wird von andern Eltern ermutigt. Sie überspringt ihre Angst, sie riskiert es. Hinterher ist sie ganz stolz und dankbar: „es ging viel besser als ich gedacht habe!“
- Es ist eine Form des Dienens, danach zu suchen, welche Gabe man selbst für die Gemeinde empfangen hat. Man kann Angst und Müdigkeit und Gleichgültigkeit überwinden, wenn man erkennt, wie wichtig das Eigene (und kein anderer hat das genau so wie ich) für das Leben der Gemeinschaft ist. Und mir ist diese Gabe nicht geschenkt, weil der Pastor sonst überlastet ist. Sie ist mein ureigener Anteil und meine unersetzlich Rolle im Leben der Gemeinschaft.
- Es ist eine Form des Dienens, Leitungsaufgaben zu übernehmen, nicht um zu glänzen und zu dirigieren. Aber die Gemeinde braucht Menschen, die tragen, aushalten, Mut machen, vertrauen, sich krumm legen. Und Gott sollte der Gemeinde nicht solche Menschen gegeben haben?
Wenn wir uns um das Bild bemühen, dass Gott uns durch seine Gaben anvertraut hat, dann wird jeder Glaubende und jede Gemeinde ihr eigenes Gesicht bekommen. Man muss sich natürlich fragen, ob das für die „normalen“ Verantwortlichen in der Kirche eine verlockende Perspektive ist. Damit würde sich die Gemeinde ja der üblichen oberflächlichen Normierung durch Sätze und Vorschriften entziehen. Und es dürfte nicht leicht sein, einer solchen Vielfalt und Lebendigkeit gerecht zu werden. Eine Gemeinschaft, die nach dem Geist Jesu zu leben versucht, lässt sich nicht so leicht unter die Herrschaft irgendwelcher menschlichen Autoritäten zwingen. Aber es gilt doch wohl noch, dass in der Kirche der Wille Gottes die letzte Norm ist – des Gottes, der sich offenbart hat und durch seinen Geist auch heute am Werk ist!
Wenn die Gläubigen ihre Gaben entdecken und im gemeinsamen Leben wirksam werden lassen, dann wird die Gemeinde lebendig und attraktiv. Und die Anziehungskraft dieser Gemeinde wird andere Mitglieder motivieren, sich ihrerseits wecken zu lassen. Lebendige Christen in einer lebendigen Gemeinde!
37. Ave Eva oder der Fall Maria
Unsere erste Begegnung mit „Ave Eva“ fand irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 1974 in der Thomaskirche in Düsseldorf statt. Fast der ganze Jugendchor samt Combo hatte sich auf den Weg gemacht. Schon seit der Uraufführung in Telgte (1974) gab es immer wieder ein Raunen in der Gruppe, ob das nicht vielleicht ein Stück für uns sein könnte. Unsere Begeisterung für die Musik von Peter Janssens war seit der „Traummesse“ von 1972 ungebrochen. Und dann erlebten wir ein Stück, das uns für zwei Stunden in seinen Bann zog. Es war wieder so etwas wie eine Verlockung zum Aufbruch. Die Texte von Wilhelm Willms hatten nun wirklich nichts mehr von dem verstaubten Mief so mancher alter Kirchenlieder. Sie trafen – mit intensiven Bildern und hoher Dichte – mitten in unsere Lebenswelt. Und die Musik von Piet Janssens, die wir ja schon ein bisschen kannten, war voller neuer melodischer und rhythmischer Einfälle. Zwischendurch meinte er einmal, bei solchen Texten mache das Komponieren richtig Spaß. Und Rosen wurden verteilt, nachdem Maria „sich verduftet hatte“ (in ihrem Sterben) – und Brot und Wein als Zeichen der Hoffnung auf die Auferstehung und das endgültige große Fest. Die Atmosphäre in der Kirche war heiter und gelöst und es war gar nicht peinlich, als Piet zu Beginn einer neuen Station Wilhelm Willms an seinen Text erinnern musste: „Willem, Du bist dran!“ – Auf dem Rückweg nach Hochdahl waren wir ganz erfüllt von dem Erlebnis. Ich glaube, wir hatten „tief eingeatmet“, wie es der Speisemeister in der letzten Station empfiehlt – Hoffnung und Seinen Geist.
Und dann machten wir uns an die Arbeit. Und die Begeisterung hielt an, wenn auch immer wieder durchbrochen von der Unsicherheit und der Frage, ob wir uns mit diesem Vorhaben nicht überforderten. Die Skepsis ist verständlich, war es doch das erste größere, zusammenhängende Stück, das wir in Angriff nahmen. Bisher hatten wir nur einzelne Lieder im Gottesdienst gesungen.
Am 8.Juni 1975 haben wir „Ave Eva“ zum ersten Mal in Heilig Geist gesungen. In der Vorankündigung in der „neuen stadt“ wird etwas davon deutlich, dass uns der Inhalt dieses „Sacro-Pop-Musicals“ unter die Haut gegangen war. „Plötzlich wird diese Maria direkt sympathisch; sie überspringt die 2000 Jahre, die zwischen ihr und uns liegen; sie wird eine von uns. Dadurch verliert sie nichts von ihrer Größe. Im Gegenteil, man fängt (vielleicht zum ersten Mal – vielleicht wieder neu) an zu ahnen, was dieser „Einfall von oben“, dieses Kommen des Geistes in ihrem Leben bedeutet hat, und in unserem Leben bedeuten könnte.“
In den Aspekten von Dezember 1975 steht ein Bericht über die Aufführung, in dem eine junge Frau aus dem Chor etwas mehr vom Inhalt andeutet. „Ein Stück, das handelt von einem Mädchen, das unehelich schwanger wird, dem Gerede der Leute ausgesetzt ist, sich durch diese Schwangerschaft unmöglich macht. Ein Mädchen heute – ein Mädchen damals, der gleiche Fall – der Fall Maria. Das Mädchen bringt das Kind, gezeugt vom Hl.Geist, gezeugt aus einer übergroßen Liebe, zur Welt. Das Kind hängt an der Nabelschnur, am Seidenfaden, am Kreuz, in der Luft – auch heute noch. Dann der tote, der lebendige Jesus, den die Kirche, den wir verpasst haben. Schließlich Mariens Tod, die Totenerweckung, die Hochzeit zu Kana – die Krüge des Lebens sind leer. Jesus lässt die Krüge füllen. Der Duft – der Geist Gottes liegt in der Luft. Am Schluss werden Brot und Wein verteilt – als Geste der Gemeinschaft und des gemeinsamen Feierns.“
Wir haben es natürlich als Ehre empfunden, dass Wilhelm Willms schon bei dieser ersten Aufführung mit von der Partie war und die Zwischentexte las. Und achtzehn begeisterte junge Leute sangen und spielten so, dass der Funke schnell übersprang und die Gemeinde in die Fragen und Interpretationen des Stückes hineingezogen wurde. Für den nötigen „Drive“ sorgte eine taktsichere und rhythmusfreudige Combo mit Flöte, Gitarre, Bass, Klavier und Schlagzeug. Glück hatten wir mit der Technik. Eine solche Aufführung verlangt einigen Aufwand, damit die Botschaft auch rein akustisch beim Hörer gut ankommt. Nun hatte der Bürgerverein gerade eine leistungsfähige Verstärkeranlage erworben und sie für die Nutzung in der neuen Stadt in die Obhut von Dirk Thomé gegeben. Die stand uns für die Aufführung zur Verfügung. Daraus entwickelte sich eine langjährige, freundschaftliche Zusammenarbeit. – Wie die Gemeinde das Stück aufgenommen hat, kann man daraus schließen, dass zwei weitere Termine für den Oktober festgesetzt wurden.
Die Aufführung von „Ave Eva“ am 8.Juni 1975 war der Beginn einer langen Geschichte mit diesem Stück. Bis Mitte 1977 haben wir „Ave Eva“ zwölf Mal gesungen unter teils wunderbaren, teils verletzenden Begleiterscheinungen. Und für die, die in Chor und Combo dabei waren, war das natürlich der wichtigste Zugang zu Wilhelm Willms und seinen Texten. – Die Gemeinde begegnete ihnen vor allem im Gottesdienst. Das war für Wilhelm Willms offensichtlich auch der ursprüngliche Ort, für den er seine Texte verfasste. Immer wieder stellte er sich der Aufgabe, die überlieferte Botschaft neu zu verstehen und in neuen Bildern zu deuten. Für uns in Hochdahl und für viele andere Gemeinden waren seine Schriften ein
Zeichen der Hoffnung. Es war also doch möglich, die alten Wahrheiten in einer Sprache zu erzählen, die uns zu Herzen ging. Verkündigung, die lebendig war und lebendig machte! Für die Hochdahler Gemeinde wurden die Texte von Willms in diesen Jahren zu einem prägenden Element im Leben und in der Verkündigung. Leider hat die „offizielle Kirche“ wegen ihrer Probleme mit „Ave Eva“ und der massiven Meinungsmache der Gegner eine Chance verpasst, die der Verkündigung hätte zu Gute kommen können.
38. Ave Eva 2
Die ersten vier Aufführungen von „Ave Eva“ – drei in Heilig Geist und eine in Thomas Morus in Mettmann – waren einfach nur schön. Wilhelm Wilms war jedes Mal dabei und wir ließen unserer Freude freien Lauf und verkündeten unsere neu entdeckten Glaubensperspektiven. Sicher waren wir auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es geschafft hatten und die Arbeit sich gelohnt hatte.
Mit der Aufführung am 16.Mai 1976 in Werl gerieten wir in eine andere Umgebung und es veränderte sich die Öffentlichkeit, in die hinein wir unsere Botschaft vermittelten. Mit den Folgen haben wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet. –
Die westfälischen Kolpingsfamilien machen alle fünf Jahre eine Wallfahrt „zur Muttergottes“ nach Werl. Durchgeführt wird sie vom Diözesanverband Paderborn. Wir wurden eingeladen, im Rahmen des Jugendprogramms am Sonntagnachmittag Ave Eva zu singen. Wir haben gerne zugesagt und uns für die Einzelheiten mit dem Bildungsreferenten des Kolpingwerks abgestimmt. Die Aufführung sollte in einem alten Wirtshaussaal in Werl stattfinden. Diese Umgebung war etwas ungewohnt, erwies sich bei der Aufführung aber als recht gemeinschaftsbildend. Und den Trittschall auf den alten Bohlen der Bühne bekamen wir auch in den Griff. Es war wieder ein Fest des Glaubens, wie wir aus der Atmosphäre und den Reaktionen der Zuhörer erschließen konnten.
Samstags hatten wir in dem Saal alles vorbereitet und die Generalprobe absolviert. Als wir sonntags dann zur Aufführung kamen, hörten wir von einem eigenartigen „Rahmenprogramm“. Fromme Frauen (und vielleicht ebenso verantwortungsbewusste Herren) hatten beschlossen, während unserer Aufführung eine „Sühneandacht“ im Dom von Werl abzuhalten. Sie lehnten „Ave Eva“ ab und interpretierten unser Tun anscheinend als etwas Böses. Ich vermute, dass in diesem Zusammenhang für uns zum ersten Mal hörbar wurde, Maria würde durch das Stück in den Schmutz gezogen. Es war jedenfalls das erste Mal, dass wir solchen „Gegenwind“ bekamen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich diesen Widerstand nicht so ganz ernst genommen. Er hat mich sogar ein bisschen amüsiert, glaube ich. Was zu einer solchen „konzertierten Aktion“ geführt hat und wer wen dabei informiert oder animiert hat, war mir unklar und hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Übrigens soll Erzbischof Degenhardt nichts gegen die Aufführung gehabt haben. Und auch die Leitung des Kolpingwerkes stand zu ihrer Einladung und hat sich bei uns bedankt (und natürlich den Ausgleich der Kosten übernommen).
Kurz darauf wurden die Schwierigkeiten allerdings recht massiv. Für den 9.Juli 1976 planten wir eine Aufführung in der Stadthalle in Erkrath. Die Sänger waren hochmotiviert und betätigten sich in der Vorbereitung nicht nur musikalisch, sondern auch mit Farbe und Pinsel. Es entstand eine Reihe von sehr ansprechenden Plakaten. Und wir freuten uns auf die neue Aufgabe. Die „Stimmung im Lande“ war so, dass wir mit einer gut gefüllten Stadthalle rechnen konnten. Und ich persönlich war gespannt, wie sich der tolle Steinway-Flügel anfühlen würde, auf dem ich bei dieser Gelegenheit spielen durfte.
Knapp zwei Wochen vorher bekam ich einen Brief von Generalvikar Feldhoff. Er bat mich im ausdrücklichen Auftrag des Herrn Kardinals, alles zu tun, was in meiner Macht wäre, um die Aufführung zu verhindern. Sie hätten sich mit dem Text des Musicals auseinandergesetzt. Manche Katholiken glaubten, Text und Aufführung verantworten zu können. Anderen, ebenfalls ernst zu nehmenden Katholiken, würde dieses Musical zu einem schweren Ärgernis.
Weiter heißt es dann: „Wir können die Frage, ob man kirchlicherseits die Aufführung dieses Musicals verantworten kann oder nicht, durchaus vergleichen mit der von Paulus angeschnittenen Frage, ob es dem Christen erlaubt sei, Götzenopferfleisch zu essen oder nicht (vgl. 1 Kor 8, 1 – 13). Nach den dort aufgestellten Kriterien für die Gewissensfreiheit des Christen sollen diejenigen, die ein weiteres Gewissen haben, Rücksicht nehmen auf das Gewissen der anderen und alles tun, um dem „Bruder keinen Anstoß zu geben“. Deshalb hat unser Herr Kardinal untersagt, dass das genannte Musical von kirchlichen Stellen oder in unseren Kirchenräumen aufgeführt wird.“
Die Argumentation mit dem Götzenopferfleisch war wohl die Meinung von Kardinal Höffner und ich meine, mich zu erinnern, sie auch von ihm in einem Gespräch so gehört zu haben. Und sie ist über die Jahre hin immer wieder einmal in meinem Kopf aufgetaucht. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt. Aber ich war weder in der Lage zu sagen, was nicht stimmt, noch war ich in der Lage, seine Begründung zu akzeptieren.
Was mich da blockierte, war vermutlich der moralische Druck, den er auf diese Weise ausübte. Wir gaben also mit „Ave Eva“ ein schlimmes Ärgernis. Und „Ärgernis“ rutschte sehr schnell in den Zusammenhang mit dem „Mühlstein um den Hals“. Und in der Erziehung meiner Generation war „Ärgernis geben“ etwas vom ganz Schlimmen.
Heute ist mir klar, wo der Fehler lag. Höffner hat sich um die eigentliche Frage herumgedrückt – oder, um es weniger aggressiv zu formulieren, er hat zur eigentlichen Frage nicht Stellung genommen. Er sah in dieser Auseinandersetzung zwei Gruppierungen mit unterschiedlicher Gewissensentscheidung und da mussten die Leute mit dem weiteren Gewissen auf die Anderen Rücksicht nehmen. Er analysierte den Konflikt gewissermaßen soziologisch und wollte ihn moralisch lösen. Die Interpretation und der Lösungsversuch gingen an der Sache vorbei.
Für die Gegner von Ave Eva ging es nämlich um Glauben oder Unglauben. Dementsprechend legten sie auch einen Eifer an den Tag wie bei einer Ketzerverfolgung. Dabei scheuten einige nicht vor Diskriminierung und übler Nachrede zurück. Einer bemühte zur Interpretation des Stückes Lenin und erklärte es für marxistisch. Ein anderer hörte in den Melodien Anklänge aus faschistischer Vergangenheit. Wahrscheinlich waren viele Gegner auch einfach verunsichert und bekümmert, weil sie die neue Sprache nicht mit ihren alten Glaubensformeln überein bringen konnten. Die Wiederholung der alten, bewährten Glaubenssätze und der unumstößlichen Wahrheiten war deshalb auch das Grundmuster der Argumentation. – Wir waren demgegenüber glücklich und dankbar, dass Wilhelm Willms uns die alten Wahrheiten so interpretierte, dass wir sie verstehen konnten und dass es sich lohnte, neu darüber nachzudenken. Es waren ja keine neuen Wahrheiten: Verkündigung an Maria und Jungfrauengeburt, Heimsuchung und Begegnung mit Elisabeth, das Schicksal Jesu mit dem Hass seiner Feinde, sein Leiden und sein Tod, seine Auferstehung und unsere Auferstehung, Mariens Tod und ihre Verwandlung, die Gemeinschaft der Glaubenden im Geist und in der Feier des Mahles und die Hoffnung auf das endgültige große Fest. Und in seiner Deutung erlebten wir, dass der Glaube sich in unserem ganz konkreten Leben ansiedeln konnte. Es war der Vorgang, den er einem seiner weiteren Bücher als Titel gab: „Der geerdete Himmel“. – Vielleicht wird das an einem Beispiel leichter erkennbar. Im Glaubensbekenntnis beten wir: „Geboren von der Jungfrau Maria“. Was damit gemeint ist, wird fast überhaupt nicht mehr interpretiert und verkündet. Deshalb kommt es als Thema nur in der fragwürdigen Atmosphäre von Stammtischen vor. Mir ging immer das Herz auf, wenn ich dann den Song des Josef in Ave Eva hörte, mit dem er sich zu Maria bekennt: „Sie hat mich nicht betrogen, nichts Böses ist an ihr. Dafür stehe ich gerade. Ich bin der Vater, wenn euer Gesetz, wenn eure Paragraphen das verlangen, wenn ihr Beamten das wollt. Wenn ich auch nicht der Vater eines solchen Kindes sein kann.“ Und dieses „Mehr“, das über menschliche Möglichkeiten hinausgeht und das wir mit „Jungfrauengeburt“ ja meinen, wird in dem darauf folgenden Lied noch einmal betont: „…,denn einen solchen Vater, wie er sein müsste, …der ein solches Kind hätte zeugen können, …gibt es nicht unter den Vätern der Menschen“. Das konnten wir verstehen und das hat uns begeistert. – Für uns waren die Texte von Wilhelm Willms also eine Hilfe und eine Anregung für einen lebendigeren Glauben. Und deswegen sahen wir in Ave Eva eine Fortsetzung und Intensivierung unserer Bemühungen um einen lebendigen Gottesdienst und eine lebendige Verkündigung. Seit vielen Jahren hielten wir das in Hochdahl ja für eine unserer wichtigsten Aufgaben: eine phantasievolle Gestaltung des Gottesdienstes, gehaltvolle Texte und unverstaubte Lieder; und vor allem eine Predigt, die die ewigen Wahrheiten wirklich deutet und nicht nur wiederholt. In diesem Bemühen war uns Willms ganz nahe und wir konnten viel von ihm lernen.
Vor und nach dem 9.Juli habe ich mich bemüht, mit den Gegnern zu einem Gespräch zu kommen. Es war unmöglich – mit wenigen Ausnahmen. Die Diözesanleitung in Köln glaubte das wohl nicht nötig zu haben; sie hatte ihre Entscheidung getroffen. Aber auch die Gegner im gläubigen Volk waren nicht interessiert; sie meinten wohl, sie seien sowieso im wahren Christentum.
Wir haben die Aufführung nicht abgesagt. Ich habe Herrn Feldhoff mitgeteilt, wir hätten die Stadthalle gemietet, das könnten wir nicht einfach wieder rückgängig machen. Und der Kartenvorverkauf würde laufen. Obendrein war die Stadthalle ja kein kirchlicher Raum. – Ich habe nicht viele Erinnerungen an diesen Abend. Die Stadthalle war voll besetzt; das hat uns bestätigt. Und es war wirklich ein Vergnügen, auf dem Flügel zu spielen!
Am 19.August schrieb Herr Kardinal Höffner mir einen freundlichen Brief. Er wiederholte seine Begründung, weshalb er die Aufführung von Ave Eva untersagt habe. Und verwies auf die gleichartige Stellungnahme in der Diözese Mainz. Dort habe man sich intensiv mit dem Stück auseinandergesetzt und Kardinal Volk sei Fachmann in diesem Bereich. Im Rückblick aus den späten Jahren bedauere ich, dass ich auf diesen Brief von Kardinal Höffner nicht geantwortet habe. Vielleicht wäre es zu einem Gedankenaustausch gekommen.
Am 6.Oktober schrieb Generalvikar Feldhoff einen Brief an eine junge Frau aus dem Chor. Er hatte es offensichtlich satt, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Er meinte, von beiden Seiten würde eine Sache hochgespielt, die diesen Rang nicht verdiene.
Berlin, Kirche Maria Regina Martyrum, 1.und 2.Oktober 1976. Diese beiden Aufführungen waren ein wunderbares Erlebnis. Wir waren eingeladen worden von Pfarrer Michael Longard, der zu der Zeit Jugendseelsorger der Berliner Diözese war. Und er hatte dabei offensichtlich auch die Zustimmung des Ordinariats.
Dass wir in Berlin singen durften, war natürlich etwas ganz Besonderes. Und dann die Fahrt mit dem Bus – einschließlich der dunklen Eindrücke bei den Kontrollen am Grenzübergang und bei der Fahrt durch die DDR! Bei der Ankunft wurden wir von einer ganzen Reihe von Gastfamilien empfangen, die uns von Donnerstagabend bis Sonntagmittag in ihre Obhut nahmen.
Die Kirche Maria Regina Martyrum ist die Gedächtniskirche zu Ehren der Blutzeugen für Glaubens- und Gewissensfreiheit in den Jahren 1933 – 1945. Sie liegt nicht weit entfernt von der Hinrichtungsstätte Plötzensee, wo das Hitlerregime über 2500 Menschen durch Fallbeil oder Strick ermorden ließ. Neben der Kirche ist das Kloster der Karmelitinnen, ein Ort der Besinnung und des Gebetes mitten in der Großstadt. Diese Stätte war natürlich ein sehr hervorgehobener Ort für unsere Aufführung und bis auf den heutigen Tag kann ich nur mit Demut und Dankbarkeit daran zurückdenken. Durch den geräumigen Hof kommt man zur Kirche und steigt dann über eine Treppe in den Gottesdienstraum hinauf.
Der Raum war groß, einfach ausgestattet, nichts war dazu angetan, vom eigentlichen Geschehen abzulenken. Und so erlebten wir es auch, als wir Freitagabend zum ersten Mal dort sangen. In der Rückschau meinte die Darstellerin der Maria vor kurzem, zunächst sei das Publikum reserviert und abwartend gewesen. Aber spätestens beim Austeilen der Blumen habe sich die Stimmung zu einer freudigen Beteiligung gewandelt. Wilhelm Willms war wieder dabei und zog bei seinem Einleitungstext eine besondere, neue Verbindung zu Maria, der Königin der Märtyrer. Die Aufführung am Samstag bekam dadurch eine eigene Tiefe, dass wir vor dem Stück gemeinsam an der Vorabendmesse teilnahmen. Ein Glaubensvollzug, nicht nur eine Darbietung!
Der Sender Freies Berlin (SFB) tauchte auch auf und sendete ein paar Tage später Ausschnitte aus dem Stück. Es gab auch wieder Proteste, die aber durch ausgesprochen positive Stellungnahmen von Teilnehmern ausgeglichen wurden. Von einer Sühneandacht wurde nicht berichtet.
Von Januar bis März 1977 haben wir noch vier Mal gesungen. Und der Protest begleitete uns – nein, ging uns eher voraus. Denn Warnungen in Leserbriefspalten oder Aufrufe besorgter Seelsorger folgten meist der Ankündigung, dass wir Ave Eva singen würden. Wenn die Zeitung nachher über die Aufführung berichtete, war die Darstellung der Artikel meist sehr positiv. Nach dem Abend in Schleiden (26.2.77) lautete eine Überschrift in einer Zeitung: „Skandal um „Eva“ fand nicht statt“ oder in einer Unterzeile eines anderen Blattes: „Sacro-Pop-Musical enttäuschte in Schleiden nur den, der Skandal erwartet hatte“. Am 13.3. waren wir in Bochum. Da war von Protest gar nichts zu merken.
Interessant war die Aufführung in Aachen am 20.3.1977. Wilhelm Willms war ja Priester der Aachener Diözese. Insofern war dieser Abend für ihn gewissermaßen ein Heimspiel. Organisiert wurde die Aufführung von dem Kaplan von St.Fronleichnam in Aachen, Wolfgang Schmölders, der mit Willms gut bekannt war.
Inzwischen hatte sich die deutsche Bischofskonferenz mit dem Stück befasst und beschlossen, dass das Stück nicht von kirchlichen Gruppen und nicht in kirchlichen Räumen aufgeführt werden dürfe. Wie einem Zeitungsartikel zu entnehmen ist, hatte der Aachener Bischof Hemmerle die Aufführung in der Kirche zwar nicht verboten, es aber für angebrachter gehalten, eine andere „Bühne“ zu wählen. Nichts Besseres hätte uns passieren können! Wir sangen in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Der Raum war fast ideal: er war mit Besuchern gut gefüllt – er war nicht zu groß, sodass ein intensives Gemeinschaftsgefühl entstand – von der Bühne aus war er sehr übersichtlich, so dass wir die Hörer unmittelbar anschauen und ansprechen konnten. Es wurde wieder ein großes Fest! Nach dem Stück sangen wir das Kinder-Zirkus-Lied als Zugabe – und dann bekamen wir als Dankeschön einen großen Printenmann. Denn Aachen ist ja berühmt wegen seiner Printen. –
Wenn man sich an den Aufbruch des Konzils erinnert oder die großen Erwartungen im Zusammenhang mit der Würzburger Synode (die erst 1975 zu Ende gegangen war), dann muss man fragen, was sich die Bischöfe bei ihrem Verbot eigentlich gedacht haben. Haben sie gemeint, mit der Einführung der Muttersprache sei für die Erneuerung der Kirche in der Liturgie schon genug getan? Denn sie unterstützten mit ihrem Votum die Christen, die sich weigerten, die Botschaft und die Sprache der Verkündigung neu (oder überhaupt) zu durchdenken und sie für moderne Menschen verständlich zu machen. Alles sollte also beim alten bleiben? Die ewigen Wahrheiten sollten nur wiederholt werden und auf ihr Verstehen sollte man getrost verzichten? Eigentlich wäre es doch die Aufgabe eines Bischofs, bei der Verlebendigung des Glaubens voran zu gehen, auch wenn das eine Menge Mühe und Unsicherheit mit sich bringt. Stattdessen wie in alten Zeiten zu bremsen und wie ein Schießhund auf etwaige falsche Formulierungen zu lauern, ist doch ein bisschen billig. Und die Interpretation, das griechische Wort für Bischof, „Episkopos“, sei mit „Aufseher = Aufpasser“ zu übersetzen, ist doch nur ärgerlich.
Dasselbe Unverständnis wie bei Ave Eva zeigten sie leider ja auch im Zusammenhang mit den neuen Kanongebeten, die schon früher entstanden waren. Warum haben sie die Verfasser nicht ermutigt? Sie hätten sie ja allenfalls darauf hinweisen können, dass sie Anamnese, Epiklese usw. – das heißt, die wichtigsten Teile des Hochgebets – nicht übersehen sollten (was die sowieso nicht getan hätten). Warum haben sie stattdessen gemeint, alles müsse zuvor von einer Behörde geprüft und genehmigt werden? Oder alle derartigen Versuche seien grundsätzlich nicht erlaubt? Was im Messbuch steht, genügt als Erneuerung der Liturgie?
Weil wir in Hochdahl so günstige Voraussetzungen hatten, habe ich nie wirklich realisiert, wie schwer das normale „gläubige Volk“ auf den Weg der Umkehr und Erneuerung zu bringen ist. Die Kirchenleitung hat anscheinend um des lieben Friedens willen nicht wirklich um die Erneuerung gekämpft. Ich persönlich habe mich im Zusammenhang mit Ave Eva nicht verwirren lassen – weder von der Kirchenleitung noch von den eifernden „Rechtgläubigen“. Vielleicht hätten wir aber mehr tun können, um die ewigen Wahrheiten in die Sprache und das Verständnis unserer Zeit zu übersetzen – über eine sorgsame Predigttätigkeit hinaus.
Die letzte Aufführung 1977 war am 25.März in Kleve in der Aula des Mädchengymnasiums. Wieder volles Haus und wieder eine sehr schöne, beglückende Atmosphäre!
39. Jugendfreizeiten 1
Die Jugendfreizeiten zwischen 1970 und 1981 waren eine Erfolgsgeschichte in den frühen Jahren der Hochdahler Gemeinde. Es begann mit kleinen Aktivitäten. Die Idee dazu brachte Gerd Verhoeven aus Honnef mit, wo er vorher Kaplan gewesen war. Im September 1968 war er nach Hochdahl gekommen. Und schon im folgenden Jahr gab es von ihm und einigen anderen Erwachsenen ein Angebot für Jugendliche, nach Ostern und in den Herbstferien an Wanderungen teilzunehmen, die jeweils für 10 Tage von Jugendherberge zu Jugendherberge gingen. 1970 machte Frau Smoch (damals Sozialarbeiterin beim Kreis Mettmann, später dann für den katholischen Sozialdienst in unserer Gemeinde verantwortlich) den Vorschlag, 14-tägige Wanderfreizeiten in Selbstversorgerhäusern in Österreich anzubieten, besonders für solche, die sonst in den Ferien nicht rauskamen. Ab1972 wurde die Zahl der Teilnehmer so groß, dass von da an jedes Jahr mehrere Gruppen nach Österreich fuhren, jeweils begleitet von zwei bis drei Erwachsenen der Gemeinde. 1981 fuhr dann noch je eine Gruppe nach Spanien und Skandinavien. – Andere Gruppen blieben in dieser Zeit eher in der Nähe, in Laasphe/Sauerland. Jede Gruppe hatte etwa 20 Teilnehmer, sodass eine gute Gemeinschaft entstehen konnte und die Begleiter auch den Überblick behielten.
Aber lesen Sie jetzt selbst, was eine jugendliche Teilnehmerin und eine Begleiterin zu erzählen haben, und wieso die Freizeiten für sie und die Gemeinde so eine wichtige Sache gewesen sind. Ich – Bernd Staßen – war bei diesen Aktivitäten nicht dabei und habe im Vorspann nur widergegeben, was ich von Gerd Verhoeven gehört habe.
(Anmerkung: Der Vorspann ist bei Freizeiten 1 und Freizeiten 2 der gleiche)
Jugendfreizeiten 1
„ Wir führen ein sehr erfolgreiches kleines Reiseunternehmen “
Hochdahler Jugendfreizeiten in den 70-er Jahren.
Aus der Sicht einer Teilnehmerin
Ich bin 1969 nach Hochdahl gezogen. Von Anfang an wurden die Erwachsenen in der St. Franziskus-Gemeinde über Ehekreise vernetzt – Für uns Kinder und Jugendliche (die geburtenstarken Jahrgänge) gab es in dann ein umfangreiches Angebot an 14-tägigen Sommerfreizeiten. Österreich war das Ziel von Jungenfreizeiten und Mädchenfreizeiten; die jüngeren Kinder fuhren in die Nähe, nach Laasphe ins Sauerland.
Insgesamt bin ich 7 x unterwegs gewesen; zunächst in Österreich: Sölden`73, Sonntag`74, Saalbach`75, Strassen`77 und St.Siegmund`78.Daran an schloss sich 1979 eine Fahrradtour durch die Lüneburger Heide und 1981 eine Hüttentour in Österreich.
Eine typische Gruppe nach Österreich bestand aus rund 20 Teilnehmern sowie 3 Leitern. In der Regel wurden wir von zwei Erwachsenen und einem Jugendlichen begleitet. Von den Erwachsenen war die eine für die Leitung und die andere für das Kochen zuständig. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis gab es von dieser Regel auch schon mal „kreative Abweichungen“.
Heute weiß ich, wo ich das Arbeiten mit Checklisten und das systematische Kofferpacken gelernt habe: Der Prototyp wurde bei jedem Freizeit-Vorbereitungstreffen ausgeteilt und nannte sich
„ Ausrüstung für die Mädchenfreizeit“
4 Garnituren Unterwäsche
8 Paar Strümpfe
Taschentücher
2 Schlafanzüge
1 Bettbezug
4 Handtücher
2 Küchentücher
Taschengeld für alle einheitlich nicht mehr als 15 ,--DM
E111 – Internationaler Krankenschein
Regenschutz
Brustbeutel
Taschenlampe etc.
Ganz wichtig: auch der Impfausweis musste gecheckt werden. Für uns Freizeitteilnehmer wurde noch ein Sonderimpftermin beim Kreisgesundheitsamt vereinbart. Noch umfassender kann eine Betreuung nicht ausfallen!!
Spannend war jedes Mal das Treffen und die Abfahrt vor der Hl.Geist Kirche. Nach Österreich wurde immer „über Nacht“ gefahren und gegen 19 Uhr gestartet.
Ganz wichtig war die Frage: Hat der Bus Liegesitze? Obwohl wir uns die Frage immer direkt beantworten konnten - Jugendfreizeiten waren keine Luxusreisen - war die Enttäuschung jedes Mal riesengroß. K e i n e Liegesitze bedeutete, die ganze Nacht meist schlaflos verbringen und sich die mind. 12 h dauernde Fahrt irgendwie um die Ohren schlagen sowie arg zerknittert den Zielort erreichen.
In Österreich angekommen, haben wir uns immer sehr schnell an alles angepasst und eine reich angefüllte Zeit gehabt. Wir waren regelmäßig wandern oder auch nur spazieren, wir haben viele Eindrücke einer faszinierenden Bergwelt sammeln können. Natur pur!
Zu fast jeder Freizeit gehörte eine Zwei-Tages-Tour, also eine Wanderung mit Übernachtung auf einer Hütte. Das war dann wiederum sehr spannend und abenteuerlich, improvisieren war gefragt.
So mancher Gipfel wurde von uns bestiegen, so manches Schneefeld durchquert oder auch unfreiwillig hinuntergerutscht. Wir haben gebastelt oder einfach nur „abgehangen“.
Jedes Mal haben wir tolle Ausflüge gemacht, je nach Ausgangsort war Bregenz, der Bodensee, Mainau, Meersburg, Kaprun, Zell am See, Salzburg und Berchtesgaden, die Dolomiten mit den Drei Zinnen , Innsbruck oder auch Venedig unser Ziel.
Wir sind immer hervorragend bekocht worden, ich kann mich ganz gut an diese riesigen Mengen und Dosen erinnern und auch an bereits in Hochdahl vorausschauend eingekochten Gulasch. Draußen Grillen stand ebenfalls auf dem Programm. Wir Teilnehmerinnen haben uns an dem Küchendienst beteiligt oder wurden auch schon mal zum Beeren sammeln in den Wald geschickt. Wie selbstverständlich gab es auch zu besonderen Anlässen Bowle für alle.
Eine Tagesfahrt von Strassen aus führte uns nach Venedig, mit einer extrem frühen Abfahrt zwischen 3 und 4 Uhr, voller Staunen bei der Ankunft in Venedig und bei der ersten Fahrt mit dem Vaporetto, damals noch durch den Canal Grande. Wir hatten uns in 3 Gruppen aufgeteilt - eine pro Leiter - um die Stadt zu erkunden. Später hatten wir wieder alle gemeinsam auf der Piazzetta San Marco auf den Stufen und zu Füßen der monolithischen Säule des Hl. Theodor und dem Krokodil platzgenommen, um zu picknicken. Legendär dieser unser Picknick-Platz, denn heute sind die Säulen eingezäunt, Picknick ist überall in Venedig verboten und wird hart bestraft. Legendär auch unser Lunch-Paket bestehend aus schon in Österreich vorbereiteten Koteletts mit Gürkchen. Es wurde alles getan, damit wir eine wunderbare Zeit hatten.
Nach weit über 40 Jahren fallen mir verschiedene Situationen und viele umgeknickte Füße ein. Die Suche nach einem Friseur war auch so ein Thema (d.h. die Frisur der Freizeitleitung). Die Haare mussten gemacht werden, nicht einfach nur gefönt wie bei den jugendlichen Teilnehmerinnen. Was tun, wenn man sich im Sommer an einem Wintersportort befindet und der Friseur nur im Winter öffnet. Die Lösung lag auf der Hand: entweder selber beherzt zu den Lockenwicklern greifen und bei unserer Küchenfee für eine gut sitzende Frisur sorgen oder den Ausflug z.B. nach Innsbruck für einen Friseurbesuch nutzen, während der Rest der Truppe die Stadt erkundet.
Wir sind in den Freizeiten viel gewandert – noch mehr haben wir gesungen.
Gab es 1974 in Sonntag noch ein eher passives zuhören (Jesus Christ vom Plattenspieler), so wurde es mit dem Singen mit den Jahren immer mehr. Wir haben ungefähr jeden Raum und jeden Menschen in der Nähe mit NGL, mit Neuem Geistlichen Lied beschallt, ob er dafür zu haben war oder nicht. Wenn sich eine Teilnehmerin in den Kopf gesetzt hat, uns das Zirkuslied beizubringen, so wurde es 30 x geübt, am Stück selbstverständlich. Keiner konnte dem entgehen. Wir hatten ja reichlich „ Stoff“ aus den Jugendmessen und Sacro-Pop-Stücken und brauchten uns bei dem Liedgut nur bedienen. Gesungen wurde immer und überall und es hat Spaß gemacht.
In der Regel liefen die Freizeiten ganz entspannt ab und wir hatten viel Zeit für Gespräche.
Die Rückkehr nach Hause folgte auch einem gewissen Ritual: Schon von Österreich aus habe ich mir per Postkarte etwas zu Essen gewünscht, das dann zur Begrüßung an dem jeweiligen Abend immer daheim auf dem Tisch stand. Dazu gehörte auch: viel Erzählen, auch über das, was meine beiden Geschwister erlebt hatten, denn auch diese waren zu Freizeiten in Laasphe bzw. in Österreich unterwegs.
Was damals vielleicht auch mal negativ war, ist heute eher blass und unwichtig, richtig hängengeblieben sind die tollen Ereignisse. Auch heute noch bin ich mit Menschen aus dieser Zeit freundschaftlich verbunden.
Auch nach den Jugendfreizeiten ging es für uns Jugendliche manchmal weiter. Nach Sonntag 1974 wurden wir angesprochen, ob wir Interesse an einer Jugendgruppe haben, die sich weiterhin im Gemeindezentrum Hl.Geist trifft. Einige hatten Interesse. Die Jugendgruppe formierte sich.
Auch nach Strassen 1977 ging es weiter. Wir hatten beschlossen, uns schon bald samstagsabends in der 19 Uhr Messe in Hl.Geist wiederzusehen. Einige hatten das wahrgenommen und ab diesem Zeitpunkt war unser Platz auf der hinteren durchgehenden Reihe direkt an der Rückwand in der Hl.Geist Kirche. „Die Bank an der Rückwand von Heilig Geist“ wurde einfach zum Platz für Jugendliche grundsätzlich.
A propos Sitzordnung: An den hohen Feiertagen (Christmette / Osternacht) war die Kirche so voll und die „ letzte Reihe “ meistens schon von anderen Gottesdienstbesuchern belegt, so dass wir auf den Fußboden rund um den Taufbrunnen in Hl.Geist ausgewichen sind. Dort haben wir auf unseren Jacken auf dem Boden gesessen (das sogenannte „Sit-in am Taufbrunnen“). Irgendwann hatte es etwas ganz selbstverständliches an sich, sich einfach auf dem Boden niederzulassen. Das war nicht immer so. Bei einem Einkehrwochenende mit der Realschule in Himmerod hatte uns Pater Stephan erst dazu auffordern müssen, doch mit einer Decke auf dem Boden der Gästekapelle Platz zu nehmen. An ersten Abend haben wir uns noch nicht getraut, so fremd war das. Ab dem zweiten Tag haben wir es dann doch mal ausprobiert und später war es für uns in Ordnung. Schließlich war es noch nicht sehr lange her, da saßen Frauen grundsätzlich im linken Kirchenschiff und Männer im rechten… .
Wir hatten unseren Platz und wir haben ganze Samstagabende nach der Messe uns unterhaltend im Kirchenhof Hl. Geist verbracht. Der perfekte Ort zum Verweilen, … bevor wir dann als Gruppe doch überlegt haben, wen wir diesmal zu Hause besuchen. Bei vielen unserer Hochdahler Familien waren wir auch spontan immer herzlich willkommen.
In der Rückschau
- Habe ich Respekt vor der Vielzahl an Begleitern, die bereit waren, solche Freizeiten zu leiten und Verantwortung zu übernehmen.
- Bin ich dankbar über eine so sehr zugewandte Haltung
- Bin ich froh, immer wieder heil nach Hause gekommen zu sein
- Bin ich froh und dankbar für so viel unbeschwerte Zeit und die Möglichkeit, mich dort
zu vernetzen
In der Rückschau sind für mich die Jugendfreizeiten e i n Baustein der katholischen Hochdahler Jugendarbeit. Ein wichtiger Einstieg. Es ging – für den der wollte – deutlich über das „einfach 14 Tage lang eine gute Zeit haben“ hinaus.
Für uns gab es
- Jugendfreizeiten
- Firmung mit 17 Jahren und entsprechende Firmgruppen / jugendliche Firmbegleiter
- Jugendgruppen
- Religionsunterricht in der Oberstufe
- Jugendchöre
Überall gab es die Möglichkeit sich zu vernetzen, sich auszutauschen, über Glaubensfragen zu sprechen und auch erwachsene Ansprechpartner zu finden. Je mehr man von den Angeboten wahrnehmen konnte und wollte, desto intensiver wurde das Leben und Erleben in und mit dieser Gemeinde.
In Hochdahl war ganz viel freiwilliges Mitmachen statt Pflichterfüllung erlebbar.
Das ganze aktive und mit Begeisterung geführte, reichlich vernetzte Gemeindeleben hatte in meinen Augen ganz entscheidend zum sozialen Umbau in Hochdahl beigetragen:
- Wir waren generationsübergreifend und somit generationsverbindend unterwegs
- Soziale Schranken wurden deutlich kleiner
Wir fühlten uns generationsübergreifend angesprochen. Jugendmessen wurden von Gläubigen quer durch alle Altersklassen besucht. Jugendliche hatten ihre Eltern und Eltern ihre Jugendlichen im Schlepptau. Ich habe mich dorthin z.B. von meiner Oma begleiten lassen, die sich als Gast hier in der Gemeinde sehr wohl gefühlt hat.
Die Verbindung zwischen den Generationen mag vielleicht merkwürdig erscheinen, schließlich lagen die 68er Jahre nur wenige Jahre zurück – hier war es möglich, solche Verbindungen zu haben.
Es spielte eine untergeordnete Rolle, zu welcher sozialen Schicht man gehörte, in der Hochdahler Kirche und in der Gesellschaft. Die Vernetzung war bereits im vollen Gange und auch die Schulformen wurden durchlässiger – dazu passte nicht mehr ein starres „unter sich bleiben“.
Das begeisterte Mittun aller erleben und dabei Spaß und Tiefgang erfahren – das war für mich das Prägende dieser Zeit.
N.N.
(Kontaktwünsche werden an die Verfasserin weitergegeben.)
Und während sie ihren Text schrieb, fiel der Erzählerin auch ein Zettel in die Hand mit dem Angebot der Jugendfreizeiten 1977. Es wäre zu schade, wenn dieses Dokument verloren gehen würde. Deshalb soll er hier abgedruckt werden.
Das Angebot an Jugendfreizeiten 1977
|
Oberau I |
Abfahrt |
06.07.77 19 Uhr |
|
|
Rückkunft |
21.07.77 gegen 22 Uhr |
|
Strassen I |
Abfahrt |
06.07.77 19 Uhr |
|
|
Rückkunft |
21.07.77 gegen 22 Uhr |
|
Oberau II |
Abfahrt |
20.07.77 19 Uhr |
|
|
Rückkunft |
04.08.77 gegen 22 Uhr |
|
Strassen II |
Abfahrt |
20.07.77 19 Uhr |
|
|
Rückkunft |
04.08.77 gegen 22 Uhr |
|
Laasphe I |
09.07.-23.07.1977 |
|
|
Laasphe II |
23.07.-06.08.1977 |
|
|
Laasphe III |
06.08.-20.08.1977 |
|
40. Jugendfreizeiten 2
Die Jugendfreizeiten zwischen 1970 und 1981 waren eine Erfolgsgeschichte in den frühen Jahren der Hochdahler Gemeinde. Es begann mit kleinen Aktivitäten. Die Idee dazu brachte Gerd Verhoeven aus Honnef mit, wo er vorher Kaplan gewesen war. Im September 1968 war er nach Hochdahl gekommen. Schon im folgenden Jahr gab es von ihm und einigen anderen Erwachsenen das Angebot für Jugendliche, nach Ostern und in den Herbstferien an Wanderungen teilzunehmen, die jeweils für 10 Tage von Jugendherberge zu Jugendherberge gingen. 1970 machte Frau Smoch (damals Sozialarbeiterin beim Kreis Mettmann, später dann für den katholischen Sozialdienst in unserer Gemeinde verantwortlich) den Vorschlag, 14-tägige Wanderfreizeiten in Selbstversorgerhäusern in Österreich anzubieten, besonders für solche, die sonst in den Ferien nicht rauskamen. Ab1972 wurde die Zahl der Teilnehmer so groß, dass von da an jedes Jahr mehrere Gruppen nach Österreich fuhren, jeweils begleitet von zwei bis drei Erwachsenen der Gemeinde. 1981 fuhr dann noch je eine Gruppe nach Spanien und Skandinavien. – Andere Gruppen blieben in dieser Zeit eher in der Nähe, in Laasphe/Sauerland. Jede Gruppe hatte etwa 20 Teilnehmer, sodass eine gute Gemeinschaft entstehen konnte und die Begleiter auch den Überblick behielten.
Aber lesen Sie jetzt selbst, was eine jugendliche Teilnehmerin und eine Begleiterin zu erzählen haben, und wieso die Freizeiten für sie und die Gemeinde so eine wichtige Sache gewesen sind. Ich – Bernd Staßen – war bei diesen Aktivitäten nicht dabei und habe im Vorspann nur widergegeben, was ich von Gerd Verhoeven gehört habe.
(Anmerkung: Der Vorspann ist bei Freizeiten 1 und Freizeiten 2 der gleiche)
Jugendfreizeiten 2
Hochdahler Jugendfreizeiten in den 70-er Jahren.
Aus der Sicht einer Begleiterin
Mit meiner Familie bin ich 1967 nach Hochdahl gezogen. Das Gemeinedeleben gestaltete sich offen und leicht. Für mich war es selbstverständlich, dass ich - wie viele andere auch - Erstkommunionunterricht erteilt habe, als meine beiden Kinder im entsprechenden Alter waren. Dann war es nur ein kleiner Schritt, auch als Leiterin bei Jugendfreizeiten aktiv mitzumachen. Insgesamt habe ich 5 Freizeiten geleitet. Damals gab es für die Begleitung von solchen Freizeiten Sonderurlaub, also eine bezahlte Freistellung vom Arbeitsplatz. Mein Gehalt wurde für 2 Wochen vom Landschaftsverband übernommen.
Es gab immer schon in Hochdahl / Hl.Geist ein erstes Vorbereitungstreffen mit den Teilnehmern, ein erstes Kennenlernen. … und da es sich immer ausnahmslos um Selbstverpflegungshäuser handelte, musste vorab ein Speiseplan für 14 Tage erstellt werden sowie Basis-Lebensmittel im Großhandel eingekauft werden. Stressig wurde es erst, als die Batterie von Lebensmitteln (Großgebinde!) neben den Koffern vor der Zufahrt zur Hl.Geist Kirche zum Abtransport bereit stand. Nicht jeder Busfahrer war erfreut, neben dem Gepäck auch den halben Handelshof einladen zu müssen. Einmal brauchten wir in der Tat einen „Mediator “, der mit Engelszungen auf den Busfahrer eingeredet hat. Schließlich sind wir gefahren,....und zwar mit allen bereits eingekauften Lebensmitteln.
Begonnen habe ich mit einer Jungengruppe in den Sommerferien. Die Fahrt ging nach Laasphe / Sauerland, wo wir recht primitiv untergebracht waren. Unvergesslich: Ein Junge aus unserer Gruppe ist den Abhang hinunter in die Lahn gestürzt und hatte sich verletzt. Mir war damals als Leitung nicht klar, dass ich immer mit einem Bein im Gefängnis stand. Es folgte in Laasphe ein weiterer alptraumartiger Moment: ein Junge war verschwunden – für alle unauffindbar – große Aufregung. Irgendwann stellte sich heraus, er ist auf unserem Grundstück auf den Apfelbaum geklettert und hatte sich dort oben einfach schlafen gelegt….
1975 ging es dann mit einer weiteren Jungengruppe nach Saalbach / Österreich. Gekocht wurde auf einem riesigen Ofen, der mit Holz befeuert wurde, dieser wurde mit der Bauersfrau geteilt. Hat gut geklappt. Auch Wurst wurde von uns mitgebracht und in dem dafür vorgesehenen Keller aufgehängt. Auch den Keller hatten wir – ähnlich wie den Ofen – nicht für uns alleine: Mäuse und Katzen waren schlauer als wir und haben sich die Würste schmecken lassen.
1977 – diesmal eine Mädchenfreizeit – Strassen / Österreich: Eine sehr schöne, harmonische Gruppe, es wurde immer viel gesungen – auch hier mussten wir teilen: nicht den Ofen, nicht den Keller, sondern diesmal das mitgebrachte Bastelmaterial, das zur Freizeitbeschäftigung diente.
Die Kinder der Wirtsleute haben sich sofort auf das Bastelmaterial gestürzt und es mit Beschlag belegt.
1978 – St. Siegmund / Österreich - wieder eine Mädchengruppe, diesmal eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung, viele Mädchen eher „ ausgeflippt“. Bereits nach 2 Tagen war bei einigen das gesamte Taschengeld ausgegeben. Fehlendes Gespür für das, was in einer Gruppe geht und was nicht. Diesmal wurden von einigen der Mädchen Männer ins Haus geholt, einer von ihnen im Kleiderschrank versteckt. Ebenfalls wurde dann den drei Gruppenleitern - draußen vor dem Haus sitzend - ein Eimer Wasser aus der oberen Etage auf die Köpfe gekippt. Ein schlechter Scherz , ein sehr schlechter Scherz.
Spätestens ab dieser Freizeit stellte man sich die Frage, ob man als Leiterin hier eigentlich richtig ist, ob man seine eigene Zeit nicht sinnvoller anderweitig einsetzen könnte oder ob nicht spätestens an dieser Stelle Kriterien definiert werden sollten, ab wann Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden…
Mein Fazit: Es war alles sehr aufregend, oft auch anstrengend, vor allen Dingen, in allen Punkten die Verantwortung zu tragen, die Höhenkrankheit eines Teilnehmers auszuhalten. Entschädigt wurde ich durch viele schöne Ausflüge, Begegnungen, gemütliche Abende am Lagerfeuer, die Zeit oft angefüllt mit leidenschaftlichem Singen.
Zu einigen der Jugendlichen habe ich Kontakt behalten, später auch Firmgruppen begleitet und
1980 war ich mit in Berlin zum Katholikentag. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
N.N.
(Kontaktwünsche werden an die Verfasserin weitergegeben.)
41. Gemeindekatechese 3
Im Jahre 1977 haben wir mit der Firmvorbereitung begonnen. Es war das nächste große Projekt der Gemeindekatechese und hat uns bis 2007 und darüber hinaus sehr intensiv beschäftigt. Seit 1968 hatten wir mehrmals Firmung gehabt, die nach der alten Praxis vorbereitet und durchgeführt wurde. Die Älteren werden sich noch erinnern, wie diese alte Form ablief. Der Bischof kam alle vier Jahre in die Pfarrei – zumindest in die kleineren Pfarreien – und dann wurden alle Kinder, die bis dahin zur ersten hl. Kommunion gegangen waren, gefirmt. Ich erinnere mich an meine eigene Firmung. Die Vorbereitung bestand aus zwei Mal „Christenlehre“ in der Kirche. Die Zahl der Kinder war groß, der Volkschullehrer war für alle Kinder (vielleicht aber auch nur für die Jungen) der Pate. Der Bischof saß vor dem Altar, die Kinder stiegen die Stufen hinauf und knieten vor dem Bischof nieder. Zum Schluss der Firmung bekam jeder einen „Backenstreich“, den manche damals als Ritterschlag interpretierten.
Bei der Neuordnung der Firmung ging es für uns zunächst um das Firmalter. Wir wollten die alte Form nicht mehr weiterführen und wussten zunächst nicht genau, wie der neue Vollzug aussehen sollte. Bei der Würzburger Synode (1971 bis 1975) ist über die Firmung sehr ausführlich gesprochen worden. Die Stellungnahme zum Alter lautete, dass die Firmung nicht vor Vollendung des 12.Lebensjahres gespendet werden sollte. Wir haben in Hochdahl in dieser Zeit im Team immer wieder darüber diskutiert und kamen zu dem Entschluss, mit dem Alter noch etwas mehr nach oben zu gehen und Jugendlich mit 17 Jahren zur Vorbereitung einzuladen. Diese Überlegung war nicht aus der Theologie der Sakramente abgleitet, sondern ergab sich aus einem pastoralen Anliegen. Wir meinten, irgendwann sollte ein Mensch sich entscheiden können, wie er zu Glaube und Kirche steht. Und dafür könnte die Firmung eine Gelegenheit sein. Dann dürfte sie aber nicht angeboten werden, ehe der junge Mensch eine Mindeststufe der personalen Reife erreicht hat. Der Religionsunterricht im Gymnasium gab uns dann einen Anhaltspunkt, in welchem Alter man damit rechnen kann. Wir stellten fest, dass wir etwa ab Mitte der zehnten Jahrgangsstufe anfangen konnten, mit den Schülern über ihr Leben und ihre Erfahrungen zu sprechen. Dabei waren sie vielfach auch schon bereit und fähig, ihre Erfahrungen zu bewerten und von daher eigene Vorstellungen für ihre Zukunft zu entwickeln. Die Beteiligung an solchen Gesprächen war natürlich bei den einzelnen Schülern sehr unterschiedlich. Aber wir meinten, dass wir ab 17 Jahren damit rechnen dürften, dass die Vorbereitung auf die Firmung eine Chance für eine Glaubensentscheidung werden könnte. Wir haben dementsprechend die Jugendlichen unserer Gemeinde mit 17 Jahren zur Vorbereitung auf die Firmung eingeladen. Zum Zeitpunkt der Firmung waren viele von ihnen dann schon 18 Jahre. – Wenn man die Entscheidung über das Firmalter so trifft, werden viele Jugendliche nicht mehr zur Firmung erscheinen. Das haben wir auch so erlebt. In den ersten Jahren hatten wir Jahrgangsstärken von etwa 200 Jugendlichen; die 200 Kommunionkinder der frühen 70-er Jahre waren inzwischen ins Firmalter gekommen. Gerd Verhoeven meint in dem unten angeführten Artikel in der Zeitschrift „Diakonia“, davon hätten sich ungefähr 45% angemeldet. In späteren Jahren waren es von den 120 bis 150 Jugendlichen eines Jahrgangs etwa 30 bis 40 Prozent. Ich kann verstehen, wenn Seelsorger glauben, diesen Abbruch (um zwei Drittel!) nicht verantworten zu können und deshalb dazu tendieren, die Firmung möglichst früh anzubieten. Dann kann man die Vorbereitung aber nicht mehr zur Auseinandersetzung mit dem Glauben nutzen. Und die Entscheidung zum Empfang des Sakramentes ist genau so wenig abgeklärt wie bei Taufe und Erstkommunion. Und ob eine frühe Firmung den Abbruch verhindern würde, ist ja mehr als zweifelhaft. Wer an dieser Stelle auf die „geheimnisvolle Kraft des Sakramentes“ setzt, ist sich hoffentlich darüber im Klaren, dass Jesus Christus nicht zaubert.
Und dann begann es! Im Frühjahr 1977 wurden die ersten Jugendlichen zu einem „Grundkurs des Glaubens“ eingeladen. Anscheinend war die Zahl der Teilnehmer nicht besonders groß, nach den Erzählungen von Beteiligten dürften es etwa 30 bis 40 Leute gewesen sein. Zehn Begleiter versammelten sich an einem Samstag zur Vorbereitung, die von Gerd Verhoeven und Klaus Tigges aus dem Generalvikariat geleitet wurde. Die beiden müssen die Sache mit viel Schwung und viel Mut angegangen sein, denn es gab für die Durchführung dieser neuen Form der Firmvorbereitung kein Vorbild, das man einfach hätte nachvollziehen können. Infolgedessen gab es für die Stunden mit den jungen Leuten auch kein Arbeitsmaterial. Einer der Begleiter fuhr deshalb einige Tage nach dem ersten Treffen nach Düsseldorf zur Buchhandlung Bierbaum und bat die sehr kompetente Buchhändlerin Frau Grüger um Hilfe. Die musste allerdings eingestehen, dass es für diese Aufgabe kein Material gab. Sie empfahl ihm aber Jörg Zink. Der wäre dafür sicher eine gute Hilfe. – Auf den ersten Blick scheint fehlendes Arbeitsmaterial bei einer solchen Tätigkeit ja ein schwerwiegender Mangel zu sein. Aber vielleicht waren dadurch alle – Leiter, Begleiter und Jugendliche – viel mehr auf ein intensives Gespräch und das gemeinsame Suchen nach Antworten für das eigene Leben ausgerichtet. Es ging ja sowieso nicht um Wissensvermittlung, sondern um den Austausch von Fragen und Einsichten, die jeder aus den Erfahrungen des eigenen Lebens mitbrachte. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments geschieht die Weitergabe des Glaubens bekanntlich nicht durch Auswendiglernen eines Systems von Glaubenssätzen, sondern durch das Zeugnis des Glaubens, mit dem ein Mensch für seinen eigenen Weg einsteht. – Es scheint, dass bei diesem ersten Durchgang eine sehr positive Atmosphäre in der ganzen Gruppe geherrscht hat. Besonders betont wird bei den Erzählungen die gute Gemeinschaft, auch zwischen Jugendlichen und Begleitern. „Wie die Kletten haben sie an uns gehangen“, äußerte sich einer der Begleiter. Dazu trugen sicher auch die gemeinsamen Aktivitäten bei, wie ein Bus-Ausflug nach Aachen mit Kaffeetrinken in einem Restaurant im Aachener Wald und (natürlich) einer Besichtigung des Domes, ein Besuch der Ausstellung „Zwischen Rhein und Maas“ in Köln und dem von Anfang an obligaten Wochenende in Rinsecke. Manche Gruppen trafen sich noch nach Jahren. – Die Art der Firmvorbereitung war neu und das Interesse war groß. Viele Gemeinden waren genauso auf der Suche wie wir. Und so war es nicht verwunderlich, dass Gerd Verhoeven in den ersten Jahren nach 1977 immer wieder eingeladen wurde, das Hochdahler Konzept vorzustellen. Dabei fuhren immer auch Jugendliche oder Begleiter mit, um von ihren persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Auf dem Düsseldorfer Katholikentag 1982 gab es eine Veranstaltung zu diesem Thema. !983 fand in Freiburg der Deutsche Katechetische Kongress statt, den der Deutsche Katecheten-Verein alle zwei Jahre veranstaltet. In der Eröffnungsveranstaltung hat Gerd Verhoeven erzählt, wie die 100 Jugendlichen des neuen Firmkurses (von über 200 des betreffenden Jahrgangs, die eingeladen worden waren) ihr erstes gemeinsames Treffen erlebt und gestaltet haben. – Im Laufe dieser ersten Jahre entstand dann auch eine Sammlung von Hilfen, Anregungen und spielerischen Einstiegen für die Gespräche in den Firmgruppen. Was sich in der Praxis schon bewährt hatte, wurde zunächst auf losen Blättern zusammengetragen. Mitte der 80-er Jahre entstand daraus eine gedruckte Mappe. Sie hatte den programmatischen Titel: „Glaubensgespräche mit jungen Menschen – Firmbausteine für 17jährige.“ Der Deutsche Katecheten-Verein in München hat sie verlegt und jahrelang im Verlagsangebot gehabt. Die Anregungen dieser „Glaubensgespräche“ sind von vielen Gemeinden aufgegriffen worden. 1993 betrug die gedruckte Gesamtauflage 9600 Exemplare. Später nahm der Katecheten-Verein eine neue Firmmappe in sein Programm auf mit dem Titel „Mich firmen lassen“ (etwa im Jahr 2000 – 6.Auflage 2005), die wir neben unserer Mappe in den letzten Jahren ebenfalls benutzt haben. – Die Bedeutung der Firmvorbereitung für die Entwicklung der Gemeinde in Hochdahl kann man kaum überschätzen. Dreißig Jahre lang war sie ein zentrales Anliegen der Seelsorge, in die wir viel Kraft und Phantasie investiert haben. In der Zeitschrift „Diakonia“ vom September 1984 hat Gerd Verhoeven in einem Artikel das Konzept und die Hintergründe dargestellt und die Erfahrungen mit dieser Arbeit beschrieben. Dieser Artikel ist gewissermaßen ein Rechenschaftsbericht über die ersten Jahre und macht die Veränderungen in der Pastoral der Sakramente und in der Mentalität der Gemeinde deutlich. Deshalb soll er hier – zumindest in Auszügen – abgedruckt werden.
Artikel von Gerd Verhoeven. Zeitschrift „Diakonia“, Sept. 1984 (Auszüge).
1. Neue Wege der Firmvorbereitung
(…) In einem Neubaugebiet stellt sich die Frage nach Ziel und Weg der Gemeindebildung vermutlich deutlicher als in einer gewachsenen Gemeinde: die Stütze fester kirchlicher Strukturen fällt weg. Andererseits kann man unbelastet von dem, was man früher dachte, meinte und tat, neue Formen kirchlichen Zusammenlebens einüben. In einem Schlagwort: bei uns tragen alte, volkskirchliche Strukturen noch weniger als anderswo. Es muss die Entscheidung getroffen werden, ob man solche Formen restaurieren oder ob man bewusst in Richtung einer „Entscheidungskirche“ arbeiten will.
2. Wie unsere Firmvorbereitung aussieht
Diese Gemeindesituation hatte pastorale Konsequenzen. Eine davon ist unsere Firmvorbereitung. Wegen der großen Jahrgänge haben wir jedes Jahr Firmung. Vor Weihnachten werden die Jugendlichen, die im Firmjahr 17 Jahre alt sind, zu einem „Grundkurs des Glaubens“ eingeladen. Bis zum Jahreswechsel kommen ungefähr 45% positive Antworten zurück. Gleichzeitig beginnt die Werbung der Firmbegleiter: durch das Proklamandum am Sonntag, durch das 14täglich erscheinende Mitteilungsblatt, durch den vierteljährlich erscheinenden Pfarrbrief, durch persönliches Ansprechen, vor allem durch Firmbegleiter der Vorjahre. Alle, die sich für diese Aufgabe interessieren (Erwachsene und auch gefirmte Jugendliche), werden zu einem Informationsabend eingeladen. Da geht es um ein erstes Kennenlernen, um die Abklärung des zeitlichen Aufwandes, um die Klärung der Chancen, aber auch der möglichen Schwierigkeiten, die mit dieser Arbeit verbunden sein können. Die notwendige Begleiterzahl zu gewinnen ist in den letzten Jahren unterschiedlich schwer gewesen. Immerhin brauchten wir in diesem Jahr für 12 Firmgruppen mit je ca. 10 Jugendlichen 24 Erwachsene (12 Frauen und 12 Männer) und 12 Jugendliche! Oft bestehen die Firmgruppen über die Firmung hinaus fort und binden so die Begleiter weiter. Zudem meine ich, niemand sollte mehr als zwei Jahre hintereinander Firmbegleiter sein. Da gibt es natürliche „Verschleißerscheinungen“.
Ein gemeinsames Wochenende der bereiten Firmbegleiter vor der eigentlichen „Firmvorbereitung“ führt in die Thematik der Arbeit ein, macht bekannt mit möglichen Methoden und Inhalten dieser Arbeit. Am Ende dieses Wochenendes finden sich die Begleiter dann zu Dreier-Teams zusammen, die künftig eine Firmgruppe begleiten werden (möglichst eine Frau, ein Mann und ein gefirmter Jugendlicher).
Während der eigentlichen Firmvorbereitung treffen sich die Begleiter etwa alle drei Wochen zu einem Abend oder zu einem ganzen Samstag mit mir oder einem anderen „Hauptamtlichen“, um mögliche Inhalte der Firmvorbereitung für sich selbst zu durchdenken und abzuklären. Zur Vor- und Nachbereitung der einzelnen Gruppenabende treffen sich die Dreier-Teams möglichst wöchentlich. Hier und da wird noch eine zusätzliche „Beratung“ über mögliche Schwierigkeiten, die in einer Gruppe entstehen, angeboten.
42. Ave Eva 3
Jugendchor und Band von St.Franziskus Hochdahl sollten beim Katholikentag 1980 in Berlin wieder dabei sein. Pfarrer Michael Longard, auf dessen Initiative hin wir 1976 in der Kirche Maria Regina Martyrum gesungen hatten, hatte uns wieder nach Berlin eingeladen. Wir hatten gerade „Franz von Assisi“, das neue Stück von Willms und Janssens, einstudiert und im November 1979 in Heilig Geist zum ersten Mal gesungen. Beim Katholikentag sollten wir jetzt „Ave Eva“ und „Franz von Assisi“ singen und auch noch eine Kindermesse mitgestalten. Bevor der Katholikentag begann, wurde Michael Longard krank, sodass der eigentliche Ansprechpartner für uns nicht mehr erreichbar war. Wir hielten uns vertrauensvoll an Rita Raile-Buchbender, die Sekretärin im Jugendamt, über die unsere Verbindung nach Berlin immer gelaufen war. Es hieß, wir sollten uns vor Ort mit Herrn Judkowiak, dem Leiter des Jugendprogramms beim Katholikentag, in Verbindung setzen. Wir teilten rechtzeitig mit, was wir für die beiden Aufführungen benötigten (ein brauchbares Klavier, Brot, Wein, Blumen) und fuhren wohlgemut nach Berlin.
Als ich bei Herrn Judkowiak erschien, eröffnete er mir, dass er keine Vorbereitungen für uns getroffen habe. Nur das Brot habe er bestellt. Er wollte das nämlich nicht – ich nehme an, die beiden in gewissen Kirchenkreisen nicht geschätzten Stücke. Ich war entsetzt, denn wir sollten am nächsten Morgen um 11 Uhr mit „Franz von Assisi“ in St.Canisius beginnen und abends in einer Wilmersdorfer Kirche „Ave Eva“ singen. In leichter bis mittlerer Panik fuhr ich zur Wohnung von Familie Raile, wo einige Hochdahler versammelt waren und sich den Kaffee schmecken ließen. Ich erzählte von der Panne und wurde sofort getröstet. Einhellig war man der Meinung: „das regeln wir.“ Und dann schwärmten die Anwesenden aus und besorgten in Blumenläden und Supermärkten, was nötig war: Rosen und Brot und Wein (samt Plastikbechern). Am nächsten Morgen baten wir eine andere Musikgruppe, die auch zum Katholikentag gekommen war, ob sie uns nicht für den „Franziskus“ ihr Klavier leihen könnte. Es war nach dem Schock ein schönes Erlebnis, mit welch großzügiger Selbstverständlichkeit der Leiter dazu bereit war. Und mit einem schnell besorgten Leihwagen samt Anhänger fuhren wir das gute Stück zum Einsatzort. – Abends war für „Ave Eva“ in der Kirche in Wilmersdorf ein Klavier vorhanden. Wir haben mit Freude gesungen und gespielt und das Publikum ging begeistert mit.
Diese Erfahrung beim Katholikentag in Berlin hat meine Beziehung zu den Verantwortlichen in der Kirche natürlich nicht verbessert. Das mindeste wäre doch gewesen, uns vorher klar und eindeutig zu informieren. Allerdings war ich auch offensichtlich ziemlich leichtgläubig. Ich wusste (und weiß bis heute) nicht einmal, ob wir im offiziellen Programm aufgeführt waren. Bis dahin hatten wir ja schon manchen Bremsversuch der Kirchenleitung aushalten müssen. Aber so massiv war es doch nie gewesen. Und auch die Erklärung hilft nicht, der Verursacher sei ja nur der Leiter des Jugendprogramms gewesen. Denn er handelte schließlich nicht als Privatmann. – Ich hatte von da an keine Lust mehr, mich bei offiziellen kirchlichen Ereignissen zu beteiligen. Beim Düsseldorfer Katholikentag hat Gerd Verhoeven mit einigen Begleitern die Hochdahler Firmvorbereitung vorgestellt. Ich habe bei dieser Veranstaltung mit Jugendchor und Band noch ein paar Lieder gesungen. – Die Erfahrung von Berlin hatte auch eine positive Folge. Ich glaube, sie machte uns noch ein Stück eigenständiger. Man muss halt den Weg, den man für richtig hält, gehen ohne zu erwarten, dass die Oberen einem vorher die Steine aus dem Weg räumen. Dabei zerbricht allerdings auch ein Stück Gemeinsamkeit. Und auf diesem Weg muss man auf die Solidarität Gleichgesinnter vertrauen. Denn dieser Solidarität hatten wir es zu verdanken, dass wir in Berlin doch noch singen konnten.
Anscheinend habe ich vorher etwas von diesem Durcheinander „gerochen“. Denn am Morgen vor unserer Abfahrt aus Hochdahl habe ich noch einige hundert Reklamezettel mit Ort und Zeit unserer beiden Stücke im Format DIN A 5 abgezogen (mit der schon bekannten vorsintflutlichen Wachsmatrize). Am Morgen vor der angekündigten Pleite sind Dirk Thome, unser Techniker, und ich dann durch das „Zentrum der Diözesen“ gezogen und haben die Zettel überall, wo ein freier Platz auftauchte, angepappt. Wer dort hineinging, konnte „Ave Eva“ und „Franz von Assisi“ unmöglich übersehen. Vermutlich hing es damit zusammen, dass beide dann auch ein volles Haus hatten. Es hieß, in Wilmersdorf hätten die Zuhörer sogar auf den Beichtstühlen gesessen. Dass beim Austeilen des Weines dann auch eine Endstufe der Verstärkeranlage mittrank und dann ihren Geist aufgab, war ein witziger Vorfall zum Schluss.
43. Rinsecke
Das Haus. Rinsecke ist ein kleiner Ort im Sauerland, ein wenig abseits der Straße von Kirchhundem nach Oberhundem. Dort hatte die Franziskus-Gemeinde aus Hochdahl über viele Jahre so etwas wie eine zweite Heimat. Ein alter Bauernhof war umgebaut und für Gruppen und Familien eingerichtet worden. Er gehörte den Angestellten der Steyler Missionare von St.Augustin. Um einen offenen Hof mit einem großen, alten Baum in der Mitte gruppierten sich hufeisenförmig drei Flügel. Wenn man von der Straße kam, ging oder fuhr man genau auf das Haupthaus zu, wohl das ehemalige Wohnhaus der Familie des Bauern. Auf der linken Seite hatte man dann den so genannten Pferdestall, der im Erdgeschoss zwei Gruppenräume und im Obergeschoss einen großen Versammlungsraum hatte. Rechts war ein kleinerer Trakt, den wir in seltenen Fällen mitbenutzt haben, der aber normalerweise von anderen Gästen belegt war. Betrat man das Haupthaus, dann war links das Büro von Frau Otte. Sie war für die Verwaltung des Hauses zuständig. Dahinter war die große Küche, in der man ohne Probleme mit einem Dutzend Leute gleichzeitig arbeiten konnte. Der große Herd war der Mittelpunkt, um den herum die Leute, die Arbeit und die Gespräche rotierten. Die Ausstattung war gut; Töpfe, Geschirr und Besteck waren immer ausreichend vorhanden, auch wenn wir mit bis zu dreißig Teilnehmern anreisten. Es lag demnach nicht an begrenzten Möglichkeiten des Hauses, wenn ich bei einem Wochenende mit Firmgruppen bemängelte, dass ich aus einer Tasse ohne Untertasse trinken sollte. Natürlich wurde dem Umstand sofort abgeholfen und beim nächsten Geburtstag bekam ich von einigen Beteiligten einen „Cultural Pack“. Für besondere Ansprüche gibt es ja immer einen besonderen Service. Vielleicht ist aus diesen Hinweisen schon erkennbar, dass es sich bei dem Haus in Rinsecke um ein so genanntes „Selbstversorgerhaus“ handelte. Wir mussten vom Zimmer-Verteilen über Kochen, Tischdecken, Spülen und Reinigung für alles selber sorgen. Gegenüber von Küche und Büro gab es zwei große Zimmer, die ineinander übergingen und die wir für die Mahlzeiten (und oft auch für Gruppengespräche) nutzten. Dazu stellten wir dann die Einzeltische zu einer langen Tafel zusammen, um die Zusammengehörigkeit der Gruppe zu verdeutlichen. Im ersten und zweiten Stock des Hauses wurden die Teilnehmer untergebracht, in Zimmern mit zwei oder drei oder sechs Betten. Den Luxus eines Einzelzimmers gab es nur für zwei (privilegierte oder besonders schnelle) Personen. Dieses Haus ist uns im Laufe der Jahre sehr wichtig geworden. Und wenn wir am Freitagabend oder – mit Firmgruppen – am Samstagmorgen von Hochdahl losfuhren, stellte sich sehr oft von Anfang an eine ganz besondere Stimmung ein.
Unsere Aktivitäten in Rinsecke. Wenn Frau Otte, die von 1984 bis 2000 das Haus geleitet hat, am Anfang eines neuen Jahres bei uns anfragte, welche Wochenenden oder Ferienwochen wir reservieren wollten, dann kamen – nach Auskunft von Frau Otte – immer 16 bis 18 Termine zusammen. Und da wir so oft da waren, wurden wir bei der Buchung auch mit Vorrang behandelt. Im Laufe der vielen Jahre stellte sich zwischen ihr und uns ein gutes Vertrauensverhältnis ein. Und dann konnten wir auch verkraften, wenn sie uns hin und wieder deutlich zur Ordnung rief. Wenn im Winter einige Bewohner vergaßen, nach dem morgendlichen Lüften die Fenster zu schließen, dann folgte unweigerlich die Drohung, sie würde die Heizung abstellen, wenn wir weiter so verantwortungslos mit der Energie umgingen. Wenn wir andererseits Fragen oder Wünsche oder Probleme hatten, konnten wir uns immer auf ihre Hilfe verlassen. – Angefangen hat unsere Beziehung nach Rinsecke etwas bescheidener. 1972 fuhr Gerd Verhoeven zum ersten Mal mit Schülern seines Religionskurses im Gymnasium dorthin. Und zunächst waren das nur einzelne Unternehmungen. Irgendwann schlossen sich dann Gruppen der Gemeinde an. Und die Beliebtheit des Hauses und die Zahl der Fahrten nahmen zu. Eine besondere Bedeutung hatte Rinsecke natürlich in den Arbeitsbereichen, die auch in der Gemeinde im Vordergrund standen. Die Katecheten von Kommunionvorbereitung und Buße und die Begleiter der Firmvorbereitung fuhren nach Rinsecke, um sich auf ihre Arbeit in den Gruppen vorzubereiten. Die Jugendlichen, die am Firmkurs teilnahmen, waren immer Anfang des Jahres dort. Dafür waren zwei oder drei Wochenenden reserviert. Meist fiel am Ende dieser Tage auch die Entscheidung, ob sie sich firmen lassen wollten oder nicht. Auch der Arbeitskreis Taufgespräche war regelmäßig einmal im Jahr in Rinsecke. Dabei fuhren dann oft auch die Ehepartner und Kinder der Mitglieder des Arbeitskreises mit, sodass sich die Gespräche über die Taufvorbereitung in einer Atmosphäre familiärer Gemeinsamkeit vollzogen. Auch die vielfältigen Hochdahler Überlegungen zum Aufbau der Kirchengemeinde in der neuen Stadt wurden in Rinsecke fortgesetzt. Der Pfarrgemeinderat war jedes Jahr an einem Wochenende da. Ebenso regelmäßig kamen der Kontaktdienst, die Capella nova und immer wieder einmal auch der aus dem Jugendchor hervorgegangene Projektchor. Viele Familien verlebten mit Kind und Kegel schöne Ferienwochen (meist in den Herbstferien) in Rinsecke und sorgten so dafür, dass auch Vergnügen und Erholung zu ihrem Recht kamen. – Wir hatten normalerweise bei den Wochenenden keine „Referenten“ von auswärts. Wir bereiteten die Themen und Arbeitsabläufe selber vor. Wenn es zum Beispiel um die Gemeindekatechese ging, konnten wir ja nur selber wissen, an welcher Stelle das Treffen in Rinsecke für die Begleiter inhaltlich stand, wie es in den zeitlichen Ablauf eingepasst war und welche Folgerungen es für die weitere Arbeit in der Gemeinde haben musste. Und auch für den Pfarrgemeinderat ergab sich die Thematik in Rinsecke immer aus den Überlegungen und Erfahrungen der Arbeit in der Gemeinde und die Erkenntnisse und Ergebnisse hatten auch nur Sinn, wenn sie in die Gemeinde zurückwirkten. Diese enge Bindung zwischen Rinsecke und unserem Leben in Hochdahl ist wohl der eigentliche Grund für die große Bedeutung, die Rinsecke für uns hatte. Der Aufenthalt dort war zwar auch eine „Auszeit“, weil wir eben auswärts waren, aber die war ganz erfüllt von dem Leben zu Hause. Und wer häufiger hinfuhr, kam nicht in eine fremde Umgebung und erst recht nicht in ein Hotel. Man brauchte nicht mehr als eine halbe Stunde, um sich zu Hause zu fühlen; so jedenfalls erzählte es dieser Tage einer der regelmäßigen Besucher. Die rustikale und bodenständige Einrichtung und Ausgestaltung des Hauses war für diese Empfindung sehr hilfreich.
Einige Erfahrungen können vielleicht behilflich sein, etwas von der Atmosphäre in Rinsecke zu erahnen. – Wenn wir ein Wochenende mit Firmbegleitern hatten, mussten wir am Freitagabend einen Einstieg in die Arbeit finden. Es musste den Teilnehmern möglich werden, aus der vielleicht anstrengenden oder hektischen Woche „in Rinsecke anzukommen“. Die große Gruppe teilte sich in mehrere Kleingruppen auf. In stiller Eigenbeschäftigung versuchten sich die Einzelnen über angenehme und belastende Erfahrungen, die sie mitbrachten, klar zu werden. Für beides suchten sie dann einen Gegenstand, der als Symbol für die Erfahrungen dienen konnte. Diese Symbole knüpften die vier bis sechs Teilnehmer
dann zu einem Mobile zusammen. Im nächsten Schritt wurde aus den drei, vier oder fünf Teilmobiles dann ein gemeinsames Mobile. So etwas haben wir mehrmals gemacht. Faszinierend war vor allem die letzte Phase, weil man meist eine staunenswerte Aufmerksamkeit und Behutsamkeit feststellen konnte. Und oft wurden die Einzelnen während des Abends heiterer und gelassener und auch die Stimmung untereinander wurde positiver. Ein Vorgang, wie Befreiung in Gemeinschaft stattfinden kann! Oft hatte die Atmosphäre am anderen Morgen noch etwas von diesem „Ankommen“. – Ich erinnere mich an ein Treffen mit dem Pfarrgemeinderat. Es ging um unser Bild von Gemeinde auf dem Hintergrund der vielen Gruppierungen in Hochdahl. Wir sammelten, was es an solchen Gruppierungen gab und malten alle mit Kreisen oder Flächen auf ein großes Plakat. Das war natürlich einfach. Aber wie verhalten sich die verschiedenen Gruppen zueinander? Gibt es ein differenziertes Bild von Gemeinde? Das wurde sehr schwierig. Einerseits wollten wir nicht einfach ein großes Seil um alle schlingen und sie auch nicht undifferenziert in einen Sack stecken. Wir waren aber auch nicht mit dem hierarchischen Bild einverstanden, das alle von oben nach unten sortiert, wobei der Papst oder der Klerus auf alle anderen herabschauen. Ich weiß nicht mehr, wie wir das Problem gelöst haben. Aber ich erinnere mich an ein sehr intensives Gespräch mit einer Menge Einsichten. – Bei einem Wochenende mit Firmgruppen hatten wir als Begleiter Unsicherheit und Angst, ob die Jugendlichen den vorgesehenen Einstieg in ein Thema mitmachen würden. Wir planten, mit einem Tanz in der großen Gruppe zu beginnen. Aber offensichtlich war die kritische Phase der ersten Jahre inzwischen vorbei. Keiner machte Schwierigkeiten. Das war nicht selbstverständlich, aber erleichternd. Später wurden die irischen Volkstänze, die Heiner Schuster mitbrachte, von allen freudig begrüßt. – Auch verschiedene äußere Umstände trugen zu der guten Stimmung in Rinsecke bei. Normalerweise fuhren wir mit den privaten Autos der Teilnehmer ins Sauerland. Und unterwegs gab es schon gute Gespräche oder heitere Vorkommnisse. Besonders nachhaltig hat sich der Erinnerung eingeprägt, dass im Winter die Fahrt durch den Schnee nicht immer ungefährlich war und die Frage auftauchte, wie der R4 denn bei den Verhältnissen mit vier Personen und Gepäck den Berg hinauf kommt. Und in einem besonders winterlichen Jahr blieben einige Autos kurz vor der Ankunft im Berg stecken. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die eingekauften Lebensmittel geschleppt werden mussten. – Besonders wertvoll war, dass wir uns selbst versorgen mussten. Zwei oder drei Teilnehmer kauften in Hochdahl ein und jemand war in Rinsecke für die Zubereitung des Essens verantwortlich. Daneben aber gab es eine ganze Menge von Aufgaben, um die sich alle Beteiligten kümmern mussten: Hilfsdienste in der Küche, Tischdecken, Abräumen und Spülen. Und wie haben wir erreicht, dass das alles auch getan wurde? Bei einer Gruppe von Erwachsenen war das nie ein Problem. Bei Jugendlichen haben wir die Aufgabe als Training benutzt, etwas füreinander zu tun. Ein guter Organisator meinte manchmal, ein genauer Plan müsse erstellt werden, damit die Dienste gerecht und vor allem wirksam verteilt würden. Dagegen haben wir uns immer gewehrt. Nach der Ankunft haben wir eindrücklich darauf hingewiesen, dass keine Mutter oder Kellnerin ihnen die Sachen hinterhertragen würde. Sie müssten also die Augen aufmachen und erkennen, wo sie gebraucht würden. Und wenn zwischendurch ein Engpass zu entstehen schien, haben wir diese Aufforderung noch einmal wiederholt. Und maulendes Gerede „ich hab’ aber schon …“ haben wir einfach überhört. Normalerweise hat das ohne große Reibereien geklappt. Und oft haben Leute erkannt, dass solch gemeinsames Bemühen auch noch Spaß machen kann. – Ein andere Chance des „Selbstversorgerhauses“ war die Küche. Bis heute wird – fast mit leuchtenden Augen – davon erzählt, wie gut und intensiv die Gespräche waren, wenn acht oder zehn oder zwölf Leute in der Küche gemeinsam mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt waren. Und es scheint wirklich möglich zu sein, beim Gemüseputzen und Kartoffelschälen die Ergebnisse der vorherigen Arbeitsrunde oder auch persönliche Lebensumstände miteinander auszutauschen. Ähnlich erfreulich konnten die Gespräche in gemütlicher Runde nach dem Abendessen sein (die sich manchmal bis tief in die Nacht hinein fortsetzten) und viele erzählen bis heute von Nachtwanderungen und Geisterbeschwörungen.
„Der Geist von Rinsecke“. Irgendwann im Laufe der Jahre tauchte dieser Spruch auf. Wer ihn zum ersten Mal benutzt hat und was bei ihm dahinter stand, ist nicht mehr festzustellen. Aber die ihn im Laufe der Zeit immer häufiger benutzten, schienen damit Erfahrungen zu verbinden, die sie als wertvoll und hilfreich und intensiv erlebt hatten. Und anscheinend hatten wir die Vorstellung, in Rinsecke könne man so etwas Wichtiges und Wertvolles immer wieder erleben. Hatte sich dieser gute Geist vielleicht in den Räumen dort eingenistet? Der Informierte weiß natürlich, dass der Geist weht, wo er will. Aber dann war es trotzdem eigenartig, dass er besonders häufig in Rinsecke zu wehen schien. Das war also ausgesprochen geheimnisvoll. – In der Erinnerung ist es natürlich möglich zu beschreiben, was uns damals so gut und wertvoll erschien. Da war vor allem die Atmosphäre in den Gesprächen. Wie im Leben der Gemeinde, so war uns auch in Rinsecke das Gespräch die wichtigste Form der Arbeit. Manchmal geriet der eine oder andere auch schon einmal in das alte Gleis von Diskussion und Rechthaberei. Normalerweise war es aber ein vertrauensvoller Austausch. Suchen und fragen, zuhören und das Eigene dazu geben – so könnte man diese Atmosphäre charakterisieren. Und mit viel Geduld haben wir oft nach den Lösungen gesucht. Selten sind wir in Hektik verfallen, weil wir meinten, schnelle und endgültige Antworten zu brauchen. – Auf dem Weg zur Erkenntnis haben wir nicht nur den Verstand strapaziert. Im Laufe der Jahre sammelte sich ein großes Repertoire von spielerischen und lebensnahen Einstiegen und Arbeitsweisen an – mit Malen und Konstruieren, Musik und Tanz, Literatur und „Theater“. Und Manches, was wir dabei und dadurch erlebten, war erhellend oder sogar beglückend. – Ein wichtiger Schlüssel zu positiven Erfahrungen war wohl auch die Bereitschaft, sich den Fragen des eigenen Lebens und des Glaubens und der Gemeinde zu stellen. Das Evangelium und der Glaube waren nie frommes Gerede, sondern – wenn auch mit Schwierigkeiten – Quelle von Erkenntnis und Hoffnung. Wir sind davon ausgegangen, dass wir aus der Botschaft Jesu Antworten für unser Leben ableiten konnten. Und vielleicht steht darauf wirklich die Verheißung: dein Glaube hat dir geholfen. – Und sehr oft haben wir eine gute Gemeinschaft erlebt. Sie hat sich vollzogen und ist entstanden sowohl in den Gesprächen in den Arbeitsgruppen als auch in der Küche als auch bei Hin- und Rückfahrt. – Und wir glaubten und hielten daran fest, dass solche Erfahrungen nur möglich sind, wenn Menschen in Vertrauen und Freiheit einander begegnen. Und sie kommen selbst darauf, sich füreinander einzusetzen, wenn man sie nicht dauernd in feste Regeln, Pläne und Vorschriften einspannt. – Viele dieser Bemühungen und Überzeugungen waren gegenwärtig, wenn wir miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Dazu blieben wir immer in dem Raum, wo wir uns auch sonst aufhielten. Und die Themen, Fragen und Antworten, die Schwierigkeiten und Ungereimtheiten, hatten im Ablauf der Messe ihren Platz.
Das Ende. Leider ging unsere Zeit mit Rinsecke im Jahr 2000 zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt war nicht mehr zu übersehen, dass das Haus nicht den Vorschriften des Brandschutzes entsprach. Es hieß, das zu beheben sei sehr teuer, und deswegen wurde das Haus zum Verkauf gestellt. Wir haben in Hochdahl damals ernsthaft überlegt, ob wir das Haus nicht übernehmen sollten, aber das hätte wohl doch unsere Möglichkeiten überstiegen. Wir haben Rinsecke nachgetrauert. Und wo wir dann hingefahren sind – hierhin und dorthin – war es manchmal auch ganz nett, aber es war nicht mehr Rinsecke.
44. Rinsecke und der Gottesdienst
In Rinsecke war es leicht, einen lebendigen und würdigen Gottesdienst zu feiern. Das lag zunächst daran, dass die Gruppen klein waren. Normalerweise fuhren 25 bis 30 Personen ins Wochenende. Die Feier der Messe war organisch in den Ablauf des Wochenendes eingebunden. Meist feierten wir am Samstagabend oder, wenn die Gruppe erst am Samstagmorgen angereist war, auch am Sonntagnachmittag am Ende des Treffens. Besonders lebendig ist die Erinnerung an die Gottesdienste, die wir mit Firmgruppen gefeiert haben. Aber die Beschreibung trifft auch auf viele andere Gruppen zu, sowohl in Rinsecke als auch zu Hause. – Es gab in Rinsecke eine Kapelle, aber soweit ich mich erinnere, habe ich da nur ein einziges Mal mit einer Gruppe den Gottesdienst gehalten. Praktisch immer blieben wir zum Gottesdienst in dem großen Versammlungsraum über dem Pferdestall. Diese Entscheidung wurde nie intensiver diskutiert. Ich vermute, weil sie eigentlich nahe lag. Denn in diesem Raum spielte sich am ganzen Wochenende alles ab, was für die Arbeit mit der ganzen Gruppe wichtig war. Das begann schon mit der „Aufwärmrunde“ unmittelbar nach der Ankunft, in der wir versuchten, die schönen und schweren Erfahrungen der vergangenen Woche in den Blick zu nehmen und dabei „in Rinsecke anzukommen“. Bei Wochenenden mit Firmgruppen spielten wir zu Beginn das Spiel mit dem „Kaktus“, um die Namen aller Beteiligten kennenzulernen. Wenn wir im Laufe des Wochenendes in eine neue Thematik einstiegen, geschah das eigentlich immer mit einer Aktion für die gesamte Gruppe. Wenn wir uns bei einzelnen Arbeitsschritten in kleinen Gesprächsgruppen im ganzen Haus verteilten, kamen anschließend alle wieder zum „Plenumsgespräch“ zusammen. Und dann tauschten wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus, die wir in den Kleingruppen miteinander gemacht hatten. Die Luft in dem Raum war also gewissermaßen erfüllt von unseren Empfindungen, Gedanken und Gesprächen.
Und wenn man den Wunsch hat, dass der Gottesdienst vom Leben der Beteiligten erfüllt ist, dann war es eigentlich selbstverständlich, dass wir in diesem Raum auch die Messe feierten. Wir saßen, wie bei den Plenumsgesprächen, in der großen Runde. Im Haus fanden wir immer einen kleinen Tisch, um die Gaben darauf zu stellen. Die „Jugendliederbücher“ hatten wir immer dabei. Und die Aufforderung, Musikinstrumente mitzubringen, stand immer auf dem Informationsblatt, das die Teilnehmer vor dem Wochenende bekamen. Natürlich gab es auch die Stillen, die eher hörend oder nachdenklich mitfeierten. Aber die Zahl derer, die aktiv ihren Beitrag zum Vollzug leisteten, war sicher größer als in den Gemeindemessen zu Hause. Und so erfüllten wir die Aufforderung der Liturgiereform des Konzils, dass möglichst viele sich lebendig und tätig an der Feier beteiligen sollten („actuosa partcipatio“). – Zur Vorbereitung eines solchen Gottesdienstes gehört es selbstverständlich, dass jemand die Lieder aussucht, einer oder eine Gruppe die Fürbitten formuliert, einige den Raum vorbereiten und vielleicht schmücken. Lesung und Evangelium suchte meist der Geistliche aus, der den Gottesdienst mit der Gruppe feierte. Und wenn uns der Ablauf und die Schwierigkeiten und die Erkenntnisse des Wochenendes präsent waren, ergab sich manchmal wie von selbst der biblische Text, der in den Fragen und Überlegungen des Treffens Antwort oder Wegweisung sein konnte. Wegweisung aus der Botschaft Jesu für das persönliche und gemeinsame Leben! – Der Gottesdienst in Rinsecke war meist schlicht und gesammelt. Selten war es nötig, noch viele Worte zu machen, nachdem wir die ganze Zeit schon miteinander im Gespräch waren. Ab und zu machten wir zwar auch ein Gruppengespräch als Form der Predigt. Aber meist genügten ein paar kurze Ausführungen – am Beginn oder nach dem Evangelium –, um die Situation der Gruppe und die Botschaft miteinander in Einklang zu bringen. Die Eucharistie feierten wir normalerweise unter beiden Gestalten, wobei Hostienschale und Kelch von einem zum anderen weitergereicht wurden. Wer nicht teilnehmen wollte, gab sie einfach an seinen Nachbarn weiter. Diese Freiheit des Einzelnen war uns sehr wichtig. Keiner sollte sich gezwungen fühlen oder einfach nur mitmachen, weil die anderen es auch taten. Vor allem bei den Firmgruppen waren manche Jugendliche in der Situation, ihren Weg in oder mit der Kirche neu zu finden. Und wir haben sie dabei ermutigt, sich nicht anzupassen, sondern in eigener Verantwortung zu entscheiden.
Was bei einer solchen Form des Gottesdienstes eigentlich geschieht, ist natürlich nicht nachweisbar. Wenn man daran glaubt, dass es um eine Begegnung zwischen Gott und den Menschen geht und um eine Begegnung zwischen glaubenden Menschen, dann sagt man damit automatisch, dass dieses Eigentliche sich der Beweisbarkeit grundsätzlich entzieht. Die Theologen nennen es ein „Mysterium“, von dem man nur analog sprechen kann. In allem, was man sagt, kann sich eine Spur des Geheimnisses enthüllen, aber mit keinem Wort bekommt man es „zu packen“. Unter diesem Vorbehalt steht dann auch der Versuch, das Geschehen im Gottesdienst unter dem Bild der Begegnung zu beschreiben. Wenn man das, was Jesus im Abendmahlssaal getan hat, so versteht, dann geht es nicht in erster Linie um die äußere Form oder die Historie, sondern um das innere Geschehen. Und das müssen wir nachvollziehen, wenn wir heute Gottesdienst feiern. Wenn wir also in Rinsecke zusammengesessen haben, dann haben wir eine Begegnung gefeiert. Jesus Christus ist in unserer Mitte, nicht fassbar und doch real. Wenn wir die Erzählungen über sein Leben gehört haben (im Wortgottesdienst), dann ist er da wie damals, als er Menschen zum Leben verhalf, ihnen Hoffnung und Zuversicht gab und sie etwas spüren ließ von der heilenden Nähe des Vaters. Er ist da, wie er gegen die Macht der Bosheit und menschlicher Schwäche Vertrauen und Liebe gelebt hat bis zur Hingabe seines Lebens. Und er ist da als der wirklich Lebendige, der auch heute uns anschaut, zu uns spricht und uns heilen will. Weil er da ist, braucht er auch keinen Stellvertreter, der in der Feier die „Rolle“ des abwesenden Herrn übernimmt. – Und wir sind da mit unserer Vergangenheit (der letzten Woche oder des ganzen Lebens), mit den Erfahrungen von Gottesnähe und Gottesferne, mit unseren Bedürfnissen, Nöten und Hoffnungen, mit dem Schönen und Schweren, das unser Leben prägt. Da wir in Rinsecke immer in einem intensiven Austausch miteinander waren, konnte der Gottesdienst auch eine Feier der Begegnung untereinander sein. Wir erfuhren uns nicht als voneinander geschiedenen Einzelmenschen, sondern als Gemeinschaft. Wir waren das, was die junge Kirche von ihrer Versammlung im Gottesdienst glaubte: Corpus Christi Verum – der wahre Leib Christi. (dazu ausführlicher unter „Wie hilft man sich bei Priestermangel“). Das haben wir damals natürlich so nicht formuliert und sicher oft auch nur ansatzweise oder gar nicht vollzogen. Aber wir haben immer wieder eine erfüllte Atmosphäre erlebt. Und die war mitbedingt durch unser Bemühen, unseren Glauben zu leben.
Eine vergleichbare Atmosphäre stellte sich oft auch in den Gemeindemessen ein, nicht immer und auch nicht nach unseren Wünschen. Der Geist weht ja bekanntlich, wo er will. Wenn es aber geschah, dann hatte es auch etwas mit unserer Vorbereitung zu tun. Es war wie in Rinsecke. Wenn wir miteinander im Gespräch waren, unsere Gedanken und Erfahrungen ausgetauscht hatten, wenn wir uns um eine Antwort im Glauben oder nur um ein lebendiges Verständnis der Botschaft Jesu bemüht hatten, dann waren die Voraussetzungen günstig für eine intensive Feier der Begegnung. Dafür ist es unverzichtbar, dass die Gemeinde an vielen Stellen miteinander im Gespräch ist. Sie muss eine Chance haben, Leben und Glauben miteinander zu teilen. Und solche Gespräche können eine Vorbereitung sein für die Feier der Begegnung im Gottesdienst. Sie können aber auch selbst schon eine Chance sein, diese Begegnung zu erleben.
Dafür war es offensichtlich hilfreich, dass in der Konzeption unserer Seelsorge die Gruppe eine so wichtige Rolle spielte. Die begrenzte Zahl von Teilnehmern ist eine Voraussetzung dafür, dass ein wirkliches Gespräch stattfinden kann. Dann muss man allerdings das Gespräch wirklich wollen und nicht die Leute zu Empfängern von Arbeitsmaterial, Anweisungen und guten Ratschlägen degradieren. Nur wenn die Lebenssituation und die Glaubenserfahrungen aller Teilnehmer wichtiger sind als das Wissen und die Beredsamkeit eines „Experten“ , kann es zu einem gemeinsamen Suchen und zu einem Austausch von Glauben und Leben kommen. Und wenn es dabei in zunehmendem Maß um die Botschaft Jesu und um das Kommen seines Reiches geht, dann kann schon in einem solchen Gespräch eine Begegnung mit ihm und untereinander stattfinden (ohne fromme Gefühle oder fromme Sprüche). Und diese Begegnung kann sich dann im Gottesdienst fortsetzen und intensivieren. Eine solche Gesprächsfähigkeit kann man nicht einfach voraussetzen, erst recht nicht bei Gläubigen, von denen man jahrhundertelang nur „Gehorsam“ und Anpassung erwartet hat. Aber auch hier gilt vermutlich die biblische Verheißung: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Wer es nicht für möglich hält, wird es nicht praktizieren können. Und dann braucht es nicht zu überraschen, dass die Feier des Gottesdienstes in erster Linie als Vollzug von Ritualen oder liturgischen Vorschriften oder als persönliche Frömmigkeitsübung missverstanden wird. – Ein praktisches Beispiel für unsere Bemühungen wurde schon erwähnt. Eine Gruppe, die Kindergottesdienste vorbereitete, traf sich jeweils zwei Mal. Beim ersten Treffen versuchten die Teilnehmer, den biblischen Text zu verstehen und in ihre eigene Lebenserfahrung zu übersetzen. Das war die Voraussetzung, um es kindgerecht vermitteln zu können. Aber es war auch ein Versuch, miteinander im Glauben zu wachsen. Und was man selbst erlebt oder verstanden hat, kann man dann auch in Inhalt und Ablauf des Gesprächs mit den Kindern übersetzen. Darum kümmerte sich in diesem Kreis dann eine kleinere Gruppe bei einem zweiten Treffen. – Es gab auch misslungene Versuche. Über viele Jahre und in mehreren Anläufen haben wir versucht, einen Kreis zusammenzubekommen, der die Texte des Sonntags miteinander besprechen sollte. Die Gemeinde hat dieses Angebot nie wirklich angenommen. Als Grund wurde manchmal gesagt, dass freitags am frühen Abend dafür keine gute Zeit sei. Mir selbst haben diese Gespräche im ganz kleinen Kreis einen besseren Zugang zum Evangelium erschlossen. – Auch die musikalische Vorbereitung des Gottesdienstes durch Chor, Combo oder vielleicht sogar Orchester könnte eine Möglichkeit sein, Glauben und Leben zu teilen und dadurch zu einer Feier der Begegnung beizutragen. Doch scheint es oft schwer zu sein, das musikalische Erlebnis gleichzeitig als eine Begegnung im Glauben zu erfahren. Vielleicht könnte man damit eher rechnen, wenn die Chorarbeit auch zu einem vertieften Verständnis der Texte genutzt würde. Das gibt es aber anscheinend in der Praxis nur selten. – Viele Möglichkeiten, Glauben und Leben miteinander zu teilen, ergaben sich auch in der Gemeindekatechese. In den Treffen der Begleiter haben wir immer wieder zu verwirklichen versucht, was oben über das Gespräch in der Gruppe beschrieben ist. Aber auch die Gruppen der Kinder und Jugendlichen bei Erstkommunion, Buße und Firmung verwirklichten immer wieder etwas von diesem Ideal. Die Teilnehmer sollen ja nicht ein Lernpensum absolvieren, sondern im Austausch miteinander soll der Glaube und die Freude am Leben wachsen. Wenn eine Gruppe sich in dieser Weise findet, kann die gottesdienstliche Feier am Schluss zu einer wirklichen Feier der Begegnung werden. Auch manche Firmgottesdienste haben wir erlebt, in denen sichtbar wurde, wie sehr die einzelnen Gruppen eine Gemeinschaft geworden waren. Die innere Verbundenheit zeigte sich zum Beispiel immer wieder daran, dass einzelne Jugendliche den Wunsch hatten, ein anderes Gruppenmitglied solle die Patenschaft für sie übernehmen. Dazu musste dann die Reihenfolge des Empfangs der Firmung festgelegt werden, damit der vorgesehene Pate auch vor seinem „Patenkind“ gefirmt wurde. Und wenn einer aus der Gruppe sich entschieden hatte, sich nicht firmen zu lassen, wurde er gerade dann liebevoll in die Mitte genommen. Und wenn man den Einen oder Anderen während des Firmgottesdienstes anschaute, dann war manch schöne Erfahrung aus der Vorbereitungszeit oder manch klärendes Gespräch wieder ganz gegenwärtig. Oft war auch das Wochenende in Rinsecke wieder lebendig mit seinen intensiven Begegnungen. Wer in diesem Gottesdienst mit offenem Herzen dabei war, konnte die Atmosphäre der Glaubensgemeinschaft spüren.
Wenn alle Gruppen in der Gemeinde an den Auftrag glauben, intensiv Leben und Glauben miteinander zu teilen, werden sie zunehmend zu einer Gemeinschaft im Geiste Jesu. Dann sitzen und beten nicht mehr abgeschottete Individualisten im Gottesdienst nebeneinander, sondern die Feiernden sind wirklich ein Stückchen „ein Herz und eine Seele“. Der Glaube bewährt sich in der Liebe, in der Gemeinsamkeit. Das kann nicht wie auf Knopfdruck plötzlich da sein. Es muss vielmehr wachsen nach dem Maß der Bemühung um Glauben und Leben. Ein Prozess, bei dem wir uns immer irgendwo zwischen toter Masse und liebender Gemeinschaft bewegen. Und je nach Bemühung wachsen wir oder fallen zurück.
45. Team 3
Am 1.Januar 1978 begann Bernd Schellenberger seine Tätigkeit in der Hochdahler Gemeinde. Damit war unser Team vollständig. Es blieb von da an fast zwanzig Jahre in der gleichen Zusammensetzung.
Nachdem Hans Meixner 1972 Hochdahl verlassen hatte, wurde im Gespräch mit Generalvikar Peter Nettekoven geklärt, wie die Zusammenarbeit im Team und die Struktur der Gemeindeleitung aussehen sollten. Das ist in „Team 2“ (Nr. 20) beschrieben.
Angefangen haben wir damals zu dritt: Willy Brähler, Bernd Staßen und Gerd Verhoeven. Und unsere Tätigkeiten waren in den nächsten Jahren ziemlich ähnlich. Wir bemühten uns um eine würdige Feier des Gottesdienstes und eine solide Verkündigung. Für Gerd Verhoeven ging es dabei besonders um eine lebendige und zeitgemäße Sprache. Es war ja die Zeit, wo noch viele Versuche mit Fürbitten und Kanongebeten und einer eigenen Auswahl liturgischer Texte möglich waren. Ich war stark bei der Musik mit Duisburger Messen und Liedern von Piet Janssens engagiert. Willy Brähler gab dem Gottesdienst eine zusätzliche Note durch seinen Dienst als Diakon in Liturgie und Verkündigung. – Seit 1973 waren wir in gleicher Weise aktiv bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion. (vgl. Nr.16 +24). – Für das Leben in der Gemeinde waren wir mit unterschiedlichen Schwerpunkten tätig. In den Ehekreisen waren alle drei aktiv. Gerd Verhoeven inszenierte die wundervolle Vermehrung der Freizeiten von Kindern und Jugendlichen, wozu bis auf den heutigen Tag Lobeshymnen erklingen. Dann ging es mit der Firmvorbereitung, Arbeitskreis Taufgespräche u.a. weiter. Darüber ist hinreichend erzählt worden. Willy Brähler sah es die ganzen Jahre über als eine Aufgabe für den Diakon an, sich um die Kranken zu kümmern. Er machte wöchentlich Besuche im Haaner Krankenhaus und besuchte viele Gemeindemitglieder mit der Krankenkommunion.
1974 kam Hildegard Smoch mit ins Team. Unter der Überschrift „Katholischer Sozialdienst“ hat sie später einmal Ihre Arbeit und Ihren Auftrag für die Gemeinde beschrieben (Aspekte Juni 1978). Laut Satzung war ihr Schwerpunkt die „Jugendfürsorge“. Sie kümmerte sich also um Jugendliche bei Konflikten mit den Menschen der Umgebung. Jugend-Gerichtshilfe war angesagt, wenn einer von ihnen mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Bei Scheidungen konnte es um die Klärung des Besuchsrechts oder um das Sorgerecht gehen. In solchen Situationen war es vermutlich von großem Wert, dass Hildegard Smoch eine Zusatzausbildung als Eheberaterin hatte. In späteren Jahren hat sie auch viele Angebote für Gruppen gemacht. – Angestellt war sie nicht bei der Diözese, wie die anderen Teammitglieder (einschließlich Bernd Schellenberger, siehe unten!). In Hilden gab es eine Gruppe des SKM (Sozialdienst kath. Männer e.V.), ein Zusammenschluss aktiver Gemeindemitglieder. Der hatte sie angestellt für die Gemeinde in Hochdahl. Ihr Büro hatte sie im Kellergeschoß des Pfarrhauses in Sandheide. Und sie war immer dabei, wenn sich das Team mittwochs von 10 bis 12,30 in der Willbeck traf.
Und der fünfte im Bunde war dann also Bernd Schellenberger. Ehe er nach Hochdahl kam, leitete er ein Haus der „Offenen Tür“, einen offenen Jugendtreff der Pfarrei St. Bonifatius in Düsseldorf. Er war Sozialarbeiter und ich lernte seinen Namen kennen, als ich hörte, da wäre einer, der an der Mitarbeit in Hochdahl interessiert sei. Daraus habe ich immer geschlossen, dass das Interesse an einer gemeinsamen Arbeit von ihm ausgegangen war. War der Ruf Hochdahls schon bis in den Süden von Düsseldorf gedrungen? Er sollte und wollte in Hochdahl für die Jugendarbeit zuständig sein. – Zunächst war es schwierig zusammenzukommen, weil sich die Diözese sperrte; sie wollte ihn nicht anstellen. Was genau der Grund war, war mir damals schon nicht ganz klar. Und ich weiß auch nicht, wie das Problem gelöst wurde. Er wurde schließlich zum 1.1.78 angestellt. Damit verbunden (als Voraussetzung?) war, dass Bernd Schellenberger eine zusätzliche Ausbildung machte und Gemeindereferent wurde. – Er ging seine Tätigkeit in Hochdahl mit sehr viel Schwung und Freude an. Im März 1978 erschien ein Artikel über ihn in den Aspekten. Zu dem Zeitpunkt leitete er schon fünf Jugendgruppen mit je 12 Mitgliedern. Dazu hatte er noch zwei Schulungsgruppen für Jugendliche, die später selber eine Gruppe übernehmen wollten. Diese Kombination war ein Prinzip seiner Arbeit. Er wollte nicht möglichst viele Jugendgruppen selber leiten, sondern vor allem das Handwerkszeug für die Gruppenleitung an interessierte Jugendliche weitergeben. Ich erinnere mich, dass er sich im Laufe der Zeit auch sehr intensiv um die Messdiener gekümmert hat. – Und auch er war immer dabei, wenn sich das Team traf.
Im Laufe der Jahre waren viele junge Leute in Hochdahl, die bei uns ein Praktikum machten oder einen Teil ihrer Ausbildung absolvierten. Die waren natürlich ebenfalls immer bei den Dienstgesprächen mit dabei.
46. Bauplanung 1978
Mit der Einweihung von Heilig Geist in Sandheide war 1972 das erste katholische Gemeindezentrum in Hochdahl fertiggestellt. Weitere Räume für den Gottesdienst brauchten wir nicht. Mit Heilig Geist in Sandheide, St.Franziskus in Trills, der evangelischen Neanderkirche in Alt-Hochdahl und dem evangelischen Paul-Schneider-Haus in Millrath hatten wir vier Orte für den Sonntagsgottesdienst, die ziemlich gleichmäßig über das Gebiet der „neuen Stadt“ verteilt waren. Noch nicht vorhanden waren die vorgesehenen Gemeinderäume in Millrath-Ost, für die wir schon 1971/72 mit der Bauplanung begonnen hatten, ohne dass wir dort zunächst zu einem Ergebnis kamen. In Trills mussten wir uns bis in die 80-er Jahre mit der schon erwähnten alten Baracke behelfen. Und das Haus im Stadtzentrum konnten wir erst 1987 beziehen. In der Planung war auch vorgesehen, dass zu den zwei Kindergärten in Sandheide und Trills ein weiterer in Millrath-Ost errichtet werden sollte.
In einem Gespräch zwischen Vertretern der Gemeinde und Generalvikar Feldhoff und Bischof Luthe wurden 1978 die Rahmenbedingungen für die weitere Bautätigkeit in Hochdahl geklärt. Dieses Gespräch ist in den „Aspekten“ von März 1978 dokumentiert. Als Ergebnis der Besprechung wird dort festgehalten, dass keine weitere Kirche gebaut werden sollte. Die übrigen Gemeinderäume sollten - nachdem Sandheide fertig war – an drei weiteren Stellen ausgeführt werden: im Stadtzentrum, in Trills und in Millrath-Ost. Dabei sollte Millrath-Ost Priorität haben, da dort ein entsprechendes Grundstück bereits gekauft und dieser Wohnbereich fast voll ausgebaut war. Das Schaubild zeigt sehr gut, wie die Planung aussah.
Ein wichtiges Ergebnis dieses Gesprächs war, dass die Sondersituation Hochdahls als Neubaugebiet anerkannt wurde. Drei Vereinbarungen waren für uns in der Zukunft sehr hilfreich. – 1. Für den Raumbedarf der Gemeinde sollten schon im Vorhinein die Einwohnerzahlen des Endausbaus zugrunde gelegt werden. Nach den Vorstellungen von 1978 waren das 35.000 Einwohner oder ca. 15.000 Katholiken. Diese Zahlen sind allerdings in der Realität nicht erreicht worden. – 2. Wegen der Größe der Gemeinde und entsprechend den Vorstellungen des Gemeindekonzepts sollte das Bauvolumen als förderungswürdig anerkannt werden, das sich für drei Gemeinden zu je gut 5.000 Mitgliedern ergäbe. – 3. Es sollte berücksichtigt werden, dass die Kirchengemeinde Hochdahl auf den ihr nach der Einwohnerzahl zustehenden Kirchenraum wegen der Kooperation mit der evangelischen Kirche zum Teil verzichtete.
Danach hatten wir die Hoffnung, vielleicht schon im Jahr 1979 mit dem Bau in Millrath-Ost beginnen zu können. Aber die Realität war anders. Die Erzdiözese hatte finanzielle Probleme und unser Bauvorhaben kam nicht auf die Prioritätenliste, die pro Jahr nur vier bis fünf entsprechende Vorhaben zur Finanzierung vorsah. Das war auf Anhieb ziemlich frustrierend, hatte aber eine grandiose Aktivität der Gemeinde zur Folge.
47. Das Haus in Millrath-Ost
Die Geschichte, wie das Roncalli-Haus entstanden ist, lässt sich verhältnismäßig leicht erzählen. Die eigene Erinnerung ist natürlicherweise im Laufe der Jahre verblasst und gibt nur noch einige markante Punkte wieder. Aber die Aspekte aus dieser Zeit enthalten eine sehr ausführliche und genaue Dokumentation der ganzen Entwicklung. Mir scheint, dass es nie vorher oder nachher eine so dichte Folge der Hefte gegeben hat wie zu dieser Zeit. Und wenn man heute darin liest, kann man staunen über die Vielfalt der Themen, die im Leben der Gemeinde zur Debatte standen. Die Ausgabe von Januar 1981 ist ausschließlich dem Bauprojekt gewidmet und diente der Vorbereitung der Gemeinde auf die Pfarrversammlung am 23.Januar 1981. Bei dieser Pfarrversammlung sollte und ist die Entscheidung getroffen worden, ob wir bauen wollten oder nicht. Aus diesem Heft stammt auch die Darstellung der Aufbau-Konzeption der Gemeinde, die bereits in einem früheren Abschnitt zitiert wurde („Eine Gemeinde für 20.000 Katholiken“, Nr. 17). Wer den „Original-Ton“ nachlesen möchte, möge sich die entsprechenden „Aspekte“ aus dem Pfarrarchiv besorgen (April + Juni + Oktober 1980, Januar + März + Juli + September + Dezember 1981, April + Juni 1982).
Das Bauvorhaben Millrath-Ost beschäftigte uns schon seit 1972. In diesem Jahr hatte die Diözese im Bereich für das geplante Subzentrum Millrath-Ost ein Grundstück von 3.000 qm gekauft. Nach der Entscheidung, dort keine Kirche zu bauen, war dieses Grundstück für ein Gemeindehaus und einen Kindergarten vorgesehen. Die Planungen für das Gemeindehaus bewegten sich – auch wegen der Vorgaben durch die Diözese – von Anfang an in einem eher bescheidenen Rahmen. Es sollte dreistöckig gebaut werden. Im Kellergeschoss waren neben Wirtschaftsräumen ein großer Spielraum (ca. 50 qm) und ein Gruppenraum vorgesehen, im Erdgeschoss ein ebenfalls 50 qm großer Gemeinschaftsraum (Senioren, Erwachsene, Werktagsgottesdienst) und zwei Gruppenräume, im Obergeschoss ein Gruppenraum und eine Wohnung von 85 qm für einen Hausmeister. Der Bau sollte als schmaler Riegel den geplanten Platz im Einkaufszentrum nach Westen abschließen. Wegen der Hanglage sollte das Kellergeschoss unter dem Niveau des Platzes liegen und sich nach Westen zu einem Hof für das Gemeindezentrum öffnen. Dahinter war dann das Grundstück für den geplanten Kindergarten. Der Haupteingang ins Haus sollte von dem Platz des Einkaufszentrums in das Erdgeschoss führen. Der Bauplan ist in den Aspekten von Juni 1980 abgedruckt, er scheint aber aus den ersten Jahren der Planungen für Millrath-Ost zu stammen.
Wir sind am Anfang ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass für die Finanzierung des Hauses in Millrath-Ost die Diözese aufkommen würde. Wie so etwas geht, hatten wir ja schon in Sandheide erlebt. Dabei ist über die Höhe der Eigenmittel, die die Gemeinde ja sicher auch für Sandheide aufbringen musste, nicht viel geredet worden. Sie bewegten sich wohl in einer Größenordnung, die zu leisten war. Ganz zuversichtlich gingen die Architekten 1973 daran, die Bauausführung vorzubereiten. Die Baugenehmigung der Zivilgemeinde war schon erteilt, als unsere Wünsche und Vorstellungen abrupt durchkreuzt wurden. Die Diözese verhängte einen Baustopp, weil sie kein Geld mehr hatte; die Kirchensteuereinnahmen waren massiv zurückgegangen. Und bis 1980 ging es dann immer hin und her. Wir hielten unsere Hoffnung hoch, irgendwann bauen zu können und landeten immer wieder unsanft auf dem Boden der Realitäten. Der Kirchenvorstand beschloss 1976, keinen Kindergarten mehr zu bauen. Dadurch reduzierten sich die Kosten von 1,2 Millionen auf 800.000 DM. Die Diözese erstellte 1979 eine Prioritätenliste für alle geplanten Bauvorhaben; wir landeten ohne Chancen auf dem 10.Platz. Durch Baupreissteigerungen gingen die Kosten für das verkleinerte Vorhaben wieder auf 1,1 Millionen. Die Prioritätenliste war nur kurze Zeit verbindlich. Nach einer neuen Regelung konnte eine Gemeinde bauen, wenn sie die vorgeschriebene Eigenleistung aufbringen konnte. Die wurde allerdings beträchtlich erhöht. Wir mussten unter dieser Voraussetzung 400.000 DM selbst finanzieren. Und wir fragten uns fast verzweifelt, wie wir das schaffen sollten. Im Oktober 1980 schlug das „Schicksal“ dann endgültig zu: die Diözese teilte mit, sie könne den Bau überhaupt nicht mehr finanzieren. Wir könnten nur noch 200.000 DM aus dem Sonderbauprogramm bekommen.
Die Vorstellung, dass die Diözese den Bau finanzieren würde, erwies sich also als Illusion. Andere Geldquellen, die wir hätten anzapfen können, waren nicht in Sicht. Es gab in Hochdahl keine Mäzene – auch wenn hinter diesem Satz in den Aspekten ein vorsichtiges Fragezeichen steht. Und wir hatten keine Grundstücke, die sich für den Abbau von Kies und Sand eigneten – wie in einer Nachbarpfarrei. Ein Haus in Millrath-Ost würde es also nur geben, wenn die Gemeinde das Geld selbst zusammenbringen würde. Und ob das gelingen könnte, hing ab von der Leistungsfähigkeit und der Bereitschaft jedes einzelnen Gemeindemitglieds. Die Entscheidung zu bauen, konnte deshalb auch nur von der Gemeinde als ganzer getroffen werden – oder zumindest von einem möglichst großen Teil der Gemeinde. Es hätte nicht gereicht, wenn die Leitung der Gemeinde oder der Pfarrgemeinderat oder der Kirchenvorstand einen entsprechenden Beschluss gefasst hätten, denn sie hätten für die Konsequenzen nicht gerade stehen können. Die Gemeinde musste entscheiden und damit auch für die Realisierung aufkommen.
Allem Anschein nach ist diese Erkenntnis allmählich im Laufe des Jahres 1980 gewachsen. Und sie wurde umso deutlicher, je mehr sich die Hoffnungen auf Hilfe von außen zerschlugen. Es scheint, dass sich dabei ein Gefühl von Befreiung eingestellt hat. Vielleicht hatte das jahrelange Hin und Her uns doch sehr ermüdet und wir waren froh, dass die Situation jetzt eindeutig war. Vielleicht hatten einige auch das Gefühl, endlich nicht mehr als Bittsteller auftreten zu müssen. Es mag ja viele vernünftige Gründe dafür geben, dass in der katholischen Kirche hierzulande die Einnahmen aus der Kirchensteuer zentral verwaltet und verteilt werden. Aber man kann darin auch eine gewisse Entmündigung der Gemeinden
sehen. Jetzt lautete die Frage nur noch: „Machen wir es oder machen wir es nicht?“ Kein Generalvikar, kein Bischof, kein Pfarrer entscheidet für uns oder über uns, wir entscheiden selbst und allein! Das war sicher auch ein kräftiger Schub für das Selbstbewusstsein der Gemeinde und eine starke Motivation, sich der veränderten Realität zu stellen. Diese Entwicklung ist vermutlich auch eine Erklärung für die Stimmung, die sich im folgenden Jahr zunehmend einstellte und die in der Erinnerung noch ganz präsent ist. Diese Stimmung drückte sich zum Beispiel darin aus, dass das Haus ganz deutlich als „unser Haus“ wahrgenommen wurde. Und es zu bauen, wurde zur Herzensangelegenheit. Wie ist es sonst zu erklären, dass selbst eine Familie mit vier Kindern und sicher angespannter Haushaltslage noch bereit war, monatlich 20 DM für Millrath-Ost abzuzweigen?
Ein ganzes Jahr lang hat ein großer Teil der Gemeindemitglieder um die richtige Entscheidung gerungen. Manche Überlegungen waren den Interessierten in der Gemeinde seit Jahren bekannt. Die Aufbaukonzeption wurde erneut durchdacht und besprochen. Millrath-Ost sollte ja eines der drei Gemeindezentren werden. Die geplante Größe der neuen Stadt stand zur Debatte, die ja zu diesem Zeitpunkt nur noch auf 35.000 Einwohner ausgebaut werden sollte (15.000 Katholiken). Ein wichtiges Argument in der Diskussion war die deutlich wahrnehmbare Raum-Not; das Pfarrheim Sandheide konnte längst nicht mehr alle Gruppen und Veranstaltungen aufnehmen, die in der Gemeinde irgendwo unterkommen wollten. Und dass die Gemeinde weiter wachsen würde, war allen klar. Und auch die Bedenken gegen den Bau wurden deutlich formuliert. Die Größe der Summe und die entsprechende Belastung brachte in jeden Klärungsversuch eine deutliche Unsicherheit: „Können wir das denn wirklich wagen“? Keiner konnte ja dafür garantieren, dass der Versuch wirklich gelingen würde. Und auch die weltweite Perspektive kam ins Spiel. Bei allen Bauten, die wir in Hochdahl realisiert haben, wurde immer wieder gefragt, ob das Geld nicht besser den Armen in der Welt gegeben werden sollte. Diese Anfrage ist – bei unterschiedlichen Gelegenheiten – sicher in vielen Pfarreien gestellt worden. Und viele haben versucht, die Spannung zwischen den verschiedenen Aufgaben zu lösen. Trotzdem blieb vor allem bei empfindsamen Menschen ein Unbehagen übrig. – Mir scheint, dass diese Suche – trotz aller schon oft durchgespielten Überlegungen – ein Prozess mit offenem Ergebnis war, bis zur Entscheidung am 23.1.1981. – In dem Klärungsprozess übernahmen Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand eine wichtige Rolle. Sie versuchten in den eigenen Überlegungen und Diskussionen für sich die Entscheidung vorzubereiten und gaben der Gemeinde einen deutlichen Rahmen und viele Argumente für das Gespräch. Unter anderem beschrieben sie mit einigen Rechenexempeln in den Aspekten, wie man sich die Finanzierung vorstellen könnte. Dadurch wurde die beängstigende Aufgabe greifbar und diskutierbar. Ein Beispiel (Aspekte Juni 1980, als noch 400.000 DM aufgebracht werden mussten): die Gemeinde hat 9.500 Katholiken, das entspricht 3.000 Haushalten. 300.000 DM (400.000 DM geforderte Eigenmittel, abzüglich schon angesparter 100.000 DM) geteilt durch 3.000 ergibt 100 DM. Wenn jeder katholische Haushalt einen einmaligen Betrag von 100 DM spendete, könnten wir bauen. Und solcher Beispiele gab es mehrere. Und untendrunter stand der Satz: Und das sollte nicht zu finanzieren sein? Der Optimismus, der sich darin ausdrückt, durchzieht den ganzen Artikel.
Die Entscheidung fiel in zwei Schritten. Der erste ist markiert durch die Pfarrversammlung am 9.Mai 1980. Zu diesem Zeitpunkt galt noch die Vorgabe: wenn 400.000 DM Eigenmittel von der Gemeinde aufgebracht werden, kann gebaut werden. Und die ganzen Überlegungen drehten sich um diese Summe, einschließlich der eben genannten Berechnungen zur Finanzierung. Etwa 140 Gemeindemitglieder, darunter viele Jugendlich, nahmen teil. An diesem Abend ist wohl schon deutlich geworden, dass das Projekt nur gelingen und durchgeführt werden kann, wenn es von allen gewollt ist. Und das muss sich darin zeigen, wie weit die Finanzierung durch die Gemeinde gelingt. Am Ende der Diskussion gab es eine breite Zustimmung der Anwesenden. Offensichtlich erschien den Beteiligten diese Entscheidung schon als sehr tragfähig, denn anschließend wurde es konkret und praktisch: ein Spenden-Konto wurde eingerichtet; die Möglichkeiten zum Einzahlen der Spende wurden ausführlich erläutert; der Kirchenvorstand entwarf ein Flugblatt, das kurz über Planung und Finanzierung informierte; es gab Formulare für eine Einzugsermächtigung; Zahlkarten und Überweisungsformulare wurden an den Kirchtüren ausgelegt. Und wer wollte, konnte mit
5 DM einen „Baustein Gemeindehaus Millrath-Ost“ erwerben. Hängte er den in seiner Wohnung auf, hatte er tagtäglich die große Aufgabe und seine Mitwirkung dabei vor Augen. In den Aspekten erschien die erste Liste, wie das Spendenaufkommen für Millrath-Ost sich entwickelt hatte.
|
5. 5.1980 |
6 075 DM |
|
2. 6.1980 |
17 500 DM |
|
1. 7.1980 |
29 600 DM |
|
1. 8.1980 |
31 600 DM |
|
1. 9.1980 |
34 386 DM |
|
4.10.1980 |
50 200 DM |
Die Zustimmung zu dem Projekt schlug sich also schon in Zahlen nieder. Unter dieser Auflistung steht die Bemerkung: Die Einkünfte aus dem Pfarrfest und dem „Tanz auf der Tenne“ (einer heiter fröhlichen Veranstaltung im Bürgerhaus) seien in der Zahl vom 4.10. noch nicht enthalten. Inzwischen war es nämlich klar, dass der Erlös vieler Veranstaltungen selbstverständlich dem Projekt Millrath-Ost zugute kam. Und wenn man gerade keine Veranstaltung hatte, konnte man sich ja sonst etwas einfallen lassen. Das taten jedenfalls die „Straßenmusikanten“ (mit Waffelstand), die am 17.5.1980 auf dem Hochdahler Markt aufspielten. Und beim „Tanz auf der Tenne“ soll jemand gedichtet haben: „Sagst Du an der Theke ´Prost´, denke auch an Millrath-Ost“.
Der zweite Schritt wurde nötig, als die Diözese ihre Beteiligung an der Finanzierung auf 200.00 DM reduzierte. Bei der Pfarrversammlung am 23.1.1981 fiel die endgültige Entscheidung und die lautete: Wir bauen – aus eigener Kraft. Diese Pfarrversammlung wurde sehr intensiv vorbereitet, vor allem durch das Heft der Aspekte vom Januar 1981, aus dem schon mehrmals zitiert wurde. Alle Themen, die für die Entscheidung wichtig sein konnten, wurden noch einmal zusammengestellt: die Konzeption der Stadtplanung beim Aufbau der „neuen stadt“ – die zukünftige Größe der katholischen Gemeinde – die Aufbau-Konzeption der katholischen Gemeinde – die Anpassung der Gemeindekonzeption an die Wirklichkeit – Millrath-Ost unter ökumenischen Aspekten – eine Chronik des Bauprojektes seit 1972 – ein Modell eines verkleinerten Baukörpers – neue Überlegungen zur Finanzierung – Überlegungen zur künftigen Nutzung – Raumprogramm „Pfarrheim“ für die ganze Gemeinde – eine Anfrage an den Sinn des Ganzen in Form eines „Phantastischen Märchens“ – Fragen und Einwände zum Projekt „Millrath-Ost“ – Ausblick auf das später zu realisierende Haus im Stadtzentrum – Spendenaufkommen bis 1.1.1981. Niemand ist denn auch zur Pfarrversammlung gekommen, um bereits gefasste Beschlüsse abzunicken. Das Gespräch zwischen den 160 Teilnehmern war wohl sehr lebendig. Es gab kritische Stimmen zur Höhe der aufzubringenden Summe, Überlegungen zu einer rationelleren Nutzung der schon vorhandenen Räume, Anfragen zum Aufbaukonzept der Gemeinde. Wie die Aspekte vom März 1981 erkennen lassen, war es eine offene und vertrauensvolle Beratung und der Artikel hält fest, dass am Ende eine überwältigende Mehrheit sich für das Projekt entschied. – Die veranschlagten Kosten konnten durch eine Verkleinerung des Hauses von 1,1 Millionen wieder auf 800.000 DM reduziert werden. Der bisherige Plan sah einen dreistöckigen Bau vor. Jetzt wurde das oberste Geschoss gestrichen. Das bedeutete, dass die Hausmeisterwohnung, ein zweites Treppenhaus und zwei Gruppenräume wegfielen. Dazu soll jemand gesagt haben: „Was brauchen wir einen Hausmeister. Das machen wir selber“. Eine fast prophetischen Voraussage, die sich bis auf den heutigen Tag als wahr erweist!
Dass die Entscheidung nicht leichthin gefallen ist, ließ sich wiederum an der Entwicklung der Spenden feststellen. Der Anstieg war rasant und übertraf selbst optimistische Erwartungen. In St.Franziskus und in Heilig Geist wurde ein „Spendenthermometer“ aufgestellt, auf dem die Gottesdienstbesucher die Zunahme feststellen konnten. Dieses „Spendenthermometer“ erschien auch auf der Rückseite jeder Ausgabe der Aspekte. Und der Blick auf diese Säule wird manchen mit Stolz erfüllt haben, oder auch mit Freude und Dankbarkeit. Wurde doch da schwarz auf weiß sichtbar: wir schaffen es. – Zwischen Mai 1980 und Juni 1982 sind fast 250.000 DM aufgebracht worden. Vermutlich waren auch Einzelne dabei, die eine größere Summe gespendet haben. Aber nicht als „Mäzene“, sondern als Mitglieder der Gemeinde, denen die Zukunft dieser Gemeinde am Herzen lag. Sehr viele Andere konnten nur weniger aufbringen. Aber sie taten es aus der gleichen Gesinnung. Am 16.3.1982 waren 574.848 DM bezahlt – darin sind außer den Spenden die 200.000 DM von der Diözese und die angesparten Mittel im Haushalt der Pfarrei enthalten. Für den Rest, der noch benötigt wurde, hatte irgendeiner eine clevere Idee. Die erschien als Frage in den Aspekten: Wollen Sie nicht eine Bank eröffnen? Gemeint war damit, ob nicht einzelne Hochdahler der Kirchengemeinde ein Darlehen geben könnten, dass zu vergleichbaren Bedingungen verzinst und getilgt werden sollte wie bei einer Bank. Da in diesem Fall die Spareinlage nicht erst durch den Service der Bank zum Darlehen wurde, war das Geld für die Kirchengemeinde wesentlich billiger. 66.000 DM sind auf diesem Weg in die Finanzierung des Hauses geflossen. Und es ist zu vermuten, dass mancher Darlehensgeber irgendwann auf die Rückzahlung verzichtet hat.
Schon bei den frühen Überlegungen zur Finanzierung des Hauses kam aus dem Pfarrgemeinderat der Vorschlag, einen Teil der Kosten durch Eigenleistung am Bau aufzubringen. Die Fachleute sahen dafür aber wenig Möglichkeiten. Das sei wohl nur beim Ausschachten, beim Innenausbau und den Außenanlagen machbar und dafür könne man nur etwa 50.000 DM ansetzen. Unbekümmert um diese Bedenken erschien dann aber Ende Mai 1981 eine Gruppe von starken Männern, um mit Schaufel und Schubkarre mit dem Aushub der Baugrube zu beginnen. Und es wird erzählt, dass sie gar nicht besonders frustriert waren, als der Bagger nach einigen Tagen ihre ganzen Bemühungen zunichte machte. Sicher überliefert ist auch, dass die beiden Hilfswilligen, die (natürlich unter fachkundiger Aufsicht) die Elektroinstallation ausführten, schon sehr viele Löcher in die Wände gestemmt hatten. Da kam der leitende Architekt und sie mussten alles wieder zuschmieren und die Löcher an die richtige Stelle setzen. Diese Eigenleistung am Bau hat sich finanziell nicht über den geschätzten Betrag hinaus ausgewirkt. Sie zeigte aber, wie hoch die Identifizierung mit dem Bau war. Und die es gemacht oder gesehen haben, spürten noch intensiver: Das ist unser Haus.
Es wurde also gebaut. Ende Mai 1981 wurde die Baugrube ausgehoben. Den Bagger bediente zunächst Peter Giesen aus dem Pfarrgemeinderat, und danach Gotthard Pollok aus dem Kirchenvorstand. Im Juni begannen die Rohbauarbeiten. In den Aspekten von September 1981 ist ein Foto, auf dem das Untergeschoß fertig gemauert ist und die Verschalung für die erste Decke angebracht wird. Das war die Situation Ende Juli. Im Dezember-Heft ist das fertige Haus abgebildet. Nach dem vielen Hin und Her seit 1972 und der intensiven Phase der Entscheidungsfindung war die Ausführung schnell und reibungslos. Der Innenausbau zog sich dann noch bis ins nächste Jahr hin. Insofern war innen drin noch alles „Rohbau“ als die Gemeinde am 21. November 1981 – gewissermaßen wie bei einem zünftigen Richtfest – das Haus „in Besitz nahm“. Die Beteiligung war groß, die Freude über das gelungene Werk spürbar. Und die unverputzten Wände, die provisorisch an der Decke befestigten Strippen und die fehlende Inneneinrichtung gehörten zum „Ambiente“, das dieses Fest in der Erinnerung so unverwechselbar macht. Vom 4. bis 6.Juni 1982 wurde das Haus mit einer schlichten Einweihungszeremonie und einem heiteren Fest seiner Bestimmung übergeben.
Vorher hatte der Pfarrgemeinderat und immer wieder auch andere Gemeindemitglieder sich Gedanken gemacht, wie denn das Haus heißen sollte. In der entsprechenden Sitzung des Pfarrgemeinderats muss es ziemlich lustig zugegangen sein, wie Joseph Boscheinen in den Aspekten vom Juni 1982 berichtet. Es gab viele nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge, die trotzdem etwas von dem trafen, was das Haus für die Gemeinde sein sollte. „Gute-Hoffnungs-Hütte“, „Synodenschuppen“, „Konzilshütte“. Die Erneuerung des Konzils hatte vielen in der Gemeinde die Augen dafür geöffnet, welche Würde sie als Volk Gottes hatten. Und diese Erkenntnis hatte sich im Bewusstsein so festgesetzt, dass man sie in ungewohnten, witzigen Bildern ausdrücken konnte. Deshalb erscheint es als natürliche Folge, dass man dem Haus den Namen „Roncalli-Haus“ gab. Wer nicht so ganz Bescheid wusste, fragte hinterher manchmal, was denn das Haus mit dem Zirkus Roncalli (der zu der Zeit in Düsseldorf und Umgebung gastierte) zu tun hätte. Wir haben ihn dann wohl aufgeklärt, dass „Roncalli“ der Familienname von Papst Johannes XXIII. sei und was die Kirche und wir in Hochdahl diesem großen Mann verdankten. Und so haben wir denn im Roncalli-Haus, im Treppenabgang ins Untergeschoss, ein großes Poster dieses gütigen und glaubensstarken Mannes angebracht. Bis heute ist es ein Bekenntnis und ein Zeichen der Hoffnung, welchem Geist dieses Haus dienen soll.
Das Obergeschoss war aus dem Plan gestrichen worden, um die Baukosten tragbar zu machen. Wer würde sich denn jetzt um das Haus kümmern, wenn es keinen Hausmeister gab? Man musste ja damit rechnen, dass interessierte Mitmenschen bald feststellen würden, dass das Haus manchmal mehrere Tage und vor allem nachts unbeaufsichtigt war. Ein einziges Mal ist dann wirklich nachts eingebrochen worden. Die unfreundlichen Zeitgenossen waren gerade dabei, die nicht einmal besonders wertvolle Musikanlage wegzutragen, als die Polizei erschien. Wir haben nie erfahren, welcher freundliche Nachbar ein wachsames Auge auf unser Haus gehabt hatte. – Aber „sich kümmern“ bedeutet ja mehr. Dafür entwickelte sich eine neue Möglichkeit. Wie das geschehen ist, ist nicht klar: Das Haus bekam ein Leitungsteam, Barbara Wiese, Elisabeth Hellmich und Joseph Boscheinen. Sie haben eigenverantwortlich und mit großem Einsatz dafür gesorgt, dass das Haus zu einem Mittelpunkt und Sammelpunkt für das Leben der Gemeinde wurde. Und für alle Aufgaben fühlten sie sich zuständig – sie besorgten Reinigungsmittel für die Putzfrau, ersetzten erloschene Glühbirnen, vermieteten die Räume an Familien und Vereine, verwalteten Schlüssel und Gerätschaften, waren Ansprechpartner und Hilfe bei der Vorbereitung von Festen, waren immer wieder im Haus zu sehen und zu erleben. Und tatkräftig halfen sie, Gruppen der Gemeinde zusammenzuhalten, ob Jugendliche oder Senioren. Dieses Leitungsmodell war so erfolgreich, dass es nach einiger Zeit auch für die Gemeindehäuser in Sandheide und Trills übernommen wurde. Bis heute gibt es im Prinzip für das Roncalli-Haus die gleiche Form der Leitung, auch wenn die verschiedenen Aufgaben auf mehrere Personen verteilt sind, damit die Belastung für den Einzelnen nicht so hoch ist.
Aber der Hausmeister muss doch abends dafür sorgen, dass alle Lichter gelöscht, die Fenster geschlossen und die Türen versperrt sind. Wenn die letzte Gruppe um 22 Uhr das Haus verlässt, kann es doch sonst vorkommen, dass eine Tür die ganze Nacht offen bleibt. Aber: ohne Hausmeister geht es auch! Von Anfang an, also inzwischen seit fast 40 Jahren, gibt es einen so genannten Schließdienst. Abend für Abend erscheint ein Mensch (oder im Winter wegen der Dunkelheit auch zwei) aus der näheren oder weiteren Umgebung, um das Haus „nachtfest“ zu machen. Wer für diese Aufgabe gerade auf dem Plan steht, kommt und kontrolliert, ob alle Fenster geschlossen sind, nirgendwo Wasser läuft und ob der Herd abgestellt ist und verlässt das Haus wieder, indem er die Außentür sorgfältig abschließt. Dieser Dienst wechselt wöchentlich, die Zahl der Leute, die mitmachen, ist also beträchtlich. Und das funktioniert immer noch. Im Laufe der Zeit sind natürlich Einzelne ausgeschieden und Neue hinzugekommen. Manchmal waren es Leute, die sonst von außen gesehen keinen intensiveren Kontakt zur Gemeinde hatten. Einmal im Jahr werden die Teilnehmer am Schließdienst zu einem Treffen eingeladen. Und wenn ich es recht sehe, ist das keine Belohnung für „Ehrenamtliche Mitarbeit“ (das „Ehren-Amt“ gibt es bekanntlich nicht), sondern ein gemütliches Zusammensein einer speziellen Gruppe der „Freunde des Roncalli-Hauses“.
Und wieder musste die Diözese sparen. Es war 2005 bis 2007. Die Maßnahmen liefen unter dem anspruchsvollen Titel „Zukunft heute“. Wie viele andere Gemeinden traf es uns mit der Forderung, die Flächen in den Gemeindehäusern zu reduzieren. Und sehr vernünftige Leute meinten, am einfachsten sei es, das Roncalli-Haus zu verkaufen. Die Überlegung war nicht unsinnig, denn das Gebäude stand allein und war nicht einer Kirche zugeordnet wie in Trills oder Sandheide. Aber „unser Haus“ verkaufen? Eine Dame, die sich bei den Spenden deutlich beteiligt hatte, regte sich auf und sagte, dass ein Verkauf ja nun überhaupt nicht Frage käme. Und wenn das doch geschehen würde, würde sie ihr Geld zurückverlangen. Als diese Episode erzählt wurde, begriff ich allmählich, was wirklich auf dem Spiel stand. Es wäre nicht nur menschlich unanständig gewesen, das Haus zu veräußern, das durch die Spenden und die Arbeitskraft von Gemeindemitgliedern errichtet worden war. Es wäre ein großes Unrecht gewesen. Denn die Beteiligten hatten an dem Haus gewissermaßen Teileigentum erworben. Das wäre natürlich nicht einklagbar gewesen, aber es war eine prägende Realität. – Nach einer intensiven Information und gemeinsamen Klärung waren 250 Hochdahler bereit, für den Unterhalt des Roncalli-Hauses (wieder) Geld zu geben. Diese Selbstverpflichtung war auf fünf Jahre begrenzt und ist inzwischen von Vielen verlängert worden. Zwischenzeitlich brauchten sie sogar zwei Jahre lang nur die Hälfte zu zahlen, weil das Haus auch mit einer kleineren Summe unterhalten werden konnte. Ein Verein wurde für die Trägerschaft gegründet. Der kümmert sich jetzt um das Roncalli-Haus.
48. Kindergarten Millrath-Ost
Das Roncalli-Haus war also fertig. Von der ursprünglichen Planung für Millrath-Ost fehlte jetzt nur noch der Kindergarten. Auf den Bau einer Kirche hatten wir schon 1972 verzichtet weil für den Sonntagsgottesdienst das Paul-Schneider-Haus zur Verfügung stand.
Im Juli 1975 waren die Vorbereitungen für den Bau des Gemeindehauses und des Kindergartens in Millrath-Ost weit fortgeschritten. Die Zivilgemeinde hatte die Baugenehmigung erteilt, die Pläne waren schon gezeichnet, da machte ein Baustopp der Kölner Diözese einen Strich durch das ganze Vorhaben. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer waren massiv zurückgegangen und es musste gespart werden. Wie es kam, dass wir nach einigen Jahren dann doch das Roncalli-Haus eröffnen konnten, ist im vorigen Abschnitt erzählt worden. Der Kindergarten aber wurde ganz gestrichen. Damit sollten zunächst die Kosten reduziert werden, damit wir wenigstens das Haus bauen konnten. Aber ein Jahr später war klar, dass die Kirchengemeinde überhaupt nicht mehr in der Lage sein würde, einen Kindergarten zu errichten.
Im Mai 1979 beauftragte der Jugend- und Sozialausschuss der Stadt Erkrath die Verwaltung, mit der katholischen Kirchengemeinde in Verhandlungen einzutreten über die Errichtung eines Kindergartens auf dem ursprünglich vorgesehenen Gelände. Vorausgegangen war eine Vereinbarung der Stadt mit der Pfarrei Unterbach über den Bau eines Kindergartens in dem Erkrather Stadtteil Unterfeldhaus. Auf einem Grundstück der Kirchengemeinde wollte die Stadt einen Kindergarten errichten und ihn der Gemeinde in Trägerschaft übergeben. Nach diesem Modell sollte auch in Millrath-Ost gebaut werden. Nach einem Gespräch zwischen der Stadt, dem Kirchenvorstand und der Diözese erklärte der Kirchenvorstand sein Einverständnis. Die Ausführung dieser Vereinbarung verzögerte sich dann zwar noch einige Zeit. Aber schließlich waren sich Kirchengemeinde und Stadt einig und der Kindergarten wurde gebaut nach den Vorgaben, die auch für Unterfeldhaus gültig gewesen waren.
Das Titelbild der Aspekte vom Mai 1987 zeigt den fertigen Kindergarten. Und der Kommentar zu dem Foto meint: Innen so schön wie außen ist der neue Kindergarten an der Tannenstraße. Viel Phantasie haben die Architekten Kurt Günßler und Franz-Josef Klother auf das neue Haus verwandt und der Bauherr, die Stadt Erkrath, hat es sich etwas kosten lassen! Auf dem Grundstück der katholischen Kirchengemeinde – das Roncalli-Haus ist unmittelbar nebenan – hat die Stadt Erkrath den Bau errichtet und den Kindergarten dann der katholischen Gemeinde in Trägerschaft übergeben. Wie man hört, fühlen sich Erzieherinnen und Kinder in dem neuen Heim ausgesprochen wohl…
49. Gemeindekatechese 4
Arbeitskreis Taufgespräche
Das erste Kind, das ich in Hochdahl getauft habe, war die Tochter eines Paares, das mit mir im gleichen Haus wohnte. Wir gehörten zu dem Kreis der Hausbewohner, die in den ersten Monaten eine gute Beziehung zu einander entwickelt haben. Wir haben viel miteinander gefeiert und uns prächtig verstanden. Noch Jahre später haben die Eltern mich daran erinnert, dass ich ihre Tochter als erstes Kind getauft hätte. Das war für sie anscheinend etwas Besonderes. Und als das Kind herangewachsen und im Firmkurs war, hat der Vater wegen winterlichen Wetters und schlechter Straßenverhältnisse mich dazu überredet, die Jugendlichen mit einem Bus statt den sonst üblichen Privat-PKWs nach Rinsecke fahren zu lassen. Und er hat den Bus bezahlt. Das Taufgespräch verlief dementsprechend in einer lockeren, vertrauensvollen Atmosphäre. Ich bezweifle aber, ob wir viel Klärendes über Sinn und Bedeutung der Taufe besprochen haben. Ich vermute, dass wir nicht einmal den Ablauf durchgegangen sind. Dafür war halt der Kaplan zuständig und der würde es – so gut er konnte – machen. Dass alle gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen würden, war damals den meisten noch bekannt. So oder so ähnlich habe ich vermutlich in den nächsten Jahren die Vorbereitung der Eltern auf die Taufe ihrer Kinder gehandhabt. Eine sehr dürftige und hoch problematische Praxis!
Ich habe noch immer den mit einem leichten Stöhnen (oder manchmal mit Zorn) verbundenen Ausspruch im Ohr: „Wir taufen uns eine Kirche von Ungläubigen zusammen.“ Da uns sonst eine intensive Auseinandersetzung mit dem Glauben bei der Vorbereitung der Sakramente so wichtig war, machte uns unsere Taufpraxis unzufrieden. Mit wem sollten die Eltern ihre Vorstellungen von der Taufe besprechen, um zu begreifen, dass bei diesem Vorgang die entscheidende Veränderung im Leben eines Menschen geschieht? Wie sollten sie verstehen, dass „ein ganz neues Leben“ möglich wird? Und wenn sie Fragen hatten zu Sinn, Ablauf und ihrer Beteiligung an der Feier? Und wenn sie unsicher waren, ob sie ihr Kind überhaupt taufen lassen sollten? Die Aussage: „Mein Vater ist getauft worden, ich bin getauft worden, das Kind soll auch getauft werden“, mag zwar ehrlich gemeint sein, dürfte aber unsicheren Menschen kaum weiterhelfen. Fragwürdig war auch das Bild von Kirche, das die Eltern bei dieser Art von Taufpraxis erlebten. Kirche war wieder der Priester, der für alles zuständig war und der alles fest in der Hand hatte. Da das für alle andern auch entlastend war, hat man diese Rollenverteilung sicher oft dankbar angenommen. Und oft war es auch für den Priester bequem, sich am Gewohnten entlang zu hangeln. Aber wenn das Kind durch die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird, muss die „Gemeinde“ doch irgendwo erfahrbar werden.
Ein Arbeitskreis „Gemeindekatechese“ des Pfarrgemeinderats überlegte deshalb 1978, wie man nach dem Muster der Vorbereitung auf Erstkommunion, Buße und Firmung auch die Gestaltung der Taufvorbereitung neu entwickeln könnte. Die Adressaten wären dabei die Eltern der Taufkinder. Und wie bei den anderen Formen wäre es die Aufgabe der Gemeinde, durch eine besondere Gruppe von interessierten Gemeindemitgliedern die Eltern auf dem Weg zur Taufe zu begleiten. Im Referat Gemeindekatechese des Erzbistums Köln machte man sich etwa zur gleichen Zeit Gedanken über eine neue Form der Taufkatechese. Dieses gleichzeitige Interesse machte es möglich, die gute Zusammenarbeit zwischen Gerd Verhoeven, Klaus Tigges und Ernst Werner aus der Erarbeitung der Firmkonzeption weiterzuführen. Ernst Werner war bereit, die Hochdahler Gemeinde bei ihren Überlegungen zu einer neuen Taufvorbereitung zu unterstützen und eine entsprechende Gruppe zu begleiten. In einem Praxisbericht (Ernst Werner, Die Taufe in der Gemeinde: Handreichungen für Taufgespräche mit Eltern, Kösel 1981) schildert er, wie diese Arbeit abgelaufen ist. „Über ein Jahr lang traf sich monatlich der neu gebildete Arbeitskreis Taufgespräche. Der Pfarrer hatte 15 Damen und Herren aus der Gemeinde dazu gewinnen können. Teils waren es ehrenamtliche Katecheten, die schon bei der Erstkommunion oder Firmung mitgearbeitet hatten. Teils aber auch junge Eltern, die sich selbst mit der Frage nach der Taufe konfrontiert sahen. … Die einzelnen Treffen vermittelten Einblick in einige grundlegende theologische und katechetische Zusammenhänge. Daneben nahm aber auch der persönliche Austausch über den eigenen Glauben breiten Raum ein. Schließlich ging es gegen Ende dieser Vorbereitungsphase um praktische Einübung von Gesprächsführung und methodische Hilfen für das Gruppengespräch. Auch diese lange Vorbereitungszeit konnte die Ängste nicht wegnehmen: Kann ich mir das überhaupt zumuten, ein Taufgespräch zu führen? Aber es bestand dennoch die Meinung: ‚Wir müssen halt mal anfangen und Erfahrungen sammeln’.“
Im April 1979 wurden zum ersten Mal Eltern, die ihr Kind zur Taufe angemeldet hatten, zu Taufgesprächen eingeladen. Und seit diesen Anfängen ist der organisatorische Rahmen der Taufvorbereitung über viele Jahre stabil geblieben. Getauft wurde einmal im Monat, meist am letzten Sonntag, in einem besonderen Gottesdienst am Nachmittag. Die Taufgespräche fanden in wöchentlichem Abstand an drei Abenden vor der Taufe statt. Der Geistliche, der die Taufe spenden sollte, war bei diesen Abenden normalerweise nicht dabei. Die Eltern sollten die Möglichkeit haben, offen und ehrlich über sich, ihren Glauben und ihre Beziehung zur Kirche zu sprechen. Vielleicht hätten sie das aus lauter Ehrfurcht vor dem Herrn Pfarrer in seiner Gegenwart nicht so leicht getan. Wenn er sie dann in der Woche vor der Taufe zu Hause besuchte, war das Gespräch weniger belastet, weil es in der häuslichen Atmosphäre bei den Eltern stattfand und weil einige schwierige Fragen vielleicht schon an den Gesprächsabenden geklärt worden waren. Und vielleicht haben manche Eltern diesen Besuch auch als ein Zeichen der Wertschätzung verstanden.
Die Begleitung bei den Gesprächen war Aufgabe der Gemeinde. Die drei Mitglieder aus dem „Arbeitskreis Taufgespräche“, die die Abende jeweils leiteten, mussten den Inhalt und den Ablauf der Treffen selbst gestalten. Dabei stellte sich natürlich im Laufe der Jahre eine bevorzugte Thematik und Aufeinanderfolge heraus. Vielfach ging es am ersten Abend um „die Annahme des Kindes“. Oft brachten die Eltern die ersten Bilder mit und erzählten von den Freuden und Belastungen der ersten Wochen und Monate. Da die Eltern alle in der gleichen Situation waren, war dieser Einstieg hilfreich und führte oft zu einer ersten Erfahrung von Vertrauen und Zusammengehörigkeit. – Waren bei dem Tauftermin mehrere Familien beteiligt, die noch nicht lange in Hochdahl lebten, dann konnte dieser erste Abend auch schon einmal zu einem „Begrüßungsabend“ werden. Die einen erzählten von ihrem Leben am bisherigen Wohnort und die anderen von den Eigenheiten und Möglichkeiten in der Hochdahler Gemeinde. – Ein anderer thematischer Schwerpunkt waren die Symbole der Taufe: Wasser, Licht, Salbung, Segen. Darum ging es oft am zweiten Abend. Je nach Zusammensetzung und Gesprächsfähigkeit der Gruppe war es dabei manchmal möglich, die eigentliche Bedeutung der Taufe und die Konsequenzen für das Leben des Christen sichtbar werden zu lassen. Allerdings haben die Begleiter immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen nach dem Glauben oft an ganz unerwarteter Stelle auftauchten. Und dass es dann darum ging, gemeinsam nach der Antwort zu suchen. Das Thema „Symbole“ verwies aber auch auf sehr praktische Fragen im Rahmen der Tauffeier: an welchem Taufbrunnen (das heißt: in welcher Kirche) findet die Taufe statt, wann wird die Taufkerze an der Osterkerze entzündet, wie ist das mit dem Segen der Eltern für ihre Kinder usw. – Am dritten Abend wurde normalerweise der Ablauf der Feier vorbereitet. Dazu wurde den Eltern beim Treffen vorher (zumindest in den späteren Jahren) eine Mappe mit vielen Texten und Liedern mitgegeben, damit sie ihre Wünsche für die Feier klären konnten. Und die Gebete, die sie dann aussuchten, trugen Eltern und Paten und sonstige Angehörige in der Feier selber vor: Einleitungsgebete, Texte zu Sinn und Wirkung der Taufe, manchmal auch die biblische Lesung, die Fürbitten und ein Segensgebet vor dem Schluss-Segen.
Es hat natürlich einige Zeit gedauert, bis die Gemeinde diese neue Form der Taufvorbereitung angenommen hat. Wir sind dabei nicht gewaltsam vorgegangen, sondern haben immer wieder zu überzeugen versucht. Und je länger wir es machten, umso mehr sprach sich herum, welche Vorteile diese Vorbereitung und die gemeinsame Taufspendung hatten. Es zeigte sich, dass die Eltern viel mehr Erwartungen und Wünsche hatten, als bisher sichtbar geworden war. Die maulende Abqualifizierung (sonst vielfach bei der Erstkommunion), die Eltern seien uninteressiert, erwies sich eindeutig als böswillige Unterstellung. Die Begleiter berichteten, sie hätten sich manchmal von der Fülle der Bedürfnisse restlos überfordert gefühlt. Und sie mussten sich deutlich zur Bescheidenheit ermahnen. Die begrenzte Zeit und die wenigen Treffen reichten oft nicht aus, wichtige Fragen des Glaubens und der Lebensführung intensiv und grundlegend zu klären. Diese Erfahrung machten aber die Begleiter der Firmvorbereitung auch immer wieder. Obwohl sie mit den Jugendlichen ein halbes Jahr zusammen waren, vermissten sie oft den ganz großen Durchbruch. Und die Ursache dafür suchten manche dann bei sich selber. Als „Therapie“ bekamen sie dann immer den Spruch zu hören: „Sie können nicht in kurzer Zeit erreichen, was jahrelang nicht gelebt worden ist“. Das Ziel im Auge zu behalten, sich dann aber nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, verlangt viel Gelassenheit und Gottvertrauen. – Die Taufgespräche waren für manche Eltern – besonders für neu Zugezogene – eine Chance, in der Gemeinde ein Stück Heimat zu finden. Manche Eltern setzten den Kontakt, der entstanden war, in einer „Mutter-Kind-Gruppe“ fort. In zwei Fällen ist aus der Begegnung in den Taufgesprächen ein neuer Ehekreis entstanden. Und mehrmals bekamen Teilnehmer so viel Geschmack an der Arbeit, dass sie ihre guten Erfahrungen auch an andere weitergeben wollten und im „Arbeitskreis Taufgespräche“ mitmachten. – Einmal im Jahr lud der Arbeitskreis Taufgespräche die Eltern, die ihr Kind im Jahr davor hatten taufen lassen, zu einem gemeinsamen Nachmittag ein. Am Anfang stand – zumindest in den späteren Jahren – ein kurzer Gottesdienst, bei dem die Taufe noch einmal lebendig werden konnte. Danach folgte ein oft lebendiger Austausch mit vielen Bildern und Erzählungen über die Erlebnisse seitdem. Dieses Treffen war in den ersten Jahren im Roncalli-Haus, später in der Weihnachtzeit in Heilig Geist. Und wer das Bedürfnis hatte, konnte dabei die bei der Taufe entstandenen Kontakte noch einmal auffrischen.
Wie zu erwarten ist es auch vorgekommen, dass einzelne Eltern eine Einzeltaufe im Rahmen der Familie wünschten und auch durch viele Argumente nicht umzustimmen waren. Oder es gab Notlagen oder terminliche Engpässe, die eine Teilnahme an der gemeinsamen Vorbereitung schwierig oder unmöglich machten. Wir haben es dann nicht zum Konflikt kommen lassen oder sogar die Taufe verweigert. Wir haben nachgegeben oder eingesehen, dass in dieser Situation der normale Weg nicht der richtige gewesen wäre. Es sollte uns ja immer um die Menschen gehen und nicht darum, Prinzipien oder einmal getroffene Entscheidungen durchzusetzen. Denn „wir sind für die Leute da, nicht die Leute für uns!“
Durch die heutigen Lebensbedingungen sind manche Eltern unsicher geworden, ob sie ihr Kind überhaupt taufen lassen sollen. Und nicht wenige wählen den Ausweg, die Entscheidung zu verschieben; das Kind soll später selbst entscheiden. Nach den ursprünglichen Überlegungen sollten die Taufgespräche auch in dieser Situation eine Klärung ermöglichen. Wer noch unsicher war, sollte erst mal an den Gesprächen teilnehmen und dann entscheiden, ob das Kind getauft werden sollte oder nicht. Das hätte vorausgesetzt, dass die Eltern sich nicht gemeldet hätten, um das Kind zur Taufe anzumelden, sondern um an den Taufgesprächen teilzunehmen. Dann wäre die Entscheidung zunächst offen geblieben. Allem Anschein nach ist das – zu Anfang – nur in einem Fall so gewesen und die Eltern haben zu diesem Zeitpunkt nach den Gesprächen das Kind nicht taufen lassen. In allen anderen Fällen ist der Ablauf anders: die Eltern rufen im Pfarrbüro an, um das Kind zur Taufe anzumelden; die Entscheidung ist dann schon gefallen.
Solange es noch gesellschaftliche Gepflogenheit ist, Kinder taufen zu lassen, scheint es nicht möglich zu sein, die Entscheidung im Gespräch und in der Auseinandersetzung (auch in und durch die Gemeinde) reifen zu lassen und dann erst zu taufen. Heute kann man wohl nur versuchen, die bereits getroffene Entscheidung in den Taufgesprächen zu vertiefen und vom Glauben her zu beleuchten. Aber auch dafür lohnt sich der Aufwand, den wir mit den Taufgesprächen getrieben haben.
In den späteren Jahren gab es einen eigenartigen Konflikt, von dem gesprochen werden muss. Es ging um die „Absage an das Böse“. Einige Taufbegleiter wollten unbedingt, dass im Glaubensbekenntnis die Frage wegfallen sollte: „Widersagen Sie dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können?“ Sie meinten, Gott habe die Kinder doch von vorneherein schon angenommen und damit seien sie doch dem Bösen nicht mehr unterworfen. Es ist nie ganz klar geworden, welche Vorstellungen da im Hintergrund wirklich vorhanden waren. Aber man kann vermuten, dass es um eine bestimmte Interpretation von Erbsünde ging. In der Tradition wurde ja manchmal der Eindruck erweckt, dass damit wirklich eine vorgängige „Befleckung“ des Menschen gemeint sei, auch wenn der Unterschied zwischen Erbsünde und eigener Sünde heftig betont wurde. Einige Begleiter haben ihre Abneigung gegen diese Frage noch anders begründet: sie erwecke den Eindruck einer falschen Sicherheit. Man könne ja kaum so tun, als ob man schon ein für alle Mal mit dem Bösen fertig sei. Man könne allerhöchstens versuchen, sich dem Bösen zu widersetzen. Wir hätten damals diesem Unbehagen nachgehen müssen. Vielleicht hätte eine veränderte Formulierung das Problem schon beseitigt, zumal das Wort „widersagen“ aus dem gebräuchlichen Wortschatz fast vollständig verschwunden ist.
Der Arbeitskreis Taufgespräche hatte eine Eigenart, die ihn von den anderen Gruppen zur Vorbereitung der Sakramente unterschied. Bei Erstkommunion, Buße und Firmung wechselte die Zusammensetzung der Begleiter von Jahr zu Jahr, demgegenüber war die Gruppe für die Taufgespräche über viele Jahre stabil. Natürlich gingen Einzelne zwischendurch weg und andere kamen dazu, aber der Kern der Gruppe blieb über lange Zeit zusammen. Vielleicht war das der Grund, weshalb der Arbeitskreis bei manchen Gelegenheiten eher einem Familienkreis als einer Begleiterrunde glich. Wie viele andere Gruppen fuhr der Arbeitskreis jedes Jahr einmal nach Rinsecke. Und mehrmals machte die ganze Familie – Ehepartner und Kinder – das Wochenende mit. Vierzig Personen und mehr belegten dann beide Häuser in Rinsecke. Und während die Mitglieder des Arbeitskreises die Vorträge von Spiritual Wolfgang Kraft anhörten, machten die anderen eine Wanderung oder einen Besuch im Freizeitpark. Auch diese Vorträge waren eine Besonderheit dieses Arbeitskreises. Sonst war unsere bevorzugte Arbeitsweise das Gruppengespräch. Die Beteiligung von Wolfgang Kraft war dagegen immer ein biblisch fundierter und theologisch anspruchsvoller Vortrag. Und einen ganzen Tag lang still und konzentriert zuzuhören, war für die meisten nicht so einfach. Aber nach einer gewissen Zeit der Gewöhnung wollte keiner der Teilnehmer mehr darauf verzichten.
Sollen die Taufgespräche eine Hilfe zum Verständnis der Taufe und eine Klärung des eigenen Glaubens sein, dann dürfen sie auf keinen Fall zu einer Routineübung werden. Entscheidend ist vor allem, dass die Begleiter ihren eigenen Glauben immer wieder in Frage stellen. Etwas von der Unsicherheit, die Ernst Werner am Schluss seines Praxisberichts erwähnt, müsste immer mit im Spiel sein. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass der Begleiter das weiterzugeben versucht, was er immer schon gewusst hat. Oder er tritt als der Wissende und Überlegene auf. Und dann ist kein Vertrauen möglich, weil nicht alle gemeinsam nach der Wahrheit suchen. Damit eine offene und vertrauensvolle und an die Aufgabe gebundene Mentalität erhalten bleibt, ist es sinnvoll, dass sich der ganze „Arbeitskreis Taufgespräche“ in regelmäßigen Abständen trifft, um Erfahrungen auszutauschen und erneut nach den richtigen Themen und Methoden zu suchen. In Hochdahl geschah das drei bis vier Mal im Jahr. Wertvoll war auch, dass die Dreierteams, die jeweils die Gespräche leiteten, sich jedes Mal neu zusammenfanden. Das verhindert den „Griff ins Regal“, um die Unterlagen vom letzten Mal hervorzuholen. Das Team muss dann neu überlegen, wie die Gespräche ablaufen sollen. Das ist auch deshalb nötig, weil sich die Glaubenssituation ja auch bei den Begleitern laufend verändert und deshalb „das Zeugnis des eigenen Glaubens“ nicht einfach gleich bleibt. Die Begleiter berichteten auch, dass es vielfach nach dem ersten Abend nötig war, miteinander zu besprechen, wie die Fortsetzung im zweiten Abend aussehen könnte. Das macht deutlich, dass es nicht darum geht, den Eltern etwas vorzusetzen oder zu vermitteln, sondern das Gespräch dort wieder aufzunehmen, wo es am ersten Abend vielleicht schon „gefunkt“ hat. – Die Aufgabe der Glaubensverkündigung ist anspruchsvoll!
50. Katholische Vereine
Der Anlass für die folgenden Überlegungen liegt in einem Vorgang im Jahr 1980. Einige Hochdahler beschlossen, zusammen mit einem Pfadfinderbegeisterten aus Alt-Erkrath, einen Stamm der DPSG in Hochdahl zu gründen. Ohne vorher darüber zu sprechen schufen sie vollendete Tatsachen. Nicht nur die Überraschung war groß, sondern auch der Ärger über diese Nacht- und Nebelaktion. Denn eigentlich hätte es allen Interessierten bekannt sein müssen, dass wir beim Aufbau der neuen Gemeinde keine alten kirchlichen oder kirchennahen Vereine wiederbeleben wollten. Aber offensichtlich gab es in der Gemeinde eine Gruppe, die anderer Meinung war und die schien nicht ganz unbedeutend zu sein. Ein Jahr später schrieb einer aus dieser Gruppe einen Artikel in den Aspekten (März 1981). Darin erzählte er, wie erfreulich und erfolgreich sich das Leben der Pfadfinder in Hochdahl entwickelte.
Schon mehrere Jahre vorher waren wir mit einer ähnlichen Situation konfrontiert worden. Einige Sandheider Bürger hatten den Wunsch, einen Schützenverein zu gründen. Dazu sollte einer der Geistlichen als Präses fungieren. Es ging dabei natürlich nicht um eine besondere seelsorgliche Betreuung. Aber laut Satzung sind sie keine Sebastianer, wenn sie keinen Präses haben. Der Kompromiss, der schließlich dabei herauskam, war ein fauler, und die Sandheider Schützen waren nie in der Franziskusgemeinde beheimatet, auch wenn sie jedes Jahr am Fest des hl. Sebastian am Gottesdienst in Sandheide teilnahmen.
Der Hintergrund für diese Neugründungen war in beiden Fällen der gleiche. Etwas, was man in der Vergangenheit erlebt und geschätzt hatte, sollte es auch in Hochdahl geben. Und so versuchten die Schützen, einen Ableger ihres alten Düsseldorfer Vereins zu installieren. Und die Pfadfinder wurden gegründet, weil einige ältere Gemeindemitglieder mit dieser Gemeinschaft gute und schöne Erfahrungen gemacht hatten.
Es war eine grundsätzliche Entscheidung, die wir an dieser Stelle treffen mussten. Hätten wir die Vereine mit offenen Armen als tragende Gruppierungen der Gemeinde aufgenommen, hätte die Hochdahler Gemeinde ihre Eigenart aufgegeben. Unser Bild von Gemeinde vertrug sich nicht mit dem, was da von uns erwartet wurde. Wir hatten unsere Arbeit in Hochdahl begonnen mit der Vorstellung, dass es für uns und die Neubürger um einen Aufbruch gehen müsste. Das hing zunächst damit zusammen, dass es ja eine Neubaugemeinde war, deren Zukunft davon abhing, was wir und die Neubürger daraus machen würden. Das Ziel war eine Gemeinde, in der man heute als Mensch und Christ leben kann. Deshalb verbot es sich, einfach die alten Formen der Pfarrei zu kopieren. Und wir waren geprägt vom Schwung des Konzils. Da war es doch wirklich um einen Neuanfang gegangen. Das Leben der Kirche sollte von den Verkrustungen der Vergangenheit befreit werden und sie sollte fähig werden, auf die Fragen der Menschen aus dem Geist Jesu und des Evangeliums eine Antwort zu geben. Mit einem solchen Hintergrund wollten wir in Hochdahl in und mit der Gemeinde neue Wege gehen. Das durfte natürlich nicht zu einem Aufbruch in eine beliebige Zukunft werden – nach unserem oder anderer Leute persönlichem Geschmack. Ein verbindliches Bild für den Weg des Glaubens ist Abraham, der von Gott gerufen aufbricht in das Land, das Gott ihm zeigen wird. Seine Geschichte war öfter Thema in unserer Arbeit mit Jugendlichen. Und es ist nicht zufällig, dass die Überschrift für einen der ersten Texte dieser Erinnerungen lautet: „Abraham, zieh fort, zieh fort“. Das war die Anfangszeile eines der beliebtesten Lieder von Père Cocagnac, dem neben Aimé Duval bekanntesten Sänger religiöser Chansons in unseren frühen Jahren. In deren Liedern nahmen wir teil an dem Aufbruch der Katholiken in Frankreich. Eine beglückende Phase neuen Lebens in der Kirche nach dem Konzil! (Vgl.Nr.4).
Wie sieht denn eine Gemeinde aus, die dem Aufbruch des Konzils folgt und in der man heute als Mensch und Christ leben kann. Um das zu klären scheint es sinnvoll zu sein, auf die Überlegungen zum Gemeindebild des Paulus im ersten Korintherbrief zurückzugreifen (Nr.13, Die Gaben des Geistes). Im 1.Korintherbrief, Kapitel 12, musste Paulus Stellung nehmen zu einem Konflikt, der in der Gemeinde von Korinth aufgebrochen war. Dort gab es im Gottesdienst Leute, die „in Zungen redeten“. Das waren ekstatische Formen des Gebetes, die aber für die übrigen Teilnehmer nicht verständlich waren. Die Einstellung der „Konfliktparteien“ kann man sich leicht vorstellen. Die Ekstatiker hielten sich wahrscheinlich für besonders fromm und gläubig, während die anderen sich gestört fühlten. Wir würden heute wahrscheinlich in einer solchen Situation zwei verschiedene Gottesdienste in getrennten Räumen oder zu unterschiedlichen Zeiten anbieten. Das heißt, wir würden das Problem organisatorisch lösen und dabei mit gesundem Menschenverstand vorgehen.
Und viele vernünftige Leute würden sagen, dass eine solche Lösung durchaus in Ordnung ist und ausreicht. Und an der Stelle berührt sich das Problem von Korinth mit dem von 1980 in Hochdahl. Die Fragestellung ist zwar eine andere, aber auch 1980 gab es eine praktische Lösung. Und ich vermute, dass eine Reihe Leute damit durchaus zufrieden waren. Es gibt immer verschieden Bedürfnisse. Und die konnte man jetzt mit Pfadfindern und Schützen und Kirche erfüllen. Man sorgt dafür, dass jeder bekommt, was er braucht.
Paulus löst das Problem ganz anders – und das halte ich auch für uns für verbindlich. Er stellt den Korinthern vor Augen, was die Gemeinde ist. Der Text lautet: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen.“ (1 Kor 12, 4-6) Was in der Gemeinde also an Gaben sichtbar wird, ist nicht menschliches Wollen und Konstruieren, sondern das Handeln des Geistes, des Herrn, Gottes. Das bedeutet also und das gilt bis heute, dass das Leben der Gemeinde aus der Hand Gottes entspringt und durch seinen Geist gehalten wird. Wenn man das salopp ausdrücken will, könnte man sagen: die Gemeinde ist eine Veranstaltung Gottes in der Geschichte. Man kann auch einen Blick auf das Geschehen bei der Taufe werfen: „Wer glaubt und sich taufen lässt, empfängt den Heiligen Geist“. Weil er in die Gemeinschaft der Glaubenden aufgenommen wird, nimmt er teil an dem Geist, der diese Gemeinschaft prägt und lebendig hält. Entscheidungen, die in der Kirche gefällt werden, müssen deshalb im Hören auf diesen Geist entstehen. – Weil wir irrende Menschen sind, folgen wir oft nur unserem eigenen „gesunden Menschenverstand“. Es gibt ja sogar Leute, die meinen, stattdessen den Trends der Gesellschaft folgen zu sollen.
1980 wäre es darum richtig gewesen, vor dem Handeln sehr intensiv mit und in der Gemeinde darüber nachzudenken, was Pfadfinder oder Schützen im Zusammenhang mit der Gemeinde für eine Rolle spielen könnten und wie das zu organisieren wäre. Der gesunde Menschenverstand ist nötig, aber er genügt nicht.
Aus diesen Überlegungen müsste deutlich werden, dass wir nichts gegen die Vereine hatten, wenn wir keine ausdrückliche Gemeinsamkeit mit ihnen wollten. Es ging vielmehr darum, den Glaubensweg der Gemeinde nicht zu gefährden. Wir haben den Vereinen ja auch nie ihre Existenzberechtigung abgesprochen. Für viele Menschen und ihre Leben sind sie unverzichtbar und sie haben zweifellos eine große Bedeutung für das gesellschaftliche Leben und die sozialen Beziehungen. Das steht außer Frage und ist unabhängig davon, in welcher Beziehung sie zur Kirche stehen. Vielleicht wäre es eine gute Lösung, wenn beide Partner unabhängig voneinander ihre Sache machen würden und wenn sie dann, von eigenständiger Position aus, in Vertrauen und Wertschätzung einander begegnen.
Noch ein letzter Gesichtspunkt: die Pfadfinder als katholischer Verein mit Kurat und Gottesdienst im Pfingstlager sind keine zeitlose Einrichtung, sondern das Ergebnis einer geschichtlichen Situation. Von Hause aus haben die Pfadfinder ja keine religiösen Wurzeln. Baden Powell war Offizier und seine Ideen waren wohl philosophisch und pädagogisch fundiert. Aber dann kamen die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und die Jugendbewegung. Die hatte in Deutschland – neben vielen anderen wertvollen Impulsen – auch das Entstehen großer katholischer Verbände zur Folge. Und in dem Zusammenhang wurde 1929 die DPSG gegründet, die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Die „getauften Pfadfinder“ waren also das Ergebnis einer Mentalität, die damals katholische Großverbände für wichtig und wertvoll hielt.
Für einen anderen Großverband aus dieser Zeit ist gar nicht mehr so eindeutig, was er mit der Tradition anfangen soll. In und um Düsseldorf gibt es viele Sportvereine, die noch das Kürzel „DJK“ im Namen haben. Die „Deutsche Jugendkraft“ ist auch einer der katholischen Verbände, die in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden sind. Das „DJK“ steht noch im Namen und ob es noch eine Bedeutung hat, dürfte bei den verschiedenen Clubs unterschiedlich sein. Sollen die sich denn überhaupt noch mit dieser Frage beschäftigen? Oder sollen sie nicht einfach Fußball spielen und das mit Spaß und Erfolg. Und ihre religiösen Wünsche oder Prägungen sollen sie realisieren, indem sie intensiv am Leben einer Kirchengemeinde teilnehmen, aber nicht als DJK-Vereinsmitglieder, sondern als Glaubende und Mitglieder der kirchlichen Gemeinde.
Es wäre vermutlich hilfreich, diese geschichtlichen Zusammenhänge etwas genauer zu durch- leuchten. Das kann allerdings nicht im Rahmen dieser Erinnerungen geschehen.
Anmerkung:
Viele Jahre später tauchte eine andere Deutung des Vorgangs von 1980 auf.
Darin hieß es, es sei damals die Stelle des Stammesleiters neu besetzt worden,
die über längere Zeit vakant gewesen sei. Danach habe sich der Stamm sehr gut entwickelt.
51. Gemeindekatechese 5
Dem nächsten Projekt im Rahmen der Gemeindekatechese war nur ein kurzes Leben beschieden. Der Versuch mit dem „Partnerschaftsseminar“ misslang.
Wenn junge Leute heiraten wollten, empfahl man ihnen, an einem „Brautleute-Kurs“ teilzunehmen. Das katholische Jugendamt in Düsseldorf führte solche Kurse in der Jugendbildungsstätte St.Swidbert durch und die Brautleute aus Hochdahl nahmen dort daran teil. In der hohen Zeit der Gemeindekatechese tauchte bei uns der Wunsch auf, ein solches Angebot in der eigenen Gemeinde zu machen. Inhalt und Ablauf eines solchen Kurses hätten wir dabei übernehmen können. Es war üblich, die Paare zu einem Wochenende, einem Samstag oder auch zu mehreren, hintereinander folgenden Abenden einzuladen. Nach dem Vorbild der Taufgespräche hätte in Hochdahl wieder eine Gruppe von Gemeindemitgliedern die Verantwortung und Leitung der Vorbereitung übernommen. Und für jeden einzelnen Kurs wären zwei oder drei Mitglieder zuständig gewesen. Vermutlich hätte die Bindung an die Gemeinde den Gesprächen eine persönlichere Atmosphäre gegeben. Umgekehrt hätten sie sicher das Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Gemeinde gestärkt. Eine offene Frage blieb bei diesen Planungen, ob die Zahl der Heiratswilligen in Hochdahl groß genug sein würde, um eigenständige Brautleute-Kurse regelmäßig durchzuführen.
Während wir darüber nachdachten, schob sich eine andere Problematik mehr und mehr in den Vordergrund und verdrängte den Plan mit dem Hochdahler Brautleute-Kurs. Wir blieben an der Frage hängen: Was tun junge Leute eigentlich, um sich auf das Leben in der Ehe vorzubereiten? Die berufliche Ausbildung fordert ein großes Maß an Anstrengung und dauert viele Jahre. Demgegenüber gleicht die Vorbereitung auf die Ehe der Planung „eines Ausflugs an die Ahr“. Vielleicht könnten manche Konflikte und Schwierigkeiten in der Ehe leichter bewältigt werden, wenn man gelernt hätte, wie das geht: „miteinander leben“. Die gesellschaftliche Situation legte es zu der Zeit nahe, solche Überlegungen anzustellen. Die Zahl der Ehescheidungen ging in die Höhe und die „Ehe auf Probe“ bereitete vielen Eltern von Heranwachsenden menschliche und moralische Probleme. Warum sollten wir nicht auch hier nach einer Möglichkeit suchen, Jugendliche und Erwachsene miteinander ins Gespräch zu bringen? So entstand die Idee, ein „Partnerschaftsseminar“ anzubieten. Das Konzept war schnell erarbeitet. Jugendlich etwa ab 18 Jahren – nach der Firmung – werden eingeladen. Die Gespräche finden in Gruppen bis zu 10 Leuten statt. Die Teilnehmer können entscheiden, ob sie sich an mehreren Abenden mit wöchentlichem Abstand treffen wollen oder an einem Wochenende, das auf Wunsch nach einiger Zeit wiederholt werden kann. Die Gespräche sollen von zwei oder drei Erwachsenen begleitet werden, die sich in einem „Arbeitskreis Partnerschaftsseminar“ vorher intensiv auf diese Arbeit vorbereiten. Die bevorzugte Arbeitsform wird der Austausch im Gespräch sein, aber auch Rollenspiele sind möglich und alle Formen von Ausdruck und Kommunikation, die nicht über die Sprache gehen. Ziele des Partnerschaftsseminars sind: Selbsterfahrung, Äußerung der eigenen Empfindungen und Meinungen, Gesprächsfähigkeit, Hörfähigkeit, Kontaktfähigkeit – im Grunde alles, was zu einem Leben in „Partnerschaft“ gehört. – In den Aspekten von März 1981 wurden diese Überlegungen zum ersten Mal vorgestellt.
Als der Arbeitskreis unter kompetenter Leitung mit der Vorbereitung begann, konnten wir nicht ahnen, dass die Arbeit schließlich nicht gelingen würde. Wir waren 18 Damen und Herren und gingen mit viel Bereitschaft und Zuversicht an die Arbeit. Wenn ich von heute her zurückblicke, habe ich immer noch das Empfinden, dass dieser Kurs gelungen war. Wir haben viel Zeit investiert, wie trafen uns an 10 Abenden und zwei Wochenenden, insgesamt 22 Sitzungen von je eineinhalb Stunden. Der Kurs war intensiv, manchmal auch anstrengend, aufs Ganze aber wohltuend und bereichernd. Wie die Treffen abliefen, wird in den Aspekten von Dezember 1981 an einem Beispiel erläutert. Eine Aufgabe lautete: Jeder schreibt in Stille auf einen Zettel 3 bis 4 Eigenschaften, die er für sich selbst für besonders typisch hält; dann schreibt er seinen Namen darunter und heftet den Zettel an die Wand. Anschließend können alle Gruppenmitglieder an den Zetteln vorbeigehen, lesen, was jeder über sich geschrieben hat, und dazuschreiben, was sie selbst bei dem Betreffenden für typisch halten. „Diese Übung ist ein Weg zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Die Fähigkeit, sich und andere einzuschätzen, wird trainiert; der Austausch über die Bilder, die man von sich und dem anderen hat, führt dazu, offener und echter zu werden. So erfährt z. B. jemand, der sehr selbstkritisch ist, dass andere ihn u. U. positiver sehen als er sich selber. …“ (Aspekte, Dezember 1981) Neben solchen Aufgabenstellungen gab es Kleingruppen- und Plenumsgespräche, Spiele, Malen, meditative Übungen usw. Die wissenschaftliche Bezeichnung für die Gesamtmethodik ist Themenzentrierte Interaktion (TZI). Wir haben oft mit solchen Methoden gearbeitet und es ist schade, dass sie aus der seelsorglichen Arbeit praktisch verschwunden zu sein scheinen.
Das erste Angebot für die Jugendlichen zwischen Ostern und Sommer 1982 stieß durchaus auf Interesse. 25 junge Leute nahmen teil. Sie trafen sich in drei Gruppen an zehn Abenden für jeweils zwei bis drei Stunden. Hinterher berichteten die Teilnehmer in den Aspekten (Oktober 1982) über ihre Erfahrungen. Demnach hatte es in einer der Gruppen Probleme gegeben. Mehrere Teilnehmer hatten sich wohl nach kurzer Zeit auf sich selbst zurückgezogen und keinen Zugang zu den anderen mehr gefunden. Allem Anschein nach sind wir diesen Schwierigkeiten nicht nachgegangen. Wir haben zwar nicht verschwiegen, dass nicht alles gut gelaufen war, haben dann aber einfach für den Jahresanfang 1983 ein umfangreiches neues Programm angeboten. Und das stieß nur auf ein sehr begrenztes Interesse. Zu einem Informationsabend Anfang Januar erschienen nur 11 Jugendliche. Zwei Gruppen fanden sich zunächst zusammen, eine für wöchentliche Treffen und die andere für ein Wochenende. Beide Vorhaben fielen dann aber aus, weil niemand mehr dazu kam und einige vor Beginn sich wieder zurückzogen. Das war ein enttäuschendes Ergebnis, das uns wahrscheinlich viel von unserer anfänglichen Zuversicht genommen hat. Zwischen Ostern und Sommer 1983 kamen dann doch noch zwei Gruppen zustande. Die eine war eine feste Jugendgruppe, die schon längere Zeit zusammen war und sich an neun Abenden mit dem Thema Partnerschaft beschäftigte. Für die andere Gruppe hatten sich acht Jugendliche neu angemeldet. Die Begleiter waren zwei Erwachsene des Arbeitskreises und eine Jugendliche. Die Erfahrungen scheinen in beiden Gruppen recht positiv gewesen zu sein. Das kann man jedenfalls den Berichten in den Aspekten von Oktober 1983 entnehmen. Umso eigenartiger ist es, dass das Partnerschaftsseminar danach nicht fortgesetzt wurde.
Wie es dazu kam, ist die ganzen Jahre hindurch nicht geklärt worden. Die Idee mit dem „Partnerschaftsseminar“ hielten wir doch zunächst für sehr sinnvoll und gut. Auch die Vorbereitung war intensiv und erfreulich. Und das Interesse bei den Jugendlichen war zunächst auch vorhanden. Aber dann hörte es irgendwann einfach auf. Die Erklärung, die uns damals eingefallen ist, lautete: „Die Kirche ist für die Jugendlichen in dieser Frage nicht der kompetente Ansprechpartner“. Dieser Satz war wohl eher eine Selbstrechtfertigung und hat die Klärung der Ursachen blockiert. Im Rückblick meinte einer, der damals dabei war, es sei eingeschlafen, das Partnerschaftsseminar. An dieser Formulierung ist richtig, dass es keine gemeinsame Klärung und keinen Beschluss darüber gab, das Partnerschaftsseminar zu beenden. Es hörte einfach auf.
Warum ist dieser Versuch misslungen? Auch nach so vielen Jahren lohnt es sich noch, nach den Gründen zu suchen. Denn aus Fehlern, die man erkannt hat, kann man lernen. Im Vergleich mit der Vorbereitung auf Erstkommunion, Buße, Firmung und Taufe zeigt sich eine Lücke im Konzept des Partnerschaftsseminars: als die Arbeit mit den Jugendlichen begann, hat es anscheinend keinen „Arbeitskreis Partnerschaftsseminar“ mehr gegeben! Die „Vorbereitungsgruppe“, die wir manchmal als „Arbeitskreis“ bezeichnet haben, war sehr aktiv und hatte einen guten Zusammenhalt. Aber sie ist allem Anschein nach nie mehr zusammengekommen, nachdem die Trainingsphase beendet war. Bei den anderen Formen der Gemeindekatechese war die jeweilige Gruppe der Begleiter oder der entsprechende Arbeitskreis das eigentlich tragende Element der Arbeit. Deshalb hätte es auch beim Partnerschaftsseminar einen Arbeitskreis (d.h. die Fortsetzung der Vorbereitungsgruppe) geben müssen, um die Erfahrungen mit den Gruppen zu besprechen, um Schwierigkeiten zu klären, um das Konzept zu erstellen und immer wieder anzupassen, um die weitere Arbeit zu planen und den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. – Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass anscheinend die gesamte Aktivität über die Aspekte gelaufen ist. Dort wurden die Planungen vorgestellt und dort wurde von den Erfahrungen berichtet. Der Verdacht liegt nahe, dass da ein „direkter Weg“ an die Stelle der Tätigkeit und Eigenständigkeit eines Arbeitskreises getreten ist. – Andere Schwierigkeiten entstanden nicht aus einem Fehler im Konzept, sondern ergaben sich aus der Sache. Bei den anderen Formen der Gemeindekatechese ging es immer um die Vorbereitung auf den Empfang eines Sakramentes. Und dabei kann eine bevorstehende Taufe ein unkompliziertes Thema für einen ganzen Abend sein. Und der Blick auf den Anlass hält das Gespräch leicht im Fluss. Demgegenüber verhilft das Ziel: „Miteinander leben lernen“ viel weniger zu spontanen Äußerungen und Klärungen. – Umso wichtiger wäre es gewesen, für die Arbeit mit den Jugendlichen ein klares und ausgearbeitetes Konzept zu haben. Und es wäre gut gewesen, wenn es eine Mappe mit Anregungen, Spielmöglichkeiten und Vorschlägen für Einstiege ins Gespräch gegeben hätte. So waren die Begleiter weitgehend auf die Erfahrungen aus der Vorbereitungsgruppe oder aus anderen Aktivitäten mit Jugendlichen angewiesen. Trotz der Schwierigkeiten ist noch manches gelungen.
Es hat Stimmen gegeben, die meinten, wir hätten die ganze Arbeit nicht so hoch aufhängen sollen. „Partnerschaftsseminar“ sei nun doch ein sehr anspruchsvoller Titel. Und zudem missverständlich. Tatsache ist, dass auch bei den Erwachsenen in der ganzen Zeit immer wieder ein gewisses Unbehagen auftauchte. Es war so etwas wie ein Gefühl, doch nicht so richtig zuständig zu sein oder die geweckten Erwartungen nicht wirklich erfüllen zu können. Vielleicht waren wir uns trotz guter Vorbereitung über das Ziel unserer Arbeit nicht so richtig im Klaren. In den Erfahrungsberichten über die Arbeit in den Gruppen heißt es an einer Stelle: „Nur beim Thema Sexualität taten wir uns schwer. Das wurde deutlich, als wir über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen wollten. So blieben wir bei diesem Thema etwas mehr an der Oberfläche.“ Nun braucht man sich wegen dieser Schwierigkeit ja sicher nicht zu entschuldigen. Denn wie man Partnerschaft lebt, ist ein extrem persönliches und intimes Thema, über das man nur in einem geschützten Bereich sprechen kann. Deshalb kann es sein, dass solche Gruppen dafür nicht der geeignete Ort sind. Die Absicht, Jugendlichen Hilfen für das Leben in der Ehe anzubieten, war trotzdem nicht völlig falsch. Aber wir hätten uns schon in der Vorbereitung über diese Grenze klar werden müssen. An den Stellen, wo wir bescheidener waren und Hilfen für den Weg zueinander angeboten haben, scheinen die Gruppen ja auch gut gelaufen zu sein. Dann hätte die Überschrift also wirklich nicht „Partnerschaftsseminar“ heißen dürfen, sondern vielleicht „Miteinander leben lernen“.
52. Deutliche Verluste.
Viele praktizierende Christen entscheiden eigenständig, wann und wo sie am Gottesdienst teilnehmen. Und so sahen wir immer wieder Leute aus der Umgebung bei uns in der Hochdahler Gemeinde. Manche tauchten mehr oder weniger regelmäßig in den Gottesdiensten auf. Wir sahen das mit etwas kritischem Blick, weil zu der Zeit die These noch verbreitet war, dass man zu Hause, wo man wohnt, auch in den Gottesdienst gehen sollte. Die Besucher deshalb „Sakraltouristen“ zu nennen, war vielleicht etwas unverschämt, aber sie nahmen es eher heiter als verärgert. Und es hinderte sie nicht daran, sich bei uns wohlzufühlen. Eine größere Zahl – vor allem Leute aus Haan – integrierte sich stärker in der Gemeinde. Sonntag für Sonntag pilgerten sie nach Heilig Geist. Viele Kinder, begleitet von ihren Eltern, nahmen an der Kommunion- und Bußvorbereitung teil. Als wir dann 1977 mit dem Glaubenskurs zur Vorbereitung auf die Firmung begannen, machte eine Reihe von Haanern auch dabei mit und manche Jugendliche gesellten sich in der Vorabendmesse in Heilig Geist zu den Jugendlichen aus Hochdahl. Im Jahr 1983 kehrte der größte Teil dieser Wahl-Hochdahler wieder in ihre angestammte Gemeinde zurück. Wir haben damals den Weggang dieser Menschen als Verlust empfunden. Andererseits fanden wir es richtig, dass sie wieder in Haan das Leben der Gemeinde unterstützten.
Einen anderen Verlust in diesem Jahr konnten wir schlechter verkraften. Das lag auch daran, dass wir den Vorgang viel weniger verstehen oder deuten konnten. Zu Beginn der 80-er Jahre war die Bank an der Rückwand von Heilig Geist, die gut und gerne etwa fünfzig Personen Platz bot, in der Vorabendmesse um 19 Uhr ausschließlich von jungen Leuten belegt. Das war vielleicht eine Folge der intensiven Arbeit in der Firmvorbereitung. Natürlich war diese Teilnahme am Leben der Gemeinde nicht nur ein Ausdruck intensiven Glaubenslebens. Samstags um 19 Uhr in Heilig Geist traf man seine Freunde, mit denen man dann nach der Messe den weiteren Abend gestaltete. Der Gottesdienst war – auch – ein Treffpunkt! Das ist ganz normal in einem Alter, in dem Beziehungen und Gemeinschaft eine so wichtige Rolle spielen. Das Zusammenspiel zwischen den jungen und älteren Teilnehmern des Gottesdienstes war nicht immer ganz unkompliziert. Ich erinnere mich, dass hier und da die Erwachsenen sich gestört fühlten durch die „Lebendigkeit“ der Leute auf der Bank. Aber wenn dann nach Beginn der Messe die Jugendlichen den Gottesdienst in gesammelter Atmosphäre mitfeierten, dann war klar, dass die Unruhe vorher und nachher nicht ein Zeichen von mangelnder Ehrfurcht oder Andacht war. Und manche Erwachsene lernten dabei, dass Gottesdienst und Leben zusammengehören, anders als in der gedrückten Atmosphäre ihrer eigenen Kindheit – Und dann leerte sich die Bank hinten auf einmal sehr auffällig. Ich habe die Vorstellung, dass das in wenigen Wochen oder Monaten vor sich ging. Andere meinen sich zu erinnern, dass es doch ein längerer Prozess war. Jedenfalls blieben die Jugendlichen weg! Und so wie bis dahin haben wir sie nie mehr in der Kirche erlebt. Alle späteren Bemühungen, sie wenigstens während ihrer Vorbereitung auf die Firmung zu einem Mittun in der Gemeinde und im Gottesdienst zu bewegen, hatten nur punktuell Erfolg. Und nur nostalgisch können wir uns heute an die Zeit erinnern, als „all die Jugendlichen hinten auf der Bank saßen“.
Weniger auffällig war ein anderer Verlust. In den ersten Jahren, vor allem in der „großen Zeit“ der Ehekreise, konnten wir sehr intensiv den Eindruck haben, auf dem Weg des Glaubens gemeinsam mit vielen Menschen unterwegs zu sein. Und das erlebten wir nicht nur bei den Gesprächen in den Kreisen, sondern auch bei vielen Gelegenheiten, wenn die Gemeinde als ganze zusammen kam. Man sah einander immer wieder, bei Kindergottesdiensten und anschließenden Wanderungen, bei Pfarrversammlungen und Aktivitäten in der Gemeinde, oder auch immer dann, wenn Arbeit getan werden musste.
Im Laufe der 80-er Jahre fiel uns immer wieder auf, dass wir den einen oder die andere lange nicht gesehen hatten. Und wir fragten uns gegenseitig, ob jemand eine Ahnung hätte, wo sie geblieben seien. Viele machten einfach nicht mehr mit. Das war – anders als bei den anderen Verlusten – ein schleichender Vorgang. Und es waren nicht wenige, die uns so unterwegs abhanden kamen. Über die Ursachen kann man natürlich nur rätseln. Vielleicht ging es uns wie vielen anderen Gemeinden; die Teilnahme am religiösen Leben nahm eben ab. Oder es lag daran, dass die Kinder allmählich erwachsen wurden und dadurch die Bindung an das gemeinsame Leben nachließ. Oder wir haben in den ersten Jahren von dem Bedürfnis profitiert, in der Anonymität der neuen Stadt Kontakte und Beziehungen zu entwickeln, so dass in dem Maß, wie dieses Bedürfnis erfüllt wurde, die Bedeutung der Kirchengemeinde abnahm. – Für eine andere Erklärung steht der Satz „Wir haben es ihnen nicht gesagt“, der in diesen späten Jahren immer wieder einmal formuliert wurde. Gemeint ist, dass wir – die Leiter der Gemeinde – nicht genügend über die Hintergründe und Zusammenhänge informiert haben, weshalb wir die Gemeinde so und nicht anders geprägt haben. Wir sind unseren Weg zuversichtlich und dankbar miteinander gegangen und haben in der Verkündigung, in der Klärung des Gemeindeaufbaus und in der Sakramentenvorbereitung viel überlegt, diskutiert und argumentiert. Aber hat die Gemeinde dabei eine hinreichend stabile und abgeklärte Glaubenssubstanz entwickeln können? Wenn man überlegt, wie intensiv und langwierig eine fundierte theologische Ausbildung ist, dann kann man von daher abschätzen, wie groß die Aufgabe eigentlich ist. Natürlich sollen die Gemeindemitglieder nicht alle ausgebildete Theologen werden, aber viel Einsicht und Erkenntnis, viel Auseinandersetzung und Mühe ist trotzdem nötig. Diese Überlegung stellt nicht in Frage, dass wir auch immer wieder großartige Äußerungen von ganz tiefer Glaubenseinsicht erlebt haben.
53. Wie hilft man sich bei Priestermangel?
1983 wurde Gerd Verhoeven krank und musste für mehrere Wochen ins Krankenhaus nach Haan. Abgesehen von der menschlichen Belastung, die eine solche Krankheit immer mit sich bringt, war diese Situation eine ernste Herausforderung für das Leben der Gemeinde. Das wurde besonders sichtbar an den Sonntagen. Bei sieben Gottesdiensten am Wochenende war es für die in Hochdahl verbliebenen Geistlichen nicht möglich, alle Aufgaben zu übernehmen. Bei allen Überlegungen, die wir zur Lösung dieser konkreten Lage angestellt haben, hatten wir immer im Blick, dass wegen des fortschreitenden Priestermangels solche Bedingungen einmal Dauerzustand werden würden. Die Krankheit von Gerd Verhoeven bescherte uns gewissermaßen eine Trainingssituation.
Auch früher kam es natürlich vor, dass Priester krank wurden. Bei der Fülle von vorhandenen Zelebranten war das normalerweise kein Problem für die Dienste in der Pfarrei. Der zweite oder dritte Kaplan sprang ein und füllte die Lücke aus. War am Ort niemand dafür vorhanden, dann gab es in der näheren Umgebung meist ein Kloster, wo man um eine Aushilfe bitten konnte. Seit wir in Hochdahl waren, hatten wir auch hin und wieder versucht, Hilfe von auswärts in Anspruch zu nehmen. Manchmal hatten uns dann auch Patres aus Düsseldorf geholfen. Wenn ich es richtig sehe, wurde diese Möglichkeit aber in den 80-er Jahren insgesamt immer geringer. In unserer Situation konnte das aber auch deshalb nicht die Lösung sein, weil wir mit einer längeren Dauer der Abwesenheit von Gerd Verhoeven rechnen mussten.
Unsere damalige Trainingssituation ist ja inzwischen zur alltäglichen Realität geworden. Es fehlen die Priester. Und landesweit „hilft man sich“, indem man Gemeinden fusioniert und Gottesdienste streicht. Vorgeblich sind die Leute ja alle mobil. Und wenn sie sich zum Einkauf oder zum Kinobesuch ins Auto setzen, können sie das doch auch zum Besuch des Gottesdienstes tun. Diese abstruse Argumentation hätten wir damals nicht akzeptiert. Noch einige Jahre später haben wir uns darüber aufgeregt, wie rücksichtslos Geistliche manchmal mit Gottesdienstbesuchern umgehen. Da erzählte nämlich jemand von einer Kirche in Porz, dass die Leute, die zur üblichen Zeit zum Gottesdienst kommen wollten, an der Kirche einen Zettel vorfanden, auf dem geschrieben stand: „Die Messe muss heute ausfallen. Sie können heute Abend noch da und da an einer Messe teilnehmen.“ So etwas wäre uns damals nicht eingefallen. Nur in den Sommerferien fiel einer der sieben Gottesdienste am Wochenende aus.
Es hat natürlich immer schon Gottesdienstbesucher gegeben, die sonntags nicht in ihre Kirche am Ort gegangen sind, sondern dahin gefahren sind, wo der Gottesdienst feierlicher oder die Kirchenmusik anspruchsvoller oder die Predigt aufbauender war. Diese Christen werden ihre Praxis vermutlich noch länger beibehalten können. Das Streichen der Gottesdienste trifft die, die „zu Hause in ihre Kirche gegangen sind und miteinander Gemeinde gelebt haben“. Ist das nicht mehr möglich, werden einige von ihnen sich vermutlich zu Fuß oder im Auto dahin aufmachen, wo noch eine Messe stattfindet. Andere bleiben zu Hause und vollziehen vielleicht einen Gottesdienst mit, der im Fernsehen übertragen wird. Und einige werden sich ganz verabschieden. Am massivsten trifft es die Alten, die nicht mehr mobil sind. Die Folgen für die Gemeinde sind zerstörerisch. Wenn sie sich nicht mehr regelmäßig trifft, verliert sie ihren Zusammenhalt; wenn sie nicht mehr zusammen Gottesdienst feiert, zerfällt sie.
In der Eifel, wo es ja viele kleine Dörfer gibt, hatte ein weiser Bischof empfohlen, die Leute sollten sich jeden Sonntag zum Gottesdienst in der Kirche versammeln. Und wenn kein Priester da sein könnte, sollten sie wenigstens einen Wortgottesdienst miteinander feiern. So könnten, meine ich, die Gemeinden in der Not überleben, bis entweder wieder mehr Priester da sind oder bis sich die Bedingungen für den Dienst als Vorsteher der Eucharistie ändern. Diese Regelung hat der Nachfolger dieses weisen Bischofs wieder abgeschafft. Und eine Frau von der Mosel erzählte mir vor kurzem, sie hätten nur alle sechs Wochen eine Messe in ihrem Ort. Und an den anderen Sonntagen ist die Kirche verschlossen? Selbst wenn es alle drei Wochen wäre, wie sollte eine Gemeinde unter solchen Vorgaben überleben? Und wenn die Gemeinde untergeht, woher sollen dann die zukünftigen Priester kommen?
Am Sonntag nur an einem Wortgottesdienst teilnehmen zu können, fällt vielen Gläubigen schwer. Das wurde in den Gesprächen in unserer Notsituation 1983 oft deutlich. Ich erinnere mich an ein intensives Gespräch damals mit einer Frau, die aktiv in der Gemeinde mitmachte. Sie konnte sich nicht vorstellen, auf die Messe zu verzichten. Dann würde sie sich doch lieber ins Auto setzen und dahin fahren, wo sie an einer „richtigen Messe“ teilnehmen könnte. Ich konnte sie verstehen. Neben den theologischen Gründen gibt es an dieser Stell auch viele emotionale oder aus der Erziehung stammende innere Bindungen. Und auch das Kirchengebot wirkt sicher nach, das forderte, an jedem Sonntag „eine Messe mit Andacht“ zu hören. Und wenn man das nicht tat, glaubte man schwer zu sündigen. Aber was soll ich machen, wenn die Teilnahme an der Messe nicht mehr eine Frage meines eigenen guten Willens ist, sondern ein Problem der vorhandenen Möglichkeiten oder der Entscheidungen in der Kirche?
Wir waren damals der Meinung, dass die Versammlung der Gemeinde oberste Priorität hat, und zwar an einem festen Ort und zu festen Zeiten. Und wenn hier von „Gemeinde“ die Rede ist, ist nicht die Monsterpfarrei von 20.000 Leuten gemeint, sondern eine überschaubare Zahl von Menschen. Was der weise Bischof für die Dörfer der Eifel vorschlug, schien auch uns damals der richtige Weg zu sein. Wir haben deshalb in dieser Zeit keinen der sieben Gottesdienste gestrichen. Eine gewisse Vertrautheit mit Wortgottesdiensten konnten wir allerdings schon voraussetzen. Als wir noch die Hilfe der Düsseldorfer Patres beanspruchten, haben wir schon darüber beraten, ob wir solche Engpässe nicht vor Ort und aus eigener Kraft bewältigen müssten. Werktags haben wir – zum Beispiel in den Sommerferien – auch schon vor 1983 Wortgottesdienste zu den gewohnten Gottesdienstzeiten angeboten. Und dafür gab es auch genug fähige und bereite Leute. Allerdings wächst auch die Bereitschaft sehr schnell, wenn klar ist, dass solche Formen der Liturgie nicht billiger Ersatz oder sogar unerlaubte Eigenmächtigkeit darstellen, sondern eine Bereicherung und ein Zeichen der Lebendigkeit der Gemeinde sind. Und so haben wir in der Zeit der Krankheit von Gerd Verhoeven ziemlich regelmäßig am Sonntag mindestens einen Wortgottesdienst gefeiert, der auch von den Gläubigen angenommen wurde (was natürlich in der Not mit Rücksicht auf den kranken Pfarrer einfacher zu vollziehen ist). Diakon Willi Brähler sah diesen Dienst als besondere Aufgabe an, aber auch andere Gemeindemitglieder haben dabei die Leitung übernommen. Natürlich waren wir froh, als Gerd Verhoeven wieder gesund war und seinen Dienst wieder aufnehmen konnte.
Woher nahmen wir damals unsere Sicherheit, dass dieser Weg der richtige sei? Woher nehmen wir das Recht zu behaupten, dass diese regelmäßige Versammlung der Gemeinde die einzige Hoffnung für die Zukunft der Kirche hier bei uns ist? Allenthalben wird doch die klerikalistische Variante propagiert und praktiziert. – Seit unseren Anfängen in Hochdahl hatten wir immer wieder erlebt, wie fruchtbar es ist, wenn die ganze Kirche, also alle Getauften, die Verantwortung übernehmen für die Weitergabe des Glaubens und das Leben aus dem Geist Jesu Christi. Und diese Erfahrung hat uns Mut gemacht, für die Zukunft der Kirche auf die „Gemeinde“ zu setzen. Sicher hat uns auch geholfen, dass wir die Theologie des Paulus von der Gemeinde als Leib Christi gekannt und geschätzt haben. – Und dann war es wieder Joseph Ratzinger, dieses Mal mit seiner Vorlesung über die Eucharistie im Wintersemester 1960/61 in Bonn. Bei der Beschreibung der Situation von 1983 tauchten nämlich plötzlich einzelne Ausführungen von ihm auf, die sich offensichtlich sehr tief eingeprägt hatten. Die Erinnerung war lebendig und präzise, allerdings ohne den Zusammenhang packen zu können. Das Thema war das „Corpus Christi Mysticum“, der „Mystische Leib Christi“. Heute wird darunter die Kirche verstanden, so auch in der Enzyklika von Pius XII. 1943. Das sei aber erst seit dem Mittelalter so, sagte Ratzinger in seiner Vorlesung. Vorher, also in der Zeit der Alten Kirche, sei mit „mystischem Leib“ die Eucharistie bezeichnet worden, die Kirche habe man als das „Corpus Christi verum“ – den „wahren Leib Christi“ – verstanden. Das heißt dann aber, dass sich in der Gemeinschaft der Kirche, in der Versammlung des Volkes Gottes das Heil vollzieht und dass dabei Jesus Christus real, wirklich und wahr gegenwärtig ist. Und in der Feier des Mahles, im Empfang des „mystischen Leibes Christi“ empfängt der wahre Leib Christi die Nahrung für sein Leben. Im Empfang des „mystischen Leibes Christi“ werden wir immer wieder neu das, was wir sind, der „Leib Christi“. – Diese Vorstellung von der Gemeinschaft der Glaubenden hat allerdings einen sehr hohen Anspruch. Keiner ist mehr Privatperson; seit der Taufe und für alle Zeiten gilt die Gemeinschaft mit Jesus Christus in seinem Geist; wir sind „neue Menschen“, ein „neue Schöpfung“ (2 Kor 5,17); und damit wir zusammen kommen, brauchen wir kein Gebot, wir kennen die Kraftquelle für unser Leben. – Ob dieser Anspruch vielleicht der Grund war, dass man irgendwann den Inhalt der beiden Begriffe vertauschte? Unbewusst ist ja manches möglich. Die Eucharistie wurde zum „wahren Leib Christi“. Denn damit konnte man das Heilige, damit auch das so radikal Beanspruchende sich gegenüberstellen. An die Gegenwart Christi in der Eucharistie hat die Alte Kirche auch geglaubt. Aber durch die Entwicklung zur Anbetungsfrömmigkeit hat sich die Rolle von Kirche und Eucharistie im Leben der Glaubenden entscheidend verändert. Und die dadurch drohenden Gefahren sind oft Wirklichkeit geworden: die Kirche wird zu so etwas Ähnlichem wie die Gesellschaft und die Eucharistie wird zum Mittel des Heils, wenn nicht sogar zur Reliquie, und die mit der Leitung der Eucharistiefeier Beauftragten werden zu Funktionären. – Was hier mit dem Schlagwort „Anbetungsfrömmigkeit“ bezeichnet wird, ist bekanntlich eine Entwicklung mit sehr vielfältigen Ursachen, Erscheinungsformen und Wirkungen. Eine genaue Darstellung ist die Aufgabe der theologischen Wissenschaft. Hier ging es nur um einen Hintergrund für unseren Glauben an die „Gemeinde“. Als wir in diesem Zusammenhang die alten Skripten der beiden Vorlesungen von Ratzinger noch einmal hervorkramten, entdeckten wir einen Schatz!
54. Vorbereitung auf die priesterlose Zeit
Wir haben bei der Frage nach der Zukunft der Kirche hierzulande auf die Gemeinde gesetzt. Wir waren und sind der Meinung, dass sich das Volk Gottes jeden Sonntag am gleichen Ort und zur gleichen Zeit versammeln muss. Und wenn dann kein Priester da sein kann, muss in dieser Notsituation ein Wortgottesdienst gefeiert werden. Und die Gemeinden müssen befähigt werden, einen solchen Gottesdienst eigenständig durchzuführen.
Das war das Programm, was sich in unserer „Trainingssituation“ 1983 herausstellte. Bei der Vorbereitung von Kindern und Jugendlichen auf die Sakramente hatten wir ein doppeltes Prinzip, um unsichere Erwachsene zu ermutigen, die Begleitung von Gruppen dabei zu übernehmen. Das lautete: 1. Ich traue dir zu, dass du das schaffst und 2. Alles, was du dazu brauchst, werden wir gemeinsam erarbeiten. Das gleiche Prinzip war maßgebend, als wir jetzt daran gingen, einen Kreis von Gemeindemitgliedern für die Leitung von Gottesdiensten zu schulen.
Dass Gemeindemitglieder einen Gottesdienst vorbereiteten, war ja inzwischen selbstverständlich. Insofern war es nicht etwas grundsätzlich Neues, als wir 1984 die Gemeinde einluden, sich in einer Gruppe damit zu beschäftigen, wie man einen „Gemeindegottesdienst“ vorbereitet und leitet. Gemeint war dabei natürlich ein Wortgottesdienst, der ganz in der Regie der Gemeinde gestaltet werden sollte. Wir gründeten also einen Arbeitskreis Gemeindegottesdienst – AKGG. Ein gutes Dutzend Interessierte kamen zusammen und machten sich an die Arbeit. Alle waren auch bisher schon an verschiedenen Stellen in der Gemeinde aktiv und die meisten hatten Erfahrungen mit der Verkündigung entweder als Begleiter bei Kommunion, Buße oder Firmung oder auch durch ihren Beruf. Die geplante Tätigkeit ging allerdings über die thematische Vorbereitung eines Kinder- oder Jugendgottesdienstes hinaus. Die Gruppe musste eine eigenständige Leitung eines Wortgottesdienstes lernen und sich über viele Hintergründe in Exegese, Pastoral und Liturgie klar werden. Wir haben deshalb intensiv Theologie betrieben, vermutlich ein ganzes Jahr oder länger. Unser Arbeitsmaterial war der „Würzburger Fernkurs“, der auch für die Aus- und Weiterbildung von Gemeindereferenten gebraucht wird. Das Prinzip, alles gemeinsam zu erarbeiten, was das Gemeindemitglied braucht, haben wir also sehr ernst genommen. Irgendwelche dilettantischen Spielchen kann man einer Gemeinde ja auch auf keinen Fall zumuten. Es verlangt sowieso schon viel vom Gottesdienstbesucher, einen solch ungewohnten Vorgang anzunehmen und mitzutragen.
In der zweiten Phase unseres Bemühens haben wir dann versucht predigen zu lernen. Das ist sicher der schwerste Teil in der eigenständigen Gestaltung von Wortgottesdiensten. Zu diesem Zeitpunkt haben sich einige aus der Gruppe verabschiedet. Vielleicht trauten sie sich nicht zu, diesen Dienst wirklich zu übernehmen. Vielleicht meinten sie auch, sie würden in absehbarer Zeit dafür nicht benötigt. Wir haben darüber wohl nicht ausführlich diskutiert. Es war immer klar, dass jeder das Recht hatte, sich so zu entscheiden. Auch für diesen zweiten Teil der Arbeit haben wir ein ganzes Jahr oder mehr gebraucht. Dabei war es für mich sehr wertvoll, dass wir uns im Seminar vor der Priesterweihe intensiv um Verständnis und Praxis der Predigt bemüht haben. Manches davon konnte ich im AKGG den anderen weitergeben. Immer wieder neu war es dafür nötig, sich mit den Texten des jeweiligen Sonntags auseinanderzusetzen. Dann mussten wir herausfinden, welche Wahrheit sich aus der Botschaft für unser Leben heute ergibt, das ist ja auch für viele Amtsträger nicht leicht. Die Mühe war beträchtlich, verhalf uns aber auch zu manch beglückender Erkenntnis im Glauben.
Vermutlich haben wir 1987 dann angefangen, im Gottesdienst zu predigen. In dieser Zeit konnten alle sieben Gottesdienste als Messe gefeiert werden. Das bedeutete, dass nur die Predigt (und vielleicht Einleitung und Fürbitten) von jemandem aus dem Arbeitskreis übernommen wurde. Das geschah einmal im Monat, meist in Heilig Geist oder im Paul-Schneider-Haus. Dieser Vorgang war gewöhnungsbedürftig für alle Beteiligten. Die Gelegenheiten wurden – wie bei anderen besonderen Gottesdiensten – angekündigt, damit niemand überrascht wurde, der diese Form nicht erleben mochte. Ich habe sehr kompetente Ausführungen erlebt, aber auch manchmal etwas holprige. Und die Eigenart der Einzelnen drückte sich natürlich auch deutlich aus. Ich habe das als erfreulich und angenehm empfunden. Möglichweise konnte das aber auch einen Hörer stören. Man kannte ja die einzelnen Prediger und hatte sie oft schon bei anderen, vielleicht privaten Gelegenheiten erlebt. Und sicherlich wird es auch eine ganze Reihe von Leuten gegeben haben, die von ihrer Vorstellung nicht loskamen, dass predigen nicht eine Sache von Laien sei.
Zu diesen Leuten gehörte wohl auch Kardinal Meisner. Denn irgendwann in der ersten Hälfte der 90-er Jahre wurden wir „zitiert“. Für manche Kleriker war zu der Zeit das Wort „Laienpredigt“ ein rotes Tuch. Und dann hatten wir obendrein evangelische Pfarrer in der Messe predigen lassen und wohl noch sonst etwas Unmögliches begangen. Also durften wir zunächst beim Generalvikar, und als das nichts nutzte, schließlich beim Herrn Kardinal erscheinen. Natürlich hatte er kein besonderes Interesse an unseren Gründen, sondern sprach das erwartete Verbot aus.
55. Team 4
Und so saßen wir denn wieder – nein, nicht im Wohnzimmer von Peter Nettekoven (Nr.20), sondern in der Wohnung von Dr. Paul Adenauer in Herkenrath (Bergisch Gladbach), der in der Kölner Diözese ein kompetenter und gesuchter Supervisor für die in der Seelsorge Tätigen war. Wir hatten es also nötig und zugegen waren Brähler, Schellenberger, Staßen und Verhoeven – am 26.Juni 1986.
Peter Nettekoven hatte damals – 1972 – als Generalvikar unseren Vorstellungen von der Teamarbeit in der Leitung der Hochdahler Gemeinde zugestimmt, obwohl er Bedenken hatte, ob diese hochfliegenden Pläne auf die Dauer durchzuhalten seien. Deshalb versicherte er uns auch, er werde „mit dem Verbandskasten bereit stehen“, wenn wir in Schwierigkeiten geraten würden. Dieses Versprechen konnte er nicht einlösen, weil er schon 1975 starb, als er gerade die belastende Tätigkeit als Generalvikar beendet hatte und zum Weihbischof ernannt worden war. Wir hätten es zu der Zeit wohl auch noch nicht nötig gehabt, nach Beratung für uns als Team Ausschau zu halten. Allem Anschein nach waren die 70-er Jahre noch geprägt von dem „strotzenden Optimismus“, den wir bei Peter Nettekoven an den Tag gelegt hatten. Für mich hat sich 1980/81 irgendetwas deutlich verändert, das weiß ich seit langem. Einige Anzeichen dafür könnte ich auch nennen, aber ohne zu wissen oder beschreiben zu können, was da eigentlich geschehen ist. Das schlug allerdings auch nicht so klar durch; meine musikalischen Aktivitäten gingen weiter und das Haus in Millrath-Ost brachte Arbeit und Erfolg. Vielleicht ist es den Andern ähnlich ergangen. Unterschiedlich verteilt war aber im Team der Wunsch nach Klärung. Und dieser Wunsch brachte uns schließlich zu Paul Adenauer.
Im zweiten Teil von Team 2 wird ausführlich beschrieben, wie man sich Teamarbeit in Hochdahl im Idealfall vorstellen kann. Es gibt zwei Akzente: 1. Für den Weg der Gemeinde in die Zukunft ist das Team als Ganzes verantwortlich. Dazu ist es nötig, im Austausch der Meinungen zu einer möglichst großen Übereinstimmung zu kommen. Nicht, was einer will oder was die Mehrheit will, ist verbindlich. Deshalb soll man sich auch nicht auf Abstimmungen verlassen. Es geht um eine Suche nach dem, was richtig ist und was in der konkreten Situation und auf Zukunft hin als Wille Gottes und als Führung des Geistes erkennbar wird. Dazu ist sehr viel Offenheit und sehr viel Vertrauen nötig. – Der zweite Akzent: 2. Für einen bestimmten Arbeitsbereich ist jeweils einer aus dem Team verantwortlich. Und alles, was in diesem Bereich geplant und durchgeführt werden muss, liegt in seiner Hand. Er kann von seiner Arbeit und seinen Erfahrungen im Team erzählen und er kann mit den Anderen überlegen und sprechen. Und gemeinsam können sie auch nach Wegen und Lösungen suchen. Aber entscheiden muss der, der für den Bereich verantwortlich ist. Das Team darf nicht versuchen, zu überreden, zu kontrollieren oder gar zu manipulieren.
Dieser zweite Teil ist wohl in der Praxis auf weite Strecken gelungen. Wir waren von Veranlagung und Werdegang her sehr unterschiedlich. Und jeder von uns hatte auch einen anderen Schwerpunkt in theologischen und pastoralen Fragen und in der Seelsorge. Das ermöglichte eine erfreuliche Vielfalt im Dienst an der Gemeinde. Darin kann man auch eine gewisse Spezialisierung sehen, die es möglich machte, den besonderen Bedürfnissen bestimmter Gruppen in der Gemeinde entgegenzukommen (z.B. beruflich bedingt wie bei Lehrerarbeitskreisen, oder interessenbedingt bei sangesfreudigen Jugendlichen). Das war schon in sehr frühen Überlegungen ein Argument für die Teamarbeit in Hochdahl (vgl. „Großraumseelsorge“ in Nr.17)
Auch in den Beziehungen der Teammitglieder zueinander ist manches gut gelaufen. In vielen praktischen Aufgaben haben wir gut zusammengearbeitet. Fragen zu Liturgie und Verkündigung standen immer wieder zur Debatte; die Gemeindekatechese war ein gemeinsames Anliegen. Da viele Aufgaben sehr langwierig und dadurch oft auch ermüdend waren, war ein Wechsel in der Zuständigkeit manchmal gewünscht und auch möglich. Das war sowohl bei Bauprojekten als auch in der Gemeindekatechese sinnvoll und hilfreich. –
Was sehr schwierig war und weitgehend nicht gelungen ist, war der Austausch über die persönlichen Hintergründe, Bedürfnisse, Sorgen und Enttäuschungen. In den ersten Jahren ist das nicht zum Problem geworden. Wie waren ja auch nicht unvorbereitet in das Experiment „Teamarbeit“ eingestiegen. Schon im Studium war „Priestergemeinschaft“ das Thema, bei dem wir unsere Vorstellungen zu unsrer zukünftigen Lebensform diskutiert und ein Stück weit geklärt hatten. Und in den ersten Jahren in der Seelsorge trafen wir uns (Gerd Verhoeven und ich und einer, der dann nicht mehr nach Hochdahl kam) in einer Gruppe von fünf Kaplänen einmal im Monat zur „geistlichen Besinnung“ mit Schriftlesung und Gedankenaustausch. Diese Praxis war dann ja auch ein Argument bei der Entscheidung, welches Team die Arbeit in Hochdahl übernehmen sollte (vgl. Nr. 6. Team). – Was sich dann bis 1986 genau untereinander an Problemen aufgestaut hatte, kann auch im Nachhinein nicht klar gesagt werden
Und dann saßen wir also bei Paul Adenauer. Die Frage war, ob wir uns darauf verständigen könnten, für eine gewisse Zeit regelmäßig zu ihm zur Supervision zu kommen. Ich war dazu nicht bereit und habe klar abgelehnt. Der Anlass für diese Entscheidung war ein kleines Erlebnis, dass ich einige Tage vorher mit einem anderen Mitglied des Teams hatte. Obwohl wir etwas gemeinsam taten, waren unsere Verhaltensweisen so unterschiedlich, dass ich innerlich nur den Kopf geschüttelt habe. Ich war nicht wütend, aber in dem Augenblick war für mich klar, wie weit wir in unseren Vorstellungen voneinander entfernt waren. Und sofort lautete die Deutung, dass dieser Unterschied nicht nebensächlich oder zufällig war, sondern die Folge einer grundlegenden Prägung oder Veranlagung oder Erziehung. Das heißt, ich konnte bei Paul Adenauer nicht darauf hoffen, dass eine Supervision uns in Bezug auf solche Prägungen weiterhelfen würde. Wenn das Ziel aber weniger anspruchsvoll sein sollte, dass wir zum Beispiel etwas höflicher oder zurückhaltender miteinander umgehen sollten, dann war mir das nicht genug. Anscheinend war meine Entscheidung aber nicht die einzige Absage. Jemand anders soll – auch aus einem anderen Grund – ebenfalls abgelehnt haben.
Offensichtlich waren wir wirklich in unserer Prägung und Eigenart sehr unterschiedlich. Das habe ich jahrelang beträchtlich unterschätzt. Dann habe ich mich nur immer wieder gefragt, was denn eigentlich die Ursache für Ungereimtheiten und Spannungen untereinander war. Man lernt sich halt auch bei jahrelanger Zusammenarbeit nicht richtig oder intensiv genug kennen. Und manchmal wagt man wohl auch nicht, die Andersartigkeit ganz ernst zu nehmen, vielleicht weil es einen Verlust an Übereinstimmung zur Folge hat.
Manchmal habe ich in späteren Jahren gedacht, ich hätte vielleicht einem Versuch mit der Supervision zustimmen sollen. Möglicherweise wäre es ein erster Schritt geworden, der auch eine Chance für mehr gehabt hätte. Die Entscheidung war massiv und besagte: in unserer Konstellation hat Supervision keine Chance. Ein Ende der fruchtbaren Arbeit mit und in der Gemeinde bedeutete diese Entscheidung aber nicht.
56. Das Haus in Trills
Das Vereinshaus – so hieß es bis 1985 – steht in Trills an der Hildener Straße direkt oberhalb von Kirche und Pfarrhaus. Es wurde Anfang des 20.Jahrhunderts erbaut, in den zwanziger Jahren erweitert und diente – wie der Name sagt – den Vereinen in Trills als Treffpunkt und Versammlungsmöglichkeit. Dazu hatte das Haus im Hauptgeschoss einen mittelgroßen Saal mit Bühne, der für viele Aktivitäten genutzt wurde: als Probenraum für Männergesangverein, Frauenchor und Kirchenchor, als Übungsraum mit Schießmöglichkeit für Schützen, als Versammlungsraum für Kolping, Jungfrauenverein und Frauengruppen, für Nähkurse, Bildungsveranstaltungen, Tanz und Theateraufführungen. Im Obergeschoss gab es eine Reihe von Zimmern, die in früheren Jahren wandernden Gesellen eine Bleibe boten. Von besonderer Bedeutung war das „Trillser Stübchen“, eine kleine Gastwirtschaft in dem südlichen Teil des Hauses auf der Seite zum Pfarrhaus hin. Hier konnte man noch, als viele andere Geschäfte und Handwerker aus Trills schon verschwunden waren, zu einem Glas Bier einkehren. Und auch die verschiedenen Gruppierungen konnten sich abends nach beendeter Probe oder Veranstaltung noch zu einem gemütlichen Ausklang zusammensetzen. Über dem Stübchen gab es neben dem Saal noch einen kleineren Raum, der bei Veranstaltungen dem Saal angeschlossen werden konnte.
Das Vereinshaus hatte eine bewegte Geschichte, die Wilhelm Wassen in der Festschrift von 1985 kenntnis- und detailreich ausbreitet. Besonders auffällig ist, wie lebendig und vielfältig das Leben in den 20-er Jahren in und um das Vereinshaus war. Viele, vor allem sportliche Aktivitäten, wurden ins Leben gerufen und der Fußballverein der DJK war ein Glanzlicht der Trillser Szene. Offensichtlich war zu der Zeit die Einwohnerzahl des kleinen Ortes recht groß, da die Eisenhütte am Bahnhof Hochdahl sowie der Eisenbahnbetrieb zahlreiche Arbeitskräfte anzog. Und auch das Geschäftsleben in Trills war gut sortiert: mehr oder weniger in jedem Haus gab es einen Laden oder einen Handwerker. Auch nach dem zweiten Weltkrieg hatten verschiedene Gruppierungen noch erstaunlich viele Mitglieder. Es existiert zum Beispiel ein Foto von einem Fest der Kolpingsfamilie von 1948, auf dem 62 Mitglieder zu sehen sind. Und im selben Jahr wurden 45 weibliche Jugendliche in den Marienbund aufgenommen. (Wassen, Festschrift 1985).
Der Träger des Vereinshauses war fast von Anfang an der Verein Vereinshaus. Als Eigentümer war der Verein für alle Angelegenheiten des Hauses zuständig. Er leitete notwendige Baumaßnahmen ein, hielt den Kontakt zu den kommunalen Stellen, sorgte für Instandhaltung und Kassenführung und entschied über die Nutzung des Hauses. Die Bewirtschaftung wurde von einem Pächter besorgt, der vor allem als der „Wirt im Stübchen“ wahrgenommen wurde. Der Vorstand des Vereins wurde gewählt, der Pfarrer war „geborenes Mitglied“.
Am 1.Januar 1983 ging das Vereinshaus in den Besitz der katholischen Kirchengemeinde über. Der direkte Anlass war der bauliche Zustand des Hauses. Das Dach war undicht geworden und auch im Innern war manches hochgradig renovierungsbedürftig. Wie Wilhelm Wassen in seiner Chronik bemerkt, fanden seit 1979 „infolge unzumutbarer Zustände im Vereinshaus lediglich die üblichen wöchentlichen Vereinsabende statt“. Und das waren nur noch fünf Treffen und ein Abend, der für eine Veranstaltung des Wirts reserviert war. Der Verein bestand in den achtziger Jahren nur noch aus 11 Mitgliedern und war natürlich nicht in der Lage, die Kosten einer Renovierung zu übernehmen. In den Statuten des Vereins war vorgesehen, dass der Verein sich unter bestimmten Bedingungen auflösen konnte. In diesem Fall sollte das Gebäude der Kirchengemeinde zufallen. „In der letzten außerordentlichen Versammlung am 13.9.1982 mit dem einzigen Tagesordnungspunkt: ‚Auflösung des Vereins’ wird mit 4/5 Mehrheit der 11 Mitglieder beschlossen, den Verein aufzulösen. Demnach geht gem. § 16 der Satzung der gesamte Besitz in das Eigentum der kath. Kirchengemeinde St. Franziskus Hochdahl über.“ (Wassen, Festschrift 1985).
Die 80-jährige Geschichte des Vereinshauses ging also 1983 zu Ende. An die Stelle trat das Franziskushaus als eines der drei Gemeindehäuser der Franziskusgemeinde. Manche Trillser werden diesen Übergang als Bruch in ihrer Geschichte empfunden haben. Möglicherweise markierte er sogar das Ende des alten Trills. Damit war auch die Phase abgeschlossen, in der sich das Zueinander von Trills und der neuen Stadt klären musste. Seit dem Beginn der Planungen für das Neubaugebiet hatte es darüber immer wieder Schwierigkeiten und Konflikte gegeben. Und ganz ausgestanden war es auch 1983 noch nicht. Zumindest kann man den Eindruck haben, wenn man den Bericht über den Verlauf der Pfarrversammlung am 23.September 1983 liest (Aspekte Okt.1983). Das Thema sollte eigentlich lauten: „Was wird aus dem Vereinshaus Trills?“ Aber die Diskussion drehte sich vor allem um die Frage: „Was kann von dem bleiben, was bisher war?“. Und dabei ging es vor allem um den Erhalt des „Trillser Stübchens“. Allerdings hätte es von vorneherein klar sein können, dass der Platz im Haus für beides, eine öffentliche Gastwirtschaft und die Aktivitäten der Gemeinde, nicht ausreichen würde. Für die Kirchengemeinde war das Franziskushaus in der damaligen Situation ein Gewinn. Den gleichen Vorgang erlebten manche Trillser vermutlich eher umgekehrt, nämlich als den Verlust ihres Vereinshauses.
Damit besaß die Franziskusgemeinde ihr drittes Gemeindehaus für die seelsorgliche Grundversorgung der Gemeinde, aber in welchem Zustand! Sollte das Haus für diese Aufgabe brauchbar werden, musste es nicht nur renoviert, sondern an einigen Stellen umgebaut werden. Schon vor der Übernahme hatte eine Projektgruppe aus Mitgliedern des Kirchenvorstands, des Pfarrgemeinderats und der Gemeinde zusammen mit dem Architekten Franz-Josef Klother überlegt und geplant, wie das Haus zukünftig aussehen sollte. Und im Juni 1984 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Nach meiner Erinnerung war das ein mühsames Unterfangen. Vor allem die Umgestaltung der unteren Ebene, wo sich bisher das Stübchen befand, belästigte die Arbeiter mit viel Staub und manchen recht unangenehmen Gerüchen, die ihnen beim Entleeren alter Gruben in die Nase stiegen. Und das Gewicht der schweren Stahlträger, die wegen der Beseitigung tragender Wände eingezogen werden mussten, konnte man fast am eigenen Leib spüren, wenn man den Erzählungen zuhörte. Grandios war die Lösung mit dem neuen Treppenhaus samt Toiletten. Vorher kam man in das Stübchen von der Hofseite nur über eine steile und enge Stiege, und wenn man zu viel Bier getrunken hatte, musste man zur Toilette wieder raus auf den Hof und in das entsprechende Häuschen. Gerade das Untergeschoss wurde durch den Umbau zu einem echten Schmuckstück. Wenn man durch die breite Eingangstür auf der Hofseite das Haus betritt und die halbe Treppe nach unten geht, kann man nur staunen über den großzügigen Raum, der sich öffnet. Auf der linken Seite ist die Cafeteria mit Theke, Kaffeeautomat und Spülmaschine – sehr geeignet für eine Verschnaufpause zwischen anstrengenden Gesprächen. Diese kann man, wenn man will, entweder in dem großen Hauptraum des Untergeschosses führen oder auch im „Kaminzimmer“, das sich hinter der Cafeteria anschließt und wirklich einen offenen Kamin bekommen hat. Viel Mühe verwandte der Architekt auch auf die Renovierung im oberen Geschoss. Der Fußboden im Saal wurde von seinen Auflagen aus Spanplatten und vielen Anstrichen befreit, die darunter liegenden Bohlen bearbeitet, gedreht oder ersetzt „und so lange geschliffen, bis sich die Schönheit des Naturholzes wieder zeigte.“ (Klother, Festschrift 1985) Und die „mittig im Saal stehende, prächtige gusseiserne Säule“ wurde mit besonderer Liebe restauriert.
Die Finanzierung des Umbaus übernahm zum großen Teil die Diözese. Von den ca. 960.000 DM Baukosten musste die Gemeinde 74.000 DM aufbringen. Dazu kamen noch 6.600 DM für zusätzliche Aufwendungen, die nicht in den Baukosten enthalten waren. Am 5.8.1985, noch vor der Eröffnung des Hauses, waren bereits 46.300 DM aus Spenden und der monatlichen Kollekte zusammengekommen. Für die Mitglieder der Franziskusgemeinde war es natürlich sehr hilfreich, dass die Diözese den größten Teil der Kosten übernahm. Ob wir eine solche Belastung wie beim Roncalli-Haus noch ein zweites Mal hätten verkraften können, wäre doch recht fragwürdig gewesen. Allerdings konnte sich dadurch auch nicht die hohe Identifizierung der Gemeinde mit dem Bau in Trills einstellen. Das Franziskushaus, wie es dann genannt wurde, ist nie im gleichen Maß „unser Haus“ geworden wie das Roncalli-Haus.
57. Trills und die Neue Stadt
In der Reihe der Texte über unsere Arbeit in der katholischen Gemeinde in der Neuen Stadt Hochdahl gab es schon relativ früh auch einen Artikel über Trills.– Dieser Text lag dann lange „auf Wiedervorlage“, weil mir weder der Inhalt noch die Sprache gefiel. Er ließ nicht viel erkennen von der schwierigen Situation, in der sich die Trillser beim Aufbau der Neuen Stadt befanden und enthielt stattdessen pauschale Urteile. Im Anschluss an die Überlegungen zum Vereinshaus/Franziskushaus hatte ich den Eindruck, dass man den Weg von Trills/Alt-Hochdahl in die Neue Stadt genauer beschreiben sollte. Der Versuch soll gemacht werden.
Trills, zusammen mit Alt-Hochdahl, war der einzige Wohnbereich im Neubaugebiet, der eine eigene Tradition hatte. Die beiden anderen kleinen Wohngebiete, Millrath und Kempen, gehörten nicht dazu. Sie waren ursprünglich deutlich kleiner als Trills und waren erst in der jüngeren Vergangenheit durch neue Wohnbebauung gewachsen.
Zumindest seit Anfang des 20. Jahrhundert hatte Trills/Alt-Hochdahl eine lebendige Geschichte. Wenn man die Schilderungen in der Festschrift (Wassen 1985, vgl.Nr.56) auf sich wirken lässt, dann kann man ahnen, wie viel in der Vergangenheit in diesem Dorf los war und wie bewusst die Bewohner das gemeinsame Leben gestaltet haben. Alles spielte sich ab rund um Kirche, Pfarr- und Vereinshaus und entlang der beiden Häuserzeilen an der Hildener Straße. Die 20-er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren für den Katholizismus in Deutschland eine wichtige Phase. Katholische Gruppierungen wurden in Verbänden auf der Ebene ganz Deutschlands zusammengefasst und hatten Mitgliederzahlen von mehreren Hunderttausend. Der im vorigen Text erwähnte Fußballclub in Trills gehörte zum Beispiel zur DJK, der „Deutschen Jugendkraft“, einem Verband von Sportvereinen, die als katholische Vereine firmierten (vgl. Nr.50, Katholische Vereine.). Auch nach dem zweiten Weltkrieg war Trills noch ein lebendiger Ort. Auf einem Bild der Kolpingsfamilie von 1948 konnte man noch 62 Mitglieder zählen. Und 45 weibliche Jugendliche wurden in diesem Jahr in den Marienbund aufgenommen. Diese „goldenen Zeiten“ waren allerdings 1960/65 schon Vergangenheit. Die Eisenhütte hatte ihren Betrieb inzwischen eingestellt. Die wirtschaftlichen Bedingungen für Trills/Alt-Hochdahl waren deutlich schwieriger geworden. Manche Einzelhändler, Handwerker oder Gastwirte hatten den Ort schon längst verlassen. Aber an ihrer Vergangenheit, ihrer Geschichte, ihrer Tradition hielten die Trillser unbekümmert fest. Vielleicht gerade deswegen, weil die Gegenwart nicht mehr so rosig war.
Als der Aufbau der neuen Stadt Hochdahl begann, haben viele Altbewohner das als eine Bedrohung ihrer Lebensgewohnheiten erlebt. Und es ist ihnen sehr schwer gefallen, sich mit der neuen Situation abzufinden. Natürlich waren die Altbaugebiete nicht in ihrer Existenz bedroht; sie sollten ja in die neue Stadt integriert werden. Aber es war abzusehen, dass sie viel von ihrer früheren Bedeutung verlieren würden. Trills/Alt-Hochdahl war inzwischen ein kleiner Bereich mit einer begrenzten Einwohnerzahl. Und was da geplant und bald schon begonnen wurde, war aus Trillser Perspektive sicher riesengroß. Heute ist Trills/Alt-Hochdahl ein normaler Ortsteil von Hochdahl mit einer ähnlichen Bebauung wie die anderen Stadtviertel. Aber am Anfang konnte man schon die Sorge haben, dass das Neubaugebiet diese alten Reste erdrücken würde – kleine Gebiete, umgeben von einer riesigen neuen Stadt. Dabei dürfte es auch eine Rolle gespielt haben, dass das Neubaugebiet ursprünglich für 45.000 Einwohner geplant war. Es ist möglich, dass diese Angst und Sorge in den ersten Jahren dazu führte, dass die Trillser immer wieder maulten und sich beklagten. Sie wollten halt ihre Existenz verteidigen. Und für diesen Teilaspekt war unser Pauschalurteil vielleicht sogar zutreffend: „Die Trillser halten am Alten fest“. In den ersten Jahren führte das auch zu manchen Aggressionen, die sich gegen die Stadtplanung richteten. Das ist schon ganz am Anfang dieser Erzählungen erwähnt worden (Nr.3).
Für die kirchliche Situation in Trills gab es diese Schwierigkeiten und Konflikte am Anfang noch nicht. Bis 1972 schien die Welt noch in Ordnung. Das Neue hatte sich zwar schon angekündigt durch die Renovierung des Innenraums der Trillser Kirche und die Gründung der Ehekreise. Aber Pfarrer Hans Meixner lebte nach wie vor im alten Pfarrhaus neben der Kirche und Gerd Verhoeven wohnte 100 Meter weiter unten (Hildener Straße 110). Nachdem Anfang 1972 Heilig Geist eingeweiht worden war, zog Gerd Verhoeven in die Sandheide, Pfarrer Hans Meixner verließ Hochdahl und Josef Metternich, der eigentlich in das schon für ihn renovierte Trillser Pfarrhaus einziehen sollte, kam nicht (wegen des akut werdenden Priestermangels, wie die Kölner Personalabteilung mitteilte). Das Pfarrhaus neben der Trillser Kirche blieb leer. Kein Pfarrer! Ich kann versstehen, dass diese Situation für die Trillser ganz unerträglich war. Und die Parole tauchte auf: „Dann muss der Staßen eben nach Trills ins Pfarrhaus!“ Irgendwie erreichte mich ein solcher Spruch. Eine offizielle Aufforderung dazu gab es allerdings nicht. Für einige Leute in Trills war diese Vorstellung sicher naheliegend, für mich war sie völlig undiskutabel. In Trills neben der Kirche? Das bedeutete: auf dem Präsentierteller, volle soziale Kontrolle, vor allem mit dem Maßstab des Priesterbildes, das in Trills selbstverständlich war. – Und dann wurde das Pfarrhaus – vermutlich 1974 – auch noch an einen Nichtpriester mit seiner Frau vermietet. In diesen Jahren hörte man dann von den „Betroffenen“ auch immer wieder deutliche Klagen. Wie oft haben gute Katholiken darauf hingewiesen, dass der Pfarrer früher jede Woche wenigstens kurz zur Probe des Kirchenchores kam. Und sie haben darüber gemault, dass jetzt keiner (von den jungen Geistlichen) mehr erscheinen würde. Und keiner lebte mehr bei ihnen in der alten Pfarrei, alle wohnten sie in den neuen Stadtvierteln. Ich kann verstehen, wenn die Trillser das Gefühl entwickelten, dass man sie im Stich gelassen hätte.
Wie sich die Bedeutung von Trills auch kirchlich veränderte, lässt sich an einem anderen Beispiel zeigen. In Hochdahl gab es 1969 schon einen Jugendchor und eine Combo für die Jugendmessen. Das ist in Nr.8 „Gottesdienst“ schon erzählt. Wenn es vor 1972 eine Jugendmesse gab, dann fand die selbstverständlich in St.Franziskus statt. Eine andere Möglichkeit gab es ja nicht. Nachdem „Heilig Geist“ fertig geworden war, haben wir praktisch keine Jugendmesse mehr in Trills gefeiert. Und die Musicals fanden natürlich auch in Sandheide statt. Die Ursache war nicht eine Antipathie gegen Trills, sondern es lag an einer Eigenart der neugotischen Trillser Kirche. Sieben Sekunden Nachhall machten es unmöglich, rhythmische Lieder zu singen, deren Texte die Teilnehmer verstehen sollten. Für mehrstimmige Messen mit Orgelbegleitung war diese Akustik dagegen fast ideal. Die Entwicklung von Trills hatte also offensichtlich auch damit zu tun, was in Trills oder anderswo gut oder weniger gut möglich war.
Eine wichtige Persönlichkeit in der Trillser Szene hat mir irgendwann einmal gesagt, ich sei ja wohl gegen Tradition. Vermutlich war das in der zweiten Hälfte der 70-er Jahre. Gegen diese Aussage habe ich mich gewehrt. Innerlich und auch in der Argumentation habe ich mich darauf berufen, dass sich die für uns verbindliche Tradition aus der Botschaft Jesu ergibt und dass ich insofern sehr deutlich an Tradition gebunden bin. Damit hatte ich dem Herrn klar gemacht, dass wir auf dem richtigen Weg seien. Aber ich hatte seine Anfrage überhaupt nicht aufgenommen und meine Antwort ging an seiner Sorge völlig vorbei. Ihm ging es um die Tradition in Trills. Und dazu gehörte vermutlich zunächst das Zusammenleben in der Dorfgemeinschaft, dazu gehörten die Aktivitäten der Vereine. Das war ihm sicher wichtig. Aber wenn er mich darauf ansprach, meinte er vielleicht vor allem die Gemeinschaft rings um Kirche und Pfarrhaus. Vielleicht war das sogar das tragende Element des Zusammenlebens in Trills. Wo die Kirche ist, da ist auch der Pfarrer und wo der Pfarrer ist, da ist auch die Gemeinde – die sich sonntags im Gottesdienst versammelt, an Fronleichnam in der Prozession Gott um seinen Segen für die Bewohner bittet und seine Nähe lebendig erfahrbar werden lässt. Dieses Kirchenbild in der Reihenfolge „Kirche – Pfarrer – Gemeinde“ habe ich in einem sehr frühen Artikel in den „Aspekten“ (Dezember 1973) skizziert und behauptet, das sei das Bild, dem die Trillser anhängen würden. Wenn diese Interpretation richtig war, dann fehlte den Mitgliedern der Gemeinde in Trills ein Glied in ihrer religiösen Bindung, wenn kein Priester mehr im Pfarrhaus wohnte. Ob die Situation wirklich so problematisch war und von den Leuten auch so empfunden wurde, ist allerdings schwer zu entscheiden.
Auch der Kirchenchor hatte eine ihm eigene Tradition, die sich in den späten 70-er und den 80-er Jahren massiv und für die Sänger belastend veränderte. Als ich anfangs in Hochdahl war, erzählten die Mitglieder immer wieder mit viel Begeisterung, wie toll die Feier beim 90-jährigen Jubiläum gewesen war – mit Dvorak-Messe und allen anderen Ereignissen drum herum. Offensichtlich eine sehr prägende Erinnerung. Als dann der sehr fähige Organist und Chorleiter in den Ruhestand ging und wegzog, fand der Chor lange Zeit keinen neuen Anfang. Nun war in dieser Zeit in der Kirche musikalisch vieles lebendig. Aber die Anregungen, die von Taizé oder den rhythmischen Liedern ausgingen, konnte der Chor nicht aufnehmen. Seine große Zeit war von einer anderen Musik und einer anderen Mentalität geprägt gewesen. Und diese ihre Tradition fanden sie lange Zeit nicht wieder. Erst in ganz späten Jahren, als sie sich mit einem Kirchenchor aus Garath zusammentaten und der dortige Chorleiter beide Chöre übernahm, konnten sie wieder etwas von ihren alten Idealen pflegen.
Es war zweifellos eine hervorragende Idee des Stadtplaners, dass das Neubaugebiet in einzelne „Quartiere“ oder Stadtviertel gegliedert werden sollte. Die Kirchengemeinden haben sich diesem Konzept angeschlossen. Das bedeutete, dass Trills eines dieser Quartiere werden musste. Das war für die Trillser ein schmerzlicher Prozess, waren sie doch jahrzehntelang ein wichtiger kleiner Mittelpunkt zwischen Haan, Hilden und Erkrath gewesen. In Zukunft konnten sie Mittelpunkt nicht mehr sein, vor allem nicht ein Mittelpunkt für die Neue Stadt. Sie mussten sich daran gewöhnen, eines von sieben Quartieren zu sein. Und das sind sie schließlich auch geworden. – In der katholischen Gemeinde haben wir Trills von Anfang an so behandelt. Die Seelsorge haben wir selbstverständlich nicht anders betrieben als im übrigen Hochdahl, in den anderen Quartieren. In der Erstkommunionvorbereitung war Trills ein eigener Bezirk, für den natürlich einer der Hauptamtlichen zuständig war. Die Sechseckschule (Grundschule an der Hildener Straße) hatte sogar jahrelang jeden Dienstag Schulmesse in der Franziskuskirche; das war mehr als in den anderen Schulen. Sonntags gab es zwei Gottesdienste; auch das war ein gutes „Angebot“. – Trills wurde also von einem kleinen Mittelpunkt zu einem Quartier unter anderen. Diese Veränderung dürfte die Ursache gewesen sein für die Spannungen und Konflikte in den Jahren nach 1972. Wenn man sie so interpretiert, wird deutlich, dass die Schmerzen nicht vermeidbar waren. Hätten wir sie zu Anfang schon verstanden, hätten wir die Trillser vielleicht besser dabei begleiten können.
Als Stadtviertel, als Quartier war Trills gut ausgestattet mit Kirche, Kindergarten und Franziskushaus. Das galt in gleicher Weise für Sandheide, wo in dem Gemeindezentrum seit 1972 alle notwendigen Räume vorhanden waren. In Millrath standen Pfarrheim und Kindergarten nebeneinander, das evangelische Paul-Schneider-Haus war als Raum für den Gottesdienst nur eine kleine Strecke davon entfernt. Nur in Alt-Hochahl gab es außer der evangelischen Kirche für den Gottesdienst für die katholische Gemeinde keinen Kindergarten und kein Pfarrheim. – Die räumliche Struktur für die katholische Seelsorge war also im Endausbau sehr gut in den Bereich der neuen Stadt eingepasst. Die vielen Überlegungen, Diskussionen und Planungen hatten sich gelohnt.
Als die Diözesanleitung 2007/2010 meinte, die Hochdahler Gemeinde sei nicht mehr richtig katholisch und müsse wieder enger an Köln gebunden werden, da wurde diese Struktur zerstört. Am schlimmsten war für das Gemeindeleben, dass im Paul-Schneider-Haus und in der Neanderkirche kein Gottesdienst mehr stattfinden durfte. Ich glaube, dass dadurch in der ganzen Osthälfte der Neuen Stadt und auch in Alt-Hochdahl das religiöse Leben verkümmerte (soweit es die Katholiken betraf). Und das wäre eigentlich vorauszusehen gewesen.
Bei dieser Aktion der Diözese entstand gleichzeitig die Gefahr, dass Trills gegenüber seinem Status als einfaches Stadtviertel wieder aufgewertet wurde. Mein Nachfolger zog nämlich in das Pfarrhaus neben der Kirche, obwohl dem Ehepaar Ballhaus vorher für mehrere Jahre dort Wohnrecht zugesichert worden war – per Kirchenvorstandsbeschluss. Aber in Trills stand natürlich die alte Kirche und wo die Kirche ist, da muss auch der Pfarrer wohnen, und wo der Pfarrer ist, da ist die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob irgendwem bewusst war, dass damit in Trills die Situation vor 1972 und vielleicht auch das Kirchenbild der alten Trillser restauriert wurden. (Siehe oben unter „Tradition in Trills“). – Ich habe die ganze Zeit, die ich in Hochdahl gelebt habe, in der Willbeck gewohnt. Die Neue Stadt war für mich ein Gebilde von sieben Stadtvierteln. Der Mittelpunkt war der Hochdahler Markt. Das Haus der Kirchen war der Mittelpunkt für die katholische und die evangelische Gemeinde. – Wird jetzt Trills so etwas wie ein Ersatz-Zentrum? Und was wird dann aus den anderen Quartieren der Neuen Stadt?
58. Ökumene 3. Das Haus der Kirchen
Grundstück.
Offensichtlich ist von Anfang an geplant gewesen, dass im Zentrum der neuen Stadt Hochdahl auch die Kirchen ein Zentrum errichten würden und das sollte ökumenisch sein. Schon die Ökumenische Grundsatzvereinbarung von 1974 zwischen evangelischer und katholischer Kirchengemeinde enthält im zweiten Abschnitt diesen Plan und die Vereinbarung bindet die Gemeinden an die Verwirklichung dieser Absicht. Es hat dann zwar noch mehr als 10 Jahre bis zur Durchführung gedauert, aber die ganze Zeit über war das Ziel fest im Blick. Dieser Vertrag von 1974 war seinerseits schon das Ergebnis vielfältiger Beratungen und Verhandlungen in den Jahren davor und er ist aller Wahrscheinlichkeit nach die notwendige Voraussetzung dafür gewesen, dass es zu dem Kirchenzentrum als ökumenischer Einrichtung überhaupt gekommen ist. Leider war nämlich in den 80-er Jahren die ökumenische Begeisterung schon merklich abgekühlt.
Bei der ganzen Geschichte bis zur Fertigstellung des Hauses ist die faszinierendste Entwicklung für mich die Veränderung in der Grundstücksfrage. Nach dem Bundesbaugesetz war die Entwicklungsgesellschaft verpflichtet, den Kirchengemeinden als Vertretern öffentlichen Interesses ein Grundstück in jedem Baugebiet vorzuhalten. Für die Entwicklungsgesellschaft war die Einhaltung dieser Gesetzesvorgabe selbstverständlich. Wir haben sie auch immer wieder als fairen und verständnisvollen Verhandlungspartner kennengelernt. Als daher der Aufbau des Hochdahler Stadtzentrums begonnen wurde, war für die beiden Kirchengemeinden ein Grundstück reserviert. Und das hatte sage und schreibe die Größe von 4.000 qm. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht entschieden, ob das als ein Grundstück oder als zwei aneinandergrenzende Flächen erworben werden sollte. Wenn ich mich recht erinnere, sollte das geplante Gebäude – wie schon in der Grundsatzvereinbarung vorgesehen – einen einheitlichen Charakter haben. Vermutlich wäre es nach dem additiven Modell gebaut worden. Ob es zu mehr als einer gemeinsamen Brandmauer und vielleicht noch zu einem gemeinsamen Foyer gekommen wäre, ist nicht sicher. Allerdings sind die Einzelheiten zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausführlich diskutiert worden. Das ökumenische Zentrum war zwar dauernd im Gespräch, aber es ging dabei immer um die grundsätzliche Frage, ob wir überhaupt eine Chance hätten, irgendwann zu bauen. Die Unsicherheit kam von zwei Seiten. Einmal war es das Problem, dass die Diözese sich nicht in der Lage sah, einen solchen Bau zu finanzieren. Deshalb war es nicht überraschend, dass von dort der Vorschlag kam, die vorgesehene Fläche zu verkleinern. Andererseits konnte die Entwicklungsgesellschaft nicht jahrelang warten, bis die Kirchen wieder Geld haben würden. Sie machte sich also zur gleichen Zeit Gedanken über eine anderweitige Nutzung des Grundstücks. Mit der Hoffnung, der Realisierung vielleicht doch noch näher zu kommen, stimmten die Kirchengemeinden einer Reduzierung des Flächenbedarfs um mehr als die Hälfte zu (Ende 1980). Schon diese Veränderung war für manche Beteiligten eine herbe Enttäuschung, da wir doch so schöne Pläne hatten! Einige Monate später bot die Entwicklungsgesellschaft den Gemeinden die Vorbereitung des Kaufvertrags an. Das war wohl ein Signal, dass die Planungen für die Bebauung des Bereichs, in dem das vorgesehene Kirchengrundstück lag, schon weit fortgeschritten waren. Aber so sehr wir auch den Wunsch hatten, das ökumenische Zentrum zu bauen, zu der Zeit scheiterten alle Pläne an der Finanzierung. Die Gesellschaft, die die übrigen Gebäude errichten sollte, übernahm auch das Kirchengrundstück. Das hieß für uns: das Grundstück war weg. Und das war im Herbst 1982. Da, wo das ökumenische Kirchengebäude hätte stehen sollen, entstand ein Supermarkt, den „Plus“ (später „Netto“ genannt) übernahm. Und die Kirchengemeinden blieben ohne Grundstück zurück!
Als Ausweg hätten wir in dem dort entstehenden Baukomplex Teileigentum erwerben können. Bei den entsprechenden Verhandlungen stellte sich aber heraus, dass dieses Angebot für uns nicht geeignet war. Nach der Fertigstellung wurde das ganz offensichtlich. Die Räume, die wir hätten erwerben können, waren so eng und klein, dass wir sie für unsere Zwecke nicht hätten nutzen können. Wieder eine Möglichkeit weniger!
Die einzige Fläche, die danach noch zur Vervollständigung des Stadtzentrums bebaut werden sollte, war in der Südwestecke des Hochdahler Marktes, zwischen Beckhauser und Karschhauser Straße. Und die Entwicklungsgesellschaft machte uns klar, dass das jetzt die letzte Chance sei. Wenn wir da nicht bauen würden, gäbe es im Stadtzentrum für uns keine Möglichkeit mehr. Das war ein heilsamer Druck, den wir auch nach Köln weitergeben konnten. Und wir waren fest entschlossen. Bei näheren Verhandlungen wurden uns dann zwei Möglichkeiten angeboten. Gleichzeitig mussten wir aber zur Kenntnis nehmen, dass wir in Bezug auf die Größe des Grundstücks sehr bescheiden werden müssten. Ein Standort hätte sein können westlich der Beckhauser Straße. Dort hätten wir sogar ein freistehendes Gebäude errichten können. Allerdings lag dieser Bauplatz etwas außerhalb der „Fußgängerströme“ des Marktes. Deshalb haben wir uns für die andere Fläche entschieden, näher am Markt (da, wo heute das „Haus der Kirchen“ steht). Und dieses Grundstück hatte die Größe von 138 qm! Welcher Abstieg nach den ursprünglich 4.000 qm!
Aber was wie ein Abstieg aussah und von vielen auch so empfunden wurde, war eigentlich ein Geschenk des Himmels! Jetzt brauchten wir nicht mehr über eine gemeinsame Brandmauer, einen einheitlichen Eingangsbereich oder die Gruppierung von Gebäuden um einen öffentlichen Platz zu beraten. Hier gab es nur eins: eine hoch-integrative Lösung! Auf der kleinen Fläche gingen wir in die Höhe, verteilten die Quadratmeter an beide Gemeinden und stellten uns den Aufgaben, die die Lage am Markt – inmitten von „Fußgängerströmen“ – uns aufgab.
Dass wir im ökumenischen Zentrum in der Stadtmitte mit so wenig Platz auskamen, haben wir eigentlich dem ersten Stadtplaner Professor Alois Machtemes zu verdanken. Die neue Stadt war konzipiert als eine Einheit, auch als es noch galt, 45.000 Menschen unterzubringen. Sie war deutlich gegliedert in Quartiere, die aber nirgendwo total voneinander getrennt waren. Die Quartiere sollten die Bereiche sein, in denen sich das alltägliche Leben vollzog. Sie waren gruppiert um ein Stadtzentrum, das durch Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Arztpraxen, Büros eine ausgesprochene zentrale Funktion haben sollte. Es sollte der Mittelpunkt der Stadt sein, von allen Stadtvierteln aus auch zu Fuß zu erreichen. Wenn man bedenkt, dass anderswo bei einem ähnlich umfangreichen Projekt zwei oder drei getrennte Baugebiete entstanden sind, kann man erkennen, wie genial das Konzept von Machtemes war. Einheit in der Vielfalt! – In der ursprünglichen Planung sollte jedes Quartier auch ein eigenes „Subzentrum“ zur Versorgung mit dem alltäglich Notwendigen erhalten. Als die neue Stadt wuchs, stellte sich allmählich heraus, dass diese Subzentren nicht wirklich lebensfähig waren. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass Hochdahl nicht mehr so groß werden sollte. 1978 rechnete man für den Endausbau nur noch mit 35.000 Einwohnern. Die Folge für das Konzept der neuen Stadt war eine klarere Unterscheidung zwischen Quartieren und Zentrum. Es gab nur ein Zentrum und die acht Quartiere hatten kein wirkliches Zentrum mehr.
Wäre Hochdahl in drei Baugebiete zerfallen, dann hätte das für die katholische Kirche bedeutet, dass drei Pfarreien entstanden wären. Die hätten natürlich auch drei Pfarrzentren haben müssen mit allen für jede Pfarrei notwendigen Einrichtungen. In diese Richtung scheinen die ersten Überlegungen zur kirchlichen Gliederung vor 1970 auch gegangen zu sein. Das ist nicht verwunderlich, denn so wurde in allen anderen Neubaugebieten geplant und gebaut. Was dann aus einem ökumenischen Zentrum geworden wäre, ist fraglich. Und ob die drei getrennten Mittelpunkte heute noch mit Leben zu füllen wären, ist genauso unklar. Bei dem städtebaulichen Konzept für Hochdahl gab es auch kirchlich nur ein Zentrum und das sollte und konnte ökumenisch sein. Die Einrichtungen für das „alltägliche kirchliche Leben“ wurden in den Stadtvierteln gebaut, von beiden Gemeinden mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dabei wurde die geplante „schachbrettartige Verteilung“ leicht variiert, weil der Bedarf etwas anders war als die am Reißbrett entstandene ursprüngliche Planung. Als wir Ende 1982 daran gingen, ein Konzept für das „kleine“ Haus der Kirchen am Hochdahler Markt zu entwerfen, da konnten wir deshalb viele Dinge streichen, die in den frühen Überlegungen zur Gestaltung des ökumenischen Zentrums bedacht worden waren. Die katholische Gemeinde hatte drei Gemeindehäuser und auch drei Kindergärten in Sandheide, Millrath-Ost und Trills. Wir hatten vier Gottesdienststätten in Trills, Sandheide, Millrath(ev.) und Alt-Hochdahl(ev.). Die Pfarrbücherei, die in anderen Gemeindezentren oft vorhanden ist, hatten wir schon in frühen Jahren aufgelöst. Ein Jugendzentrum war nicht mehr vorgesehen. Zeitweise hat die Stadt einen solchen Treffpunkt für die Jugend mit sachverständigem Personal geführt, später hat der TSV diese Aufgabe übernommen. All das brauchten wir für das ökumenische Zentrum nicht zu berücksichtigen, weil es entweder in den Quartieren vorhanden war oder weil andere Träger dafür da waren. Einige Veranstaltungen, die etwas mehr Platz brauchten, wie das ökumenische Bildungswerk, waren seit einige Jahren schon so fest in Sandheide beheimatet, dass es unsinnig gewesen wäre, sie ins Stadtzentrum verlagern zu wollen – Nicht nur das Grundstück war geschrumpft, sondern auch die Aktivitäten, die wir dort unterbringen mussten.
Konzeption
Im Herbst 1982 trat eine Gruppe zusammen, um die Konzeption für das Ökumenische Zentrum am Hochdahler Markt neu zu durchdenken. In dieser Gruppe waren je vier Mitglieder der evangelischen und katholischen Gemeinde. Das Ergebnis der Überlegungen konnte schon im März 1983 vorgelegt werden. Es war die Grundlage, nach der wenige Jahre später das Haus der Kirchen – mit nur wenigen Veränderungen – gebaut worden ist.
Diese Gespräche waren zweifellos notwendig. Bis dahin waren die Vorstellungen, was und wie man gemeinsam bauen wollte, noch sehr vorläufig gewesen. Und der Rahmen, in dem sich die Gedanken dabei bewegten, war eine additive Lösung auf 4.000 qm. Inzwischen war
abzusehen, dass nur ein Gebäude auf kleinstem Grundstück möglich sein würde mit allen zentralen Funktionen beider Gemeinden. Und der Baufortschritt am Hochdahler Markt verlangte dringend nach einer Klärung, welche Bedeutung ein „Haus der Kirchen“ für den Bürger auf dem Markt haben könnte. Der Zeitpunkt allerdings, an dem die Gruppe zusammentrat, ist aus heutiger Sicht etwas überraschend. War doch gerade das ursprünglich vorgesehene Grundstück verloren gegangen und ein Ersatz noch nicht gefunden. Wenn man will, kann man in diesem Vorgang ein Signal erkennen, wie fest entschlossen die beiden Gemeinden waren, am Hochdahler Markt dabei zu sein.
Die Konzeption ist in dem gemeinsamen Heft von „Gemeindegruß“(ev.) und „Aspekte“(kath.) zum „Haus der Kirchen“ von September 1986 abgedruckt. Für zwei Aufgabenfelder musste das ökumenische Zentrum geeignet sein. Einerseits sollte es der räumliche Mittelpunkt beider Gemeinden sein und für alle „Zentralen Aufgaben“ Platz bieten. Was die Gemeinden in den Stadtvierteln für die „Grundversorgung“ ihrer Gemeindemitglieder brauchten, das war seit vielen Jahren besprochen, geplant und errichtet worden. Wenn auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles fertiggestellt war, so war doch die Planungsphase dafür abgeschlossen. Bisher gab es aber nur begrenzte Möglichkeiten für die Wahrnehmung der „Zentralen Aufgaben“. Einiges davon wurde selbstverständlich schon durchgeführt, zum Teil seit vielen Jahren (Fortbildungsangebote, Leitungsaufgaben, Verwaltung usw.), aber gewissermaßen ausgelagert in die Häuser in den Quartieren. Jetzt sollten diese Aufgaben in der Mitte der Stadt zusammengeführt werden. – Die zweite Aufgabe war, wie mir scheint, bisher nicht so deutlich im Blick gewesen. Sie wurde erst richtig bewusst, als das Stadtzentrum, der Hochdahler Markt, allmählich Gestalt annahm. Da wurde erkennbar, dass das Haus der Kirchen auch eine wichtige Funktion mitten unter den Bürgern, zwischen Geschäften und Praxen und Büros oder im Strom der Käufer haben würde. Die Verfasser der Konzeption haben diese Funktion sehr selbstbewusst und mutig formuliert. Unter der Überschrift „Die Präsenz der Kirche(n) in der Mitte der Stadt.“ heißt es: „Der Auftrag der Kirche weist sie … an die Öffentlichkeit eines städtischen Gemeinwesens (sichtbares Zeichen).“ In einer Zeit, in der Religion und Glaube nur noch als Privatsache akzeptiert werden, ist das ein Bekenntnis zu einer Ordnungsvorstellung, die zum gesellschaftlichen Konsens quer liegt. Es ist zwar richtig, dass sich die Kirche immer wieder zurückziehen muss, um sich auf ihre Quellen und die Herkunft ihres Lebens zu besinnen. Auch davon spricht die Konzeption in diesem Zusammenhang: „Die Gemeinde sammelt sich zum Gottesdienst und anderen Zusammenkünften in den vorhandenen kirchlichen Zentren innerhalb der Wohnviertel“. Andererseits „tritt die Kirche nach außen“, nicht um von den Leuten gesehen und als wichtiger „Mitspieler“ hofiert zu werden, sondern weil es ihrem unverzichtbaren Auftrag entspricht. Es geht schließlich um das Heil der Welt und nicht um eine gesellschaftliche Rolle oder um private Bedürfnisse. Ist es Zufall, dass dieses Innen und Außen der Lebensvollzüge der Kirche in Hochdahl wieder einen Bezug zum Aufbauplan der neuen Stadt hat?
(Das Zueinander von Geborgenheit im Gottesdienst und Wirken nach außen stand schon einmal zur Debatte: sollen die Vorhänge in Heilig Geist offen oder geschlossen sein? Vgl. „Das Pfarrzentrum Heilig Geist wird eingeweiht.“)
Welche konkrete Gestalt die beiden Bereiche „Kirche am Markt“ und „Zentrale Aufgaben“ haben sollten, ist in der Konzeption im Einzelnen aufgelistet. Eine große Bedeutung für die „Kirche am Markt“ hatte der Andachtsraum/Raum der Stille, und zwar sowohl bei den entsprechenden Überlegungen während der Planung als auch nach der Fertigstellung. Die Konzeption meint dazu: „Mitten im Getriebe des Alltagsgeschehens, wie es sich in einem größeren Einkaufszentrum abspielt, soll der Mensch – der gemeindenahe wie der der Kirche fernstehende – einen Ort der Stille, der Besinnung und des Gebetes finden. Der Andachtsraum soll darum eine gegen das Getriebe abgeschirmte, Ruhe und Sammlung vermittelnde Atmosphäre haben. … Der Andachtsraum wird vor allem während der Geschäftszeiten frei zugänglich sein.“ Diesen Dienst an den Bürgern auf dem Markt hat der Raum der Stille nach der Eröffnung eindeutig ermöglicht. Erfahrbar wird das vor allem bei der Morgenandacht am Markttag, donnerstags um 9,45 Uhr. Seit der Eröffnung des Hauses gibt es eine Gruppe von Mitgliedern beider Gemeinden, die sich um die Vorbereitung und Gestaltung dieser besinnlichen Viertelstunde bemüht, damit die Besucher „im Getriebe des Alltagsgeschehens“ zur Ruhe und zu sich selbst finden können. Es scheint, dass der Raum der Stille aber auch einzelne Menschen im Lauf des Tages zum Besuch einlädt. Vor kurzem erzählte jemand, dass er sich in seiner lebensbedrohenden Krankheit immer wieder dorthin zurückgezogen hätte. Solche Vorgänge bleiben verständlicherweise meist im Verborgenen. – Das zweite Angebot der Kirche am Markt lief ursprünglich unter dem Titel „Informationsladen“. Die Vorstellung von einem „Laden“ ist dann aber bald aufgegeben worden, weil das eigentliche Ziel ja nichts mit Kaufen und Verkaufen zu tun hatte. In der Konzeption heißt es nämlich: „Mit dem Laden treten die Gemeinden nach außen und sprechen „offensiv“ Menschen an, vor allem solche, die sich noch nicht (z.B. Neubürger) oder nicht mehr kirchlich beheimatet fühlen.“ Dieser Bereich sollte also offensichtlich eine „missionarische Ausrichtung“ haben. Keiner hat natürlich dabei an freiwillige Mitarbeiter gedacht, die vor der Tür fromme Schriften anbieten oder auf erhöhtem Podest Erweckungspredigten halten. Diese negative Abgrenzung ist leicht zu ziehen, aber wie die neue Beheimatung in der Kirche wirklich geschehen könnte, war wohl auch nach der Fertigstellung des Hauses nicht klar. Ich halte es grundsätzlich für fraglich, ob dieses Haus so etwas überhaupt leisten kann. – Demgegenüber ist es im Haus der Kirchen all die Jahre gelungen, dem Bürger oder Käufer auf dem Markt die Informationen anzubieten, die er wünschte. Diese Aufgabe hat nach der Eröffnung des Hauses das Foyer übernommen. Das war naheliegend, denn wer aus dem „Strom der Käufer“ heraus das Haus der Kirchen betritt, kommt zunächst in das Foyer. Dort sind immer freiwillige Mitarbeiter, die die Eintretenden begrüßen. Sie können informieren über Taufe, Erstkommunion. Konfirmation und Firmung, sie kennen die verschiedenen Gruppierungen der beiden Gemeinden und können erste Kontakte herstellen. Sie wissen, wie man in die Büros der beiden Gemeinden gelangt und wo die Leute für Beratung und soziale Fragen zu finden sind. Lange Jahre gab es dafür auch ein ausführliches Informationsblatt mit Terminen und Namen und Angeboten beider Gemeinden. Über die Information hinaus haben die Mitarbeiter auch vielfältige Kontakte untereinander und mit und zwischen den Besuchern geschaffen. Wer es wünschte, konnte dabei auch ein wenig verweilen und eine Tasse Kaffee trinken. Das war es wohl, was dem Foyer auch den Namen „Kirchencafé“ einbrachte. Man darf annehmen, dass für die Bürger auf dem Markt das Haus der Kirchen einladend wirkte und die Mitarbeiter als freundliche Zeitgenossen in der Erinnerung blieben. Und vielleicht hat der eine oder andere Besucher als seine Erfahrung formuliert: „Och, die sind nett, die Leute im Kirchencafé“. – Das ist wenig angesichts des hohen Ziels in der Konzeption, dass die Kirche nach außen tritt. Aber es scheint, dass bei vielen kirchlichen Vollzügen schon viel erreicht ist, wenn die Teilnehmer in dem Augenblick spüren, dass es mehr gibt als Alltag und Geschäft. Und wenn auch die Mitarbeiter im Foyer so etwas immer wieder erleben lassen, dann sind das vielleicht kleine Impulse. Aber wer weiß, wie die wirken und wohin sie führen. – Im Foyer gab es noch andere Aktivitäten, die sich ebenfalls an die Bürger auf dem Markt richteten, ohne gleich dem Anspruch einer missionarischen Ausrichtung zu genügen. In regelmäßigen Abständen gab es die Stadtgespräche, samstags morgens während der Geschäftszeiten. Manchmal zogen sie so viele Teilnehmer an, dass alle drei Ebenen des Foyers – oberes und unteres Foyer und Galeriegeschoss – für die Zuhörer reserviert werden mussten. Die Thematik drehte sich häufig um die Stadt, in der wir lebten, politisch, gesellschaftlich und auch kirchlich. Aber es konnte auch sein, dass es um den Haushalt der Kölner Kirche ging oder um soziale Brennpunkte oder, später einmal, um Erinnerungen an die frühen Jahre der neuen Stadt Hochdahl. – Die Ausstellungen waren ein spezielles Angebot im Foyer. Vielfach waren es Hochdahler Künstler, die ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich machten, Fotografien, Malereien oder Installationen. Und ein besonderes Erlebnis war es, wenn man den betreffenden Künstler aus Begegnungen im Alltag kannte.
Die konkrete Gestalt des Bereichs „Zentrale Aufgaben“ ist in der Konzeption schlüssig und klar beschrieben. Darüber war ja auch jahrelang intensiv nachgedacht und diskutiert worden. (vgl. „Eine Gemeinde für 20.000 Katholiken …?“) Das Mitarbeiterzentrum ist dabei die Funktion, die am deutlichsten „zentral“ ist. Oft haben wir das Haus der Kirchen deswegen auch als „Nervenzentrum“ der Gemeinden bezeichnet. Dazu sagt die Konzeption: „Im Haus der Kirchen sollen die verschiedenen Gruppen von Mitarbeitern, die für die Gestaltung des Gemeindelebens verantwortlich und aktiv sind, ein Zentrum finden, in dem sie zu Sitzungen, Arbeitsbesprechungen, Zurüstung und Fortbildung zusammenkommen.“ Genannt werden Presbyterium, Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, die Pfarrer und andere Hauptamtliche („getrennt und ökumenisch“), Mitarbeiterkreise der Jugendarbeit, Vorbereitungsgruppen für Kindergottesdienste und andere Gottesdienste, Mitarbeiterkreis für die verschiedenen Gruppen der Gemeindearbeit mit Erwachsenen. Das Haus der Kirchen als „Mitarbeiterzentrum“ sollte also viele aktive Gemeindemitglieder zusammenführen. Dabei hatten wir die Vorstellung, „dass sich die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen persönlich begegnen und dass Informationswände im Foyer und Arbeitstafeln in den Gruppenräumen über die Arbeit der anderen informieren.“ Das sollte zu einem intensiveren Erfahrungsaustausch führen und das Bewusstsein stärken, „dass alle Mitarbeiter als Glieder an dem einen Leib Christi wirken.“ Manchmal haben wir phantasiert und dann tauchte in unseren Zukunftsvisionen das Bild auf, dass sich an manchen Abenden die Leiter verschiedener Gruppen zum Haus der Kirchen begeben, sich im Foyer treffen und über ihre Erfahrungen austauschen, und dabei ganz natürlich „Ökumene“ leben. Selbst ein Kaffeautomat oder eine Getränkebar war in diesen Vorstellungen schon vorhanden. Es war schön, miteinander solchen Bildern Raum zu geben, auch wenn vieles davon ein Traum geblieben ist. Nach der Fertigstellung ist nämlich die Nutzung des Hauses als Mitarbeiterzentrum deutlich hinter den Plänen zurückgeblieben. Manche Sitzung und manches Treffen fand weiterhin im Quartier statt, vielleicht weil die Räume dort mehr Platz boten oder weil sie von der Atmosphäre her angenehmer waren. Vielleicht war es auch einfach eine Frage von Gewohnheit. Allerdings war dann eine ökumenische Begegnung nicht möglich, weil man ja dort in den eigenen Räumen zusammenkam. – Als weitere gesamtgemeindliche Aufgabe nennt die Konzeption die spezialisierten Angebote. Damit greift sie eine Vorstellung auf, die schon sehr früh entstanden ist. Schon 1970 war entschieden, dass Hochdahl eine Pfarrei bleiben und in einer Balance zwischen „Großraumseelsorge“ und „Grundversorgung“ entwickelt werden sollte. Unter anderem reizten uns dabei die Möglichkeiten, die die Größe der Gemeinde (nach damaliger Vorstellung noch ca. 20.000 Mitglieder) zu bieten versprach. Die Zahl der leitenden Mitarbeiter würde größer sein als sonst üblich. Sie hätten damit die Chance, sich zu spezialisieren und ihre besonderen Fähigkeiten in der Seelsorge einzusetzen. Dementsprechend wäre es möglich, den Bedürfnissen bestimmter Gruppe in der Gemeinde entgegenzukommen (z.B. beruflich bedingt wie bei Arbeitskreisen für Lehrer oder Erzieherinnen oder interessenbedingt wie bei sangesfreudigen Jugendlichen). Und Aktivitäten, die sonst überregional durchgeführt werden (z.B. Gruppenleiterschulungen), könnten wegen der großen Zahl der Gemeindemitglieder in der eigenen Pfarrei stattfinden. So haben wir uns bei den ersten Überlegungen zum Partnerschaftsseminar die Frage gestellt, ob wir nicht den Brautleutekurs in Hochdahl selbst durchführen könnten, statt die Leute nach Düsseldorf zu schicken. Bei der Formulierung der Konzeption war klar, dass solche Angebote als zentrale Aufgaben der Gemeinde im Stadtzentrum angebunden werden müssten. Und wir konnten hoffen, dass durch die ökumenische Zusammenarbeit sowohl die Zahl der Interessierten als auch die Zahl der leitenden Mitarbeiter noch zunehmen würde. Es war nicht beabsichtigt, für diese Aktivitäten im Haus der Kirchen zusätzliche Räume vorzusehen. Da solche Treffen normalerweise in größeren Abständen stattfinden, konnte man davon ausgehen, dass sie in den geplanten Räumen ohne Probleme unterzubringen wären. Allerdings ist auch hierbei später manches in die Stadtviertel verlegt worden, was nach der Theorie ins Haus der Kirchen gehört hätte. – Beide Gemeinden hatten schon seit Jahren Sozial- und Beratungsdienste, die bis dahin in den Quartieren lokalisiert waren. Für alle, die diese Dienste nutzten, war es natürlich eine große Erleichterung, dazu in Zukunft zum Hochdahler Markt gehen zu können und den Besuch beim Sozialdienst vielleicht mit einem Einkauf zu verbinden. – So ähnlich war es wohl für die Besucher der Büros der beiden Gemeinden. Sowohl das evangelische Gemeindeamt als auch das katholische Pfarrbüro lagen bis dahin am Rand der neuen Stadt. Beide sollten nun in der Stadtmitte erreichbar sein. Diese Veränderung war zweifellos auch ein Gewinn für die Ökumene, weil dadurch Information und Absprache wesentlich erleichtert wurden. Wie wichtig die Rolle der Büros für das Haus der Kirchen war, konnte man allerdings erst im Laufe der nächsten Jahre richtig erkennen. In den Büros war immer jemand da! Wie die Regelung im evangelischen Gemeindeamt aussah, kann ich nicht ganz beurteilen. Das Pfarrbüro jedenfalls war jeden Tag vormittags und nachmittags besetzt. Die Leute wussten, wer von den beiden Sekretärinnen zu welcher Zeit da war. Und sehr viele Fäden liefen im Büro zusammen. Wie oft habe ich auf eine Frage eines Gemeindemitglieds geantwortet: „Das weiß ich nicht, rufen Sie doch mal im Pfarrbüro an.“! Das wurde möglich durch eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vielleicht hatte das Pfarrbüro einen wichtigen Anteil daran, wenn etwas von der Vorstellung vom „Nervenzentrum“ im Haus der Kirchen Wirklichkeit geworden ist. Auf solche Zuverlässigkeit haben wir in unserer Arbeit immer Wert gelegt. Es sei daran erinnert, dass wir jahrzehntelang eine feste Gottesdienstordnung hatten. Es muss halt feste Bräuche geben! – Wenn man die Rolle des Büros im Haus der Kirchen so einschätzt, kommt auch wieder das Foyer in den Blick. Trotz mancher Schwierigkeiten sind immer wieder zahlreiche freiwillige Mitarbeiter da, die dafür sorgen, dass das Haus der Kirchen während der Geschäftszeiten offen ist. Ein einladender Dienst, der zuverlässig geleistet wird durch die Mitarbeit vieler verschiedener und unterschiedlicher Menschen! Es scheint, dass sich Foyer und Büros ergänzen und miteinander dazu beitragen, dass die Kirche in der Mitte der Stadt erkennbar wird.
Architektenwettbewerb
Für das „Haus der Kirchen“ wurde im Juli 1984 ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, bei dem sich 5 Architekten beteiligten. Am 27.November begutachtete ein Preisgericht die Entwürfe und vergab den ersten Preis an Herrn Wolfgang Müller-Zantop, Dipl.-Ing. Architekt BDA, aus Essen. Dieser Entwurf sollte auch der weiteren Bauplanung zugrunde liegen.
In der Entwurf-Skizze des Erdgeschosses zieht vor allem die markante Form des Raums der Stille die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Dabei fallen bei genauem Zusehen kleine Einzelheiten besonders auf. Die (durch die gestrichelte Linie angedeutete) Fassade der Obergeschosse springt über dem Raum der Stille zurück, sodass vom Hochdahler Markt, vom „Strom der Käufer“ her auch die Wand des Raums der Stille sichtbar wird. Ganz versteckt ist der Eingang von außen an der rechten, der östliche Seite des Gebäudes. Wir haben ihn immer die „Schlupftür“ genannt. Da an dieser Seite nur wenige Passanten vorbeigehen, kann ein stiller Beter in den Raum „hineinschlüpfen“ ohne besonderer Beobachtung ausgesetzt zu sein. Bei den ersten Schritten in den Raum ist er auch noch geschützt, da er zunächst eine Nische betritt. Ob das eine besonders raffinierte oder kluge und rücksichtsvolle Idee des Architekten war oder nur der Positionierung von Aufzug und Treppenhaus geschuldet war, ist nicht bekannt. In den Erläuterungen zum Entwurf schreibt Herr Müller-Zantop: „Die geometrische Rundform des „Raumes der Stille“ ist als Identifikationsform geplant und steht im Gegensatz zu den scharfkantigen Formen der Obergeschosse. … Der „Raum der Stille“ ist als introvertierter, gegenüber dem Foyer abgesenkter Raum geplant. Vom Foyer gelangt man im Raum über eine plastisch geformte Gehrampe nach unten. …“ Der Zugang zum Foyer vom Markt her liegt hinter der Linie der Säulen, die die Obergeschosse tragen. Bis zur Tür des Hauses sind es dann noch ein bis zwei Schritte. Dadurch gewinnt das Foyer etwas Distanz zum Treiben auf dem Markt. Und wenn man hineinkommt, fällt die interessante Gliederung des Raumes auf. Da das Gelände an der Südwest-Seite des Hauses um etwa eine halbe Geschosshöhe abfällt, war es möglich, im Innern drei verschiedene Ebenen zu planen. Von der Tür her betritt man das mittlere Niveau, im Hintergrund kann man dann zum Galeriegeschoss hinaufgehen oder durch das untere Foyer und die untere Tür das Haus wieder verlassen. Ich habe den Eindruck, dass durch diese Gestaltung das Foyer insgesamt ein Gefühl von Weite und Offenheit vermittelt, gleichzeitig aber auch anheimelnd und bergend wirkt. Und oberdrein bietet es viel Platz für Besucher und Teilnehmer von Veranstaltungen. – Für das Bild des Hauses insgesamt sind die „scharfkantigen Formen der Obergeschosse“ entscheidend. Es ist natürlich nicht abwegig, wenn jemand auf einem dreieckigen Grundstück auch ein dreieckiges Gebäude plant. Auch das könnte je nach Ausführung eine gute Leistung sein. Ein anderer Teilnehmer am Wettbewerb hatte nämlich einen Entwurf vorgelegt, dessen besonderes Charakteristikum eine mächtige Fassade war, die oben von einem halbrunden Aufsatz, vielleicht sogar mit rundem Fenster, gekrönt war. Der dreieckige Bau, den Herr Müller-Zantop vorschlug, war weder bloße Anpassung an eine vorgegeben Grundstücksform noch das Buhlen um billigen Applaus. Er war Ausdruck einer bestimmten Idee. Er schreibt nämlich: „Der Verfasser hat einen scharfkantigen, geometrischen Baukörper als Eckstein und Kontrast zu den abgeschrägten Formen der umgebende Bebauung geplant.“ Für mich ist es kein Zufall, dass sein Begriff „Eckstein“ an den biblischen Sprachgebrauch erinnert, wenn er den Kontrast auch ausdrücklich auf die umgebende Bebauung bezieht. Da taucht wieder die Vorstellung der Konzeption auf, dass die Kirche einen Auftrag in der Mitte der Stadt hat. Und der „Eckstein“ weist darauf hin, dass der nicht einfach mit den Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft übereinstimmt. Und nach vielen Jahren taucht im Innern die bange Frage auf, ob wir das Kantige und Gefährliche der Botschaft nicht zu oft dem Machbaren und Gefälligen geopfert haben.
Die letzte Hürde
Eigentlich – so dachten wir – sei nun alles soweit klar: wir hatten uns für ein Grundstück entschieden, wir hatten viel über die Aufgabe und Bedeutung des Hauses nachgedacht, ein Architekt hatte einen großartigen Plan vorgelegt, dieser Architekt sollte auch die Ausführung übernehmen. Was konnte uns denn jetzt noch daran hindern zu bauen? Die Diözese konnte es und tat es. Einer, der damals maßgeblich dabei war, erinnert sich, dass der Erzbischöfliche Rat das Projekt drei Mal abgelehnt habe. Bei dieser Auseinandersetzung hatten wir natürlich das Gefühl, für eine Sache kämpfen zu müssen, die wir für gut und richtig und notwendig hielten. Man kann es auch positiv deuten und annehmen, dass dieser Prozess eine wertvolle weitere Abklärung und in manchen Punkten eine noch fehlende Konkretisierung gebracht hat. Die evangelische Gemeinde musste in gleicher Weise den Bau vom Kirchenkreis und der Landeskirche genehmigen lassen, die auch für den größten Teil der Finanzierung aufkommen mussten.
Der erste Grund für die Ablehnung waren die Kosten. Das war nachvollziehbar, denn im Januar 1985 (Pfarrversammlung am 11.1.) wurden sie noch auf 2,3 Millionen DM geschätzt. Die Hälfte davon hätte jede der beiden Gemeinden finanzieren müssen. Die Diözese war nicht bereit, die Kosten für die katholische Gemeinde insgesamt zu übernehmen. Die uns schon bekannte Begründung dafür lautete, dass wäre eine ungerechte Bevorzugung Hochdahls auf Kosten anderer Gemeinden. Wie beim Roncalli-Haus wurden uns 400.000 DM zugesagt. Im Lauf der Verhandlungen wurden zusätzlich die anteiligen Kosten für den Erwerb des Grundstücks übernommen. 440.000 DM konnte die Kirchengemeinde durch den Verkauf eines Grundstücks hinter der Trillser Kirche selbst aufbringen. Aber damit war die Finanzierung noch nicht gesichert. Das Generalvikariat hat immer wieder auf eine Verbilligung der gesamten Maßnahme gedrungen. Das war nur zu erreichen, wenn Abstriche an der ursprünglichen Planung vorgenommen wurden. Der Architekt schlug vor, das Kellergeschoss zu streichen, die Auskragung der SW-Wand im ersten Obergeschoss wegzulassen (=Verbilligung der Deckenkonstruktion) und billigere Materialien zu verwenden. Er hoffte, dadurch 400.000 DM sparen zu können. Die Überlegungen zur Finanzierung und der davon abhängigen baulichen Gestaltung sind im Laufe des Jahres 1985 immer wieder hin und her gegangen. Die Gespräche zwischen der „Achterbande“ (4+4 wie bei der Erarbeitung der Konzeption) und den Verantwortlichen des Generalvikariats, besonders Herrn Oberbaurat Dr.Bollenbeck, waren intensiv, oft kontrovers, aber immer um eine gute Lösung bemüht. Das hat – verbunden mit dem Vertrauen auf die Beteiligung der Gemeinde – schließlich zum Erfolg geführt. – Außer den Problemen der Finanzierung und Bauausführung gab es auch „ideologische“ Schwierigkeiten. Beim Raum der Stille spukten anscheinend noch gut katholische Bilder und Traditionen in den kölner Köpfen herum. Wenn ich mich recht erinnere, war es strittig, ob nicht zu einem Andachtsraum auch ein Tabernakel gehört. Aber der hieß ja immer schon „Raum der Stille“ und es war nicht an eine „Kapelle“ gedacht. Das Argument, das schließlich überzeugte, war wohl der Hinweis, dass alle gottesdienstlichen Aktivitäten ja in den Stadtvierteln und den dort vorhandenen Kirchen vollzogen würden. Inzwischen bestätigt die jahrelange Erfahrung die damalige Zuversicht, dass der Raum durch den Verzicht auf das typisch Katholische nicht verloren, sondern gewonnen hat. (Das ist keine Absage an die katholische Form der eucharistischen Frömmigkeit!). – Die nächste Schwierigkeit war nicht einvernehmlich zu lösen, wohl weil sie stärker von theologischen oder kirchenpolitischen Festlegungen bestimmt war. Es scheint, dass sich das Problem an der Gestaltung des Erdgeschosses entzündet hat. Es sollte nach den bisherigen Plänen gemeinsames Eigentum beider Gemeinden werden und gemeinsam genutzt werden. Die Glaubenswächter befürchteten den Verlust des jeweiligen Gemeindeprofils und einen konfessionellen Mischmasch. Diese Sorge bezog sich wahrscheinlich auf die Konzeption des gesamten Projektes. In dem Haus auf kleinem Grundstück wäre ja eine integrative Lösung das Ideal gewesen. Aber so etwas gab es nirgendwo. An der Stelle hätten wir die ökumenische Grundsatzdiskussion anfangen müssen, denn das ist kein Problem beim Bau eines Hauses, sondern eine Frage nach den Vorstellungen und Möglichkeiten der Wiedervereinigung. Wenn man die Einheit im Glauben anstrebt (und dazu bekennen sich die Konfessionen doch immer), wieso ist dann die Frage – offensichtlich bis auf den heutigen Tag – nicht geklärt, ob und wie weit man sich dabei auch gemeinsames Eigentum vorstellen will. Und das ist ein Thema, dem sehr viele wichtige andere Themen vorausgehen, die genau so wenig diskutiert werden. – Der Bescheid von Köln lautete: Es soll auf die Grundsatzvereinbarung von 1974 (Nr.26) zurückgegangen werden, indem auf eine integrierte Lösung verzichtet und eine additive angestrebt wird. Dieses Diktum signalisiert, dass in den Überlegungen in Köln die vertraglich abgesicherte Grundsatzvereinbarung ernst genommen wurde. Andererseits wurde beim Rückgriff auf diese Vereinbarung übersehen, dass der Schwund des Grundstücks von 4.000 auf 138 qm ganz neue Chancen eröffnete, die sich niemand 1974 vorstellen konnte. Wir sind dem Bescheid gefolgt, von heute her betrachtet vielleicht etwas schnell und unbekümmert. Vermutlich war es uns so wichtig, das Haus zu bekommen, dass wir auf die integrative Lösung verzichtet und einer klaren additiven Besitzverteilung zugestimmt haben. Das hat die Diözese dann auch genehmigt. Das hieß: die katholische Gemeinde nimmt das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss in Besitz, die evangelische Gemeinde übernimmt das Kellergeschoss, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss. Das war ein schwerer Verlust für die Konzeption des Hauses, denn damit fiel die gemeinsame Nutzung einer Etage als Mitarbeiterzentrum und die gemeinsame Nutzung einer Etage für beide Büros weg. Dass das Mitarbeiterzentrum nach der Fertigstellung viel weniger gebracht hat als in der Konzeption vorgesehen, hat vermutlich in dieser Entscheidung die wichtigste Ursache. – In konkreten Fragen war die Diözese dann aber auch flexibel, vor allem als es darum ging, dass beide Gemeinden einen gleich großen Anteil am Eigentum bekommen sollten. Dieser „gleich große Anteil“ war auch noch eine Schwierigkeit, über die heftig und lange diskutiert worden ist. Bei der oben beschriebenen Verteilung der Flächen hätte die evangelische Gemeinde einen deutlich größeren Anteil gehabt, aber nicht finanzieren können. Die Einigung lautete schließlich, dass beide Gemeinden sowohl einen gleichen Anteil am Eigentum haben sollten als auch eine gleiche Summe zu finanzieren hätten. Bis auf einen Unterschied von ein paar Quadratmetern ist das dann auch möglich geworden.
Und so konnte also gebaut werden. Die Firma, die die übrigen Gebäude neben dem Haus der Kirchen errichten sollte, war bereit, die Arbeiten für das Haus der Kirchen mit zu übernehmen. Die Grundsteinlegung war am 21.Juni 1986. Und am 19.September 1987 wurde das Haus der Kirchen am Hochdahler Markt feierlich eröffnet.
59. Gemeindekatechese 6, Firmung 2
Dreißig Jahre lang war die Firmvorbereitung ein zentrales Anliegen unserer seelsorglichen Bemühungen. Und es ist erfreulich, dass sie auch nach 2007 in der Hochdahler Gemeinde noch mit ähnlicher Intensität und Sorgfalt weitergeführt wird.
Dabei waren die ersten Jahre deutlich vom Schwung des neuen Anfangs geprägt. Und in der Erinnerung ist noch sehr lebendig, mit wie viel Ernst Jugendliche damals um den Glauben und ihre Entscheidung zur Firmung gerungen haben. In der späteren Zeit haben wir immer wieder die Organisation der Firmvorbereitung den veränderten Bedingungen angepasst. Einmal haben wir sogar das Firmalter noch ein halbes Jahr hinaufgesetzt. Das konnten wir aber nicht lange durchhalten, weil dadurch für die Schüler im Gymnasium der Abstand zur Vorbereitung auf das Abitur zu kurz wurde. Von den Entwicklungen in den späteren Jahren soll hier erzählt werden.
Welche Gestalt muss ein Glaubenskurs haben, wenn Jugendliche sich mit ihrem Glauben auseinandersetzen und im Verstehen der Botschaft Fortschritte machen sollen? Bekanntlich ist „Frontalunterricht“ eine der schlechtesten Methoden zur Vermittlung von Erkenntnissen. Und wenn man die Menschen dort abholen soll, wo sie stehen, dann müssen die religiösen Vorstellungen der Jugendlichen zur Sprache kommen können. Das, was sie mitbringen, mag noch so rudimentär oder fragwürdig sein, es muss unbedingt der Ausgangspunkt des weiteren Prozesses sein. Gängige Praxis scheint aber zu sein, dass man den Jugendlichen erst einmal einen Vortrag hält, über den sie dann anschließend in kleiner Gruppe sprechen können. Die Situation der Jugendlichen kommt dabei fast überhaupt nicht zur Sprache. Das geschieht erst, wenn Jugendliche selbst erzählen können, was sie beschäftigt, was sie meinen und glauben, was sie und wie sie eigentlich leben. Und so etwas kann nur im Gespräch in der kleinen Gruppe geschehen. Deshalb hatte unsere Mappe mit Anregungen und Hilfen für die Gruppentreffen den Titel „Glaubensgespräche mit jungen Menschen – Firmbausteine für 17jährige“.
In der Mappe gab es ein einfaches Beispiel, wie ein solches Gespräch in Gang gebracht werden kann. Wir nannten es „Das Kuchenspiel“. In der Anleitung hieß es: „Das Kuchenspiel soll klären helfen, welche Schwerpunkte der Einzelne in seinem Leben setzt. Dies schafft die Basis, über weitergehende Sinnfragen konkret angebunden denken und sprechen zu können.“ Jedes Gruppenmitglied malte einen großen Kreis auf ein Blatt Papier, welcher seinen persönlichen „Zeitkuchen“ (oder auch „Energiekuchen“) symbolisieren sollte. „Jeder lässt nun die vergangene Woche oder den letzten Tag vor seinem Auge vorbeiziehen und sucht zu klären, wie viel Zeit (oder Energie) er für wen und für was eingesetzt hat. In entsprechend große Stücke wird der Kreis eingeteilt.“ So konnte die Lebenssituation der Beteiligten deutlich werden. Anschließend war es möglich, miteinander darüber zu sprechen, was das Bild über die augenblickliche Sinngebung des Lebens erkennen lässt, wie weit man damit einverstanden ist oder welche Mängel, Wünsche oder Erfahrungen dahinter stehen.
Die Vorstellungen der Jugendlichen als Ausgangspunkt zu wählen, ist auch bei eigentlichen Glaubensfragen möglich. Wenn es um die Hinführung zur Botschaft und zum Wirken Jesu ging, haben wir die Jugendlichen manchmal erzählen lassen, welche Geschichte aus dem Evangelium ihnen am liebsten war. Die Auswahl sagte oft schon sehr viel über den Zugang zum Evangelium. Das konnte im Gespräch herausgearbeitet werden. Immer wurde die Geschichte dann auch gelesen, um festzustellen, welche Veränderungen der Betreffende beim Erzählen vorgenommen hatte.
Um zu verstehen, warum der Bischof bei der Spendung der Firmung die Hände auflegt, wählten wir als Einleitung ins Gespräch häufig eine „Schreibmeditation“ über das Thema „Hände“. (Schreibmeditation: Plakatkarton; fünf oder sechs Teilnehmer; ein Stift; schweigend schreiben, was zum Thema einfällt; anschließend Gespräch). Wenn wir mit Firmgruppen im Wochenende waren, haben wir uns manchmal auch gegenseitig die Hände aufgelegt, um den Sinn des Vorgangs zu „erspüren“.
Wenn die Gegebenheiten und Möglichkeiten des eigenen Lebens Gegenstand des Gesprächs sein sollen, muss in der Gruppe eine Atmosphäre von Offenheit und Vertrauen herrschen. Die ist nur zu erreichen, wenn die Teilnehmer sich regelmäßig und häufig genug treffen. Deshalb war es für uns klar, dass die Gruppentreffen jede Woche stattfinden mussten. Heute hält man diese Praxis oft für nicht mehr zeitgemäß. Man sagt, dass die jungen Leute durch Schule oder beginnende Berufsausbildung dafür nicht mehr die Zeit aufbringen könnten. Noch häufiger ist der Hinweis, solche Regelmäßigkeit entspreche nicht mehr dem modernen Lebensrhythmus der Jugendlichen. Sie verabreden sich kurzfristig, kommunizieren über soziale Netzwerke und haben viele „Freunde“ im Netz. Wenn das so ist, muss man allerdings die Frage stellen, wo sie noch stabile Beziehungen, Verlässlichkeit und einen tragfähigen Lebensrhythmus lernen können. Und wo können sie die Erfahrung machen, dass „Gemeinschaft“ einen hohen und unverzichtbaren Wert hat, den man nicht durch Veranstaltungen, Angebote und Events erreicht, sondern nur dadurch, dass man miteinander lebt? Und nur, wenn man sich dabei über seinen Glaubens und sein Leben austauscht, kann man ein wenig „Glaubensgemeinschaft“ trainieren. Wenn sich die Kirche, die Gemeinde stattdessen als „Servicestation“ verkauft, darf sie sich nicht wundern, wenn die Jugendlichen später als Eltern von Kommunionkindern nur so viel Interesse zeigen, wie nötig ist, um die Ausrichtung einer schönen Feier zu erreichen. „Service“ bedeutet halt auch „Geschäft“.
Die entscheidenden Elemente unserer Firmvorbereitung haben wir die ganzen Jahre durchgehalten. Die jungen Leute trafen sich während des Glaubenskurses einmal in der Woche abends für etwa zwei Stunden. Acht bis zehn Mitglieder pro Gruppe hielten wir für optimal, damit ein lebendiger Austausch zustande kommen konnte. Jede Gruppe sollte drei Begleiter haben, einen Mann, eine Frau und einen (gefirmten) Jugendlichen. In der Praxis waren diese Vorgaben nicht immer zu erreichen. Dann mussten wir eben Kompromisse eingehen.
Entscheidend für das Gelingen des Firmkurses ist die Arbeit der Begleiter. Seit Beginn der Firmvorbereitung im Jahre 1977 galt bei uns die Regel, dass jede Gruppe drei Begleiter haben sollte. Wenn die Jugendlichen auch im Glaubenskurs der Vielfalt des Lebens und der Unterschiedlichkeit heutiger Lebensvollzüge begegnen sollen, dann muss es in der Gruppe der Begleiter Männer und Frauen, Jugendliche und Erwachsene geben und auch unterschiedliche Berufsgruppen sollten vertreten sein. Drei Begleiter erleichtern es auch den Jugendlichen in der Gruppe, für sich eine Bezugsperson zu finden. – Die Vorbereitung für die Firmgruppe wird dadurch allerdings aufwendiger. Die drei müssen sich über die Thematik des bevorstehenden Gruppentreffens klar werden, Ideen sammeln, den Ablauf strukturieren und ihre jeweilige Rolle in der Leitung des Abends besprechen. Bei dieser Absprache dürfen die unterschiedlichen Meinungen nicht „glattgebügelt werden“. Und auch die gemeinsame Leitung darf nicht aufgegeben werden, weil vielleicht einer den Eindruck erweckt, dafür besonders befähigt zu sein. Das gemeinsame „Suchen und Fragen“ hielten wir für den Weg zur Erkenntnis der Wahrheit.
Wie bei jeder anderen Gruppe, hatten die Begleiter natürlich auch eine „Leitungsfunktion“: Planung des Firmkurses und der einzelnen Abende für ihre Gruppe, Absprache mit den Teilnehmern über die „Spielregeln“ (z.B. Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit, Form von Entschuldigungen), Absprache über zusätzliche Gruppenaktivitäten usw. – Inhaltlich sollten sie die Gruppe „begleiten“. Das war für viele eine auf Anhieb unverständliche Beschreibung. Wie bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion hatten manche Bedenken, eine Gruppe zu übernehmen. Sie seien doch keine Theologen und hätten nicht das nötige Wissen. Im Laufe der Zeit wuchs in der Gemeinde aber die Einsicht, dass es nicht um die Vermittlung von Wissen, sondern um das Zeugnis des eigenen Glaubens ging. Wenn die Jugendlichen am Anfang des Gesprächs von ihren eigenen Erfahrungen und Vorstellungen erzählen, dann ist es ja grundsätzlich nicht möglich, mit einem Vortrag oder mit den unveränderlichen Sätzen des Glaubens fortzufahren. Die Begleiter müssen zu verstehen versuchen, warum jemand eine bestimmte Einstellung hat. Dazu müssen sie viel fragen, überlegen und wieder fragen. Und dann müssen sie ihre eigenen Erfahrungen und Vorstellungen ins Gespräch bringen, nicht als die Lösung aller Schwierigkeiten, sondern als eine andere mögliche Sicht. Dabei kann es sein, dass das höhere Alter oder die längere Glaubens- und Lebenserfahrung Argumente bereitstellen, die die Jüngeren auf ihrer Suche voranbringen. Allerdings wird auch der Begleiter immer wieder durch die Ansichten der anderen Mitglieder der Gruppe in seinem Verständnis wachsen. – Entscheidend war es, dass die Begleiter im Gespräch mit den Jugendlichen glaubwürdig waren. Sie mussten fähig und bereit sein, über ihre Erfahrungen mit dem Glauben und dem Leben, mit Gott und der Kirche und sich selbst zu sprechen. Und dabei sollten sie die tragenden Einsichten formulieren, die Gründe für Glaube und Zuversicht, aber auch die Zweifel und Unsicherheiten. Wenn es vorkam, dass sich Leute zur Begleitung meldeten, die ihren festen, unanfechtbaren Glauben an die unwissenden Jugendlichen weitergeben wollten, dann hatten wir verständlicherweise große Probleme. Wir hatten die Vorstellung, dass alle Beteiligten in den Gruppen im Gespräch und im Suchen miteinander dem Glauben und der Erkenntnis Gottes näher kommen und ihren eigenen Glaubensweg finden könnten.
Der Zeitaufwand für die Begleiter in der Firmvorbereitung war beträchtlich. Das haben wir nie bestritten, aber auch immer begründet. Wir waren der Meinung, dass die Hinführung zur Firmung und die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation einen hohen Aufwand erfordert und rechtfertigt. Glaubensweitergabe zum Nulltarif kann es nicht geben. – Außer der wöchentlichen Gruppenstunde und dem zusätzlichen Termin für die Vorbereitung gab es immer noch die Begleitertreffen für die ganze Gruppe der Begleiter. Vor Beginn der Gruppenphase luden wir zu einem Abend, einem Samstag und einem Wochenende ein. Während der Gruppenphase war jeden Monat ein Treffen, einmal an einem Abend, im nächsten Monat an einem Samstag. Bei den Treffen arbeiteten wir zu den gleichen Themen, die die Begleiter mit den Gruppen besprechen sollten. Es gab natürlich keine fertigen Stundenentwürfe, sondern Überlegungen und Gespräche zu den eigenen Fragen und Antworten bei dem zu besprechenden Thema. Ziel war der eigene Erkenntnisfortschritt bei den Begleitern. Normalerweise ergaben sich dabei aber auch Wege und Perspektiven für die Arbeit mit den Jugendlichen. – Auch die Methode des Gesprächs haben wir mit den Begleitern eingeübt. Wenn es in der Gruppe um Erzählen geht, ist eine Abgrenzung zu den sonst normalen Gesprächsformen unbedingt nötig. Dafür gab es in den späteren Jahren klare Regeln in Form einer „Anweisung für Kleingruppen-Gespräche“.
Anweisung für Kleingruppen-Gespräche (wenn es in der Arbeitsanweisung z.B. heißt: „erzählen Sie den andern …, stellen Sie den andern vor …, tauschen Sie sich darüber aus, was Ihnen klar geworden ist … ).
- Die Form des Gesprächs ist „Erzählen“ – das Ziel ist, sich dem andern erkennbar zu machen bzw. den andern zu erkennen.
- Die Atmosphäre sollte von Vertrauen, Rücksicht und Diskretion geprägt sein. Alle Formen von Zugreifen, Wissen-wollen, Besser-wissen sind nicht gestattet. Deshalb kann es eigentlich bei solchen Gesprächen keine Diskussionen geben, bei denen Standpunkte gegeneinander gestellt werden.
- Da es um persönliche Dinge geht, darf und sollte ich jeweils selbst entscheiden, was ich von mir preisgebe und was ich für mich behalte. Es kann also sein, dass ich in einer Einzelbeschäftigung viel mehr über mich erkannt habe, aber davon nur einen Teil weitergebe – unter Umständen auch noch in verallgemeinerter Form.
- Rückfragen der übrigen Teilnehmer sind gut, wenn sie aus echtem Interesse und Zuwendung gestellt werden. Jeder Versuch, mit – u.U. heimlicher – Gewalt in andere zu dringen, ist unzulässig.
- Es muss für alle Beteiligten selbstverständlich sein, dass persönliche Dinge nicht an Außenstehende weitererzählt werden.
Die Organisation der Firmvorbereitung haben wir im Lauf der Jahre immer wieder den veränderten Bedingungen angepasst. Als Beispiel sei hier der Ablauf beschrieben, wie wir ihn über längere Zeit praktiziert haben. – Im Mai schickten wir den Jugendlichen der Gemeinde, die im betreffenden Jahr 17 Jahre alt wurden, eine schriftliche Einladung. Der Brief ging an alle, die zwischen dem 1.1. und dem31.12. geboren waren. Zeitweise haben wir auch schon einmal einen ganzen Schuljahrgang eingeladen, also von Sommer zu Sommer. Aber den Geburtsjahrgang hielten wir für besser, weil dadurch in einer Jahrgangsstufe in der Schule die älteren Schüler in einem Jahr und die jüngeren im nächsten gefirmt wurden. Das hatte den Effekt, dass innerhalb der Jahrgangsstufe die älteren Schüler den jüngeren von ihren Erfahrungen erzählen konnten. Das wirkte normalerweise als Reklame für den Firmkurs. – Der Brief enthielt eine kurze Einführung in Inhalt und Ablauf des Kurses und natürlich auch einen Hinweis, dass es zunächst um eine Klärung der eigenen Glaubenssituation gehen und die Entscheidung zur Firmung erst am Ende getroffen werden sollte. Den Brief haben wir zunächst mit der Post verschickt. Irgendwann wurde uns dann bewusst, dass viele Jugendliche keine Vorstellung mehr hatten, was Firmung bedeutet. Einige Gemeindemitglieder haben sich daraufhin bereit erklärt, den Brief persönlich zu überbringen, um im Gespräch mit dem Empfänger über den Firmkurs und die Firmung zu informieren. Da wir jedes Jahr über
hundert Jugendliche eingeladen haben, konnten wir nicht alle besuchen. Ein unterschiedlich großer Rest von Briefen musste dann doch mit der Post zugestellt werden. – Ebenfalls im Mai begannen wir mit der Werbung der Begleiter. Zunächst gab es einen Informationsabend. Dazu wurden alle eingeladen, die sich ein Bild von der Arbeit der Begleiter machen wollten. Und ehemalige Firmbegleiter berichteten von ihren Erfahrungen. Manche entschlossen sich schon sofort an diesem Abend, beim nächsten Firmkurs mitzumachen. Aber das waren immer nur wenige. Für die Werbung der übrigen liefen dann die verschiedenen Telefone heiß. Wenn sich 60 Jugendliche anmeldeten, dann mussten wir sechs Gruppen anbieten. Das bedeutete, dass wir 18 Begleiter brauchten. Es gab mehrere Gruppen von Gemeindemitgliedern, die wir für die Begleitung zu gewinnen suchten. In Frage kamen Damen und Herren, die schon bei der Erstkommunion und bei der Buße als Begleiter der Kinder Erfahrungen mit der Glaubensverkündigung gemacht hatten. Weiter rechneten wir damit, dass bei vielen Eltern der Jugendlichen ein gesteigertes Interesse am Firmkurs vorhanden sei, wobei wir im Normalfall davon ausgingen, dass Vater/Mutter und Sohn/Tochter nicht in derselben Gruppe landen würden. Weiter fragten wir bei Leuten an, die uns in irgendeinem Zusammenhang als aufgeschlossen und einsatzwillig begegnet waren. Auch Gemeindemitglieder, die schon in einer anderen Gruppe oder Aktivität eingebunden waren, sahen wir als potentielle Firmbegleiter an. Wenn sie dann darauf hinwiesen, sie seien doch schon im Dienst der Gemeinde tätig, dann stellten wir zur Debatte, ob sie nicht für das halbe Jahr diese Mitarbeit zugunsten der Firmvorbereitung aussetzen könnten. Die Firmvorbereitung hatte auch in der Perspektive der Gemeinde einen hohen Stellenwert. Allen war aber auch klar, dass die Aufgabe der Begleiter sehr viel Zeit und Mühe verlangte. Viele, die wir fragten, konnten diesen Aufwand nicht leisten. Deshalb war die Werbung der Begleiter oft mühsam und immer wieder auch frustrierend. Trotzdem wollten wir uns keine „billigere Form“ gestatten, weil wir diesen Arbeitsbereich für wesentlich hielten.
Ehe die Gruppenphase begann, gab es für die Begleiter eine intensive Einführung in ihre Tätigkeit. Wir luden sie zu drei Treffen ein – einem Abend, einem Samstag (von 10 bis 17 Uhr) und einem Wochenende. Da sie sich am Ende der Vorbereitung zu Dreier-Teams zusammenfinden mussten, war es wichtig, dass sie sich bis dahin gut kennenlernten. Dann ging es um Themen wie: „Warum wollen Sie Firmbegleitung machen?“, „Welche Ängste und Hoffnungen haben Sie?“, „Was für ein Bild von Jugendlichen haben Sie?“, „Was möchten Sie erreichen?“, „Wie gehen Sie mit Enttäuschungen um?“, „Wie war Ihre eigene religiöse Entwicklung?“ – Wir wollten dabei den zukünftigen Begleitern ein Stück weit helfen, sich über sich selbst und ihre Vorstellungen von den Jugendlichen und der bevorstehenden Aufgabe klar zu werden. Denn jeder hat in einer solchen Situation eine Menge innerer Bilder, Erfahrungen und Vor-Urteile; werden die nicht ins Gespräch gehoben, gehen sie unbewusst und damit unkontrolliert in das Verhalten und die Beziehungen ein. – Die Methode bei dieser Arbeit war weder Referat noch Diskussion, sondern Gespräch. Das vollzog sich meist in drei Schritten. Es gab zunächst einen Einstieg in Form eines Textes, eines Bildes, einer Erfahrung. Meist folgte darauf eine „Einzelarbeit“, eine kurze Zeit zum persönlichen Durchdenken oder Nachempfinden. Das mündete praktisch immer in einen Austausch im Gespräch zu zweit, zu dritt oder im Plenum. Immer gab es für den Weg der Erarbeitung eine klare Anweisung, die die „Begleiter der Begleiter“ vorher durchdacht und entworfen hatten. – Die „Begleiter der Begleiter“ waren zwei oder drei Personen – ein Geistlicher und ein oder zwei Leute, die schon Erfahrungen in Firmgruppen gesammelt hatten. Sie waren für den gesamten Ablauf des Firmkurses und für die Arbeit mit den Begleitern verantwortlich. Auch diese Aufgabe war sehr zeitaufwendig. Die Vorbereitung für einen Abend oder einen Samstag mit den Begleitern verlangte mindestens zwei Treffen, die zwei Stunden oder länger dauern konnten. Sie war aber auch reizvoll, da es möglich war, immer wieder neue Ideen und eine neue Gestaltung der Begleitertreffen zu entwickeln. Dabei mussten wir nicht jedes Mal „das Rad neu erfinden“, weil wir uns an unserer bewährten Firmmappe entlang hangeln konnten. Aber eine neue Deutung oder Erarbeitung eines Themas machte die Arbeit und die Treffen immer wieder spannend. – Das Arbeitsmaterial, das wir die ganze Zeit hindurch benutzt haben, war eine Mappe, die in Hochdahl selbst Mitte der 80-er Jahre entstanden ist. Sie hatte den programmatischen Titel: „Glaubensgespräche mit jungen Menschen – Firmbausteine für 17jährige“. Eine Gruppe von ehemaligen Firmbegleitern und Theologen – Hermine Jagusch, Helga Lancelle-Tullius, Hildegard Smoch, Gerd Verhoeven und Joachim Weis – hatten darin die Ergebnisse der bisherigen Arbeit mit den Jugendlichen gesammelt. Ernst Werner und Leopold Haerst haben die Mappe zum Druck vorbereitet und der Deutsche Katechetenverein in München hat sie verlegt und jahrelang im Verlagsprogramm gehabt. Die Anregungen dieser „Glaubensgespräche“ sind von vielen Gemeinden aufgegriffen worden. 1993 betrug die gedruckte Gesamtauflage 9600 Exemplare. Später nahm der Katechetenverein eine neue Firmmappe in sein Programm auf mit dem Titel „Mich firmen lassen“ (etwa im Jahr 2000 – 6.Auflage 2005), die wir neben unserer Mappe in den letzten Jahren ebenfalls benutzt haben.
Die „Teamfindung“ war ein sehr entscheidender Vorgang am Ende der Vorbereitungsphase der neuen Firmbegleiter. Bei den drei erwähnten Treffen versammelten sie sich als Gruppe von zum Beispiel 18 Personen plus zwei oder drei „Begleiter der Begleiter“. Für die Arbeit mit den Jugendlichen brauchten wir dann aber sechs Teams von je drei Leuten – einem Mann, einer Frau und einem Jugendlichen. Diese Aufteilung war ein ebenso wichtiger wie schwieriger Vorgang. Die drei Mitglieder eines Teams mussten ja so gut zueinander passen, dass sie ein halbes Jahr lang eine Gruppe von Jugendlichen mit Freude und innerem Schwung begleiten konnten. Und das musste nicht nur für ein, sondern für alle sechs Teams gelten. Diese Aufteilung der ganzen Gruppe in die einzelnen Teams ist unterschiedlich durchgeführt worden. Einmal konnte zum Beispiel jeder Begleiter seine Wünsche schriftlich formulieren und einer der Verantwortlichen versuchte daraus die Zusammenstellung der Teams abzuleiten. Ein andermal versuchte man im Gruppengespräch die passenden Leute herauszufinden und zusammenzuführen. – Ich erlebte bei der Teamfindung mein erstes Debakel und habe das später immer mit dem Titel „Ommerborn“ zitiert. Ich hatte kurz vorher von Gerd Verhoeven die Durchführung der Firmvorbereitung übernommen, die er seit 1977 zehn Jahre lang geleitet hatte. Und ich fühlte mich an manchen Stellen noch recht unsicher. Und dann fuhren wir zum Wochenende als letztem Treffen vor Beginn der Gruppenarbeit nach Ommerborn, einem ehemaligen Kloster, das von der Kölner Diözese für Schulungen angeboten wurde. Wie das Wochenende insgesamt abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr. Für Sonntag vor dem Mittagessen war die Teamfindung vorgesehen. Insgesamt war die Zahl der Begleiter relativ groß. Als wir begannen, stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Beteiligten ihre Teams schon gefunden hatten – mit privaten Absprachen während der letzten beiden Tage. Übrig blieben sieben Personen – Erwachsene und Jugendliche. Und zwei Teams wurden noch gebraucht. Die sieben Übriggebliebenen so aufzuteilen, dass sie zueinander passten, erwies sich natürlich als unmöglich. Nur mit Ach und Krach gab es noch die beiden benötigten Teams, die dann auch in der Arbeit mit den Firmgruppen keinen rechten Erfolg hatten. Ommerborn und die misslungene Teamfindung! – Diese Erfahrung hatte dann allerdings eine gute Folge. Wir suchten und fanden ein neues Spiel für die Teamfindung. An dem Spiel waren alle beteiligt und trugen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass es gelang. Alle versammelten sich in einem entsprechend großen Raum. Auf dem Boden verteilt lagen Zeitungen, so viele, wie Teams gebildet werden mussten. Der Leiter des Spiels gab die Anweisungen. Zum Beispiel: Zuerst verteilen sich die Frauen auf die Zeitungen (Plätze), dann stellen sich die Männer dazu, dann die Jugendlichen. Dann kam die Frage: Können Sie sich vorstellen, in dieser Zusammensetzung ein halbes Jahr lang eine Firmgruppe zu begleiten? Dann musste jeder der drei für sich entscheiden: ja oder nein, und musste das den beiden anderen sagen – ohne Begründung und ohne Debatte. Antwortete einer der drei mit „nein“, dann zeigte die Gruppe die rote Karte. Sagten alle drei „ja“, dann wurde die grüne Karte hochgehoben. Zeigten alle Teams die grüne Karte, dann war das Spiel abgeschlossen und die Teams gebildet. Zur Sicherheit wurde nach einer kurzen Pause immer noch einmal ein Probedurchlauf gemacht, um eine allzu zufällige Entscheidung zu vermeiden. – Diese Form der Teamfindung war nicht einfach, weil keiner ausscheren konnte, bevor nicht alle Teams sich gebildet hatten. Einmal haben wir einen ganzen Abend lang einen Versuch nach dem anderen gemacht und gegen 23,30 Uhr die Sache ohne Ergebnis abgebrochen. Öfter kam es vor, dass jemand die Spielregeln in Frage stellte, wenn das Spiel nicht schnell genug zu einem Ergebnis führte. Wir haben aber auch viele schöne oder auch lustige Durchgänge erlebt. – Das Zauberwort bei dieser Form der Teamfindung hieß dosierter Verzicht. Zunächst stellten sich die Teilnehmer natürlich so zusammen, wie sie sich ihre Partner schon vorher ausgeguckt hatten. Und es soll Fälle gegeben haben, wo Leute ihre Traumkombination bis zum Schluss durchgehalten haben; die haben dann eben die anderen verzichten lassen. Im Normalfall hat das aber nicht funktioniert. Wenn mehrere Teilnehmer an ihrem Wunschteam festhielten, wurde dadurch die Wahlmöglichkeit der anderen so stark eingeschränkt, dass es immer wieder eine oder mehrere rote Karten gab. Dosierter Verzicht bedeutete dann, die Idealvorstellung aufzugeben und nach anderen möglichen Partnern Ausschau zu halten. Ein solches Verhalten fällt natürlich schwer, wenn jemand sehr unsicher ist oder vor der herankommenden Aufgabe viel Angst hat. Hinderlich oder belastend war es auch, wenn einige der Beteiligten sich vorher nicht genügend kennen gelernt hatten. – Gelang die Teamfindung und waren das Wochenende und die anderen Treffen gut abgelaufen, dann stellte sich oft am Ende der Vorbereitung eine fast euphorische Stimmung ein. Immer wieder haben wir darüber gestaunt, dass Menschen, die sich vorher kaum oder gar nicht kannten, innerhalb so kurzer Zeit zu einer vertrauensvollen Gemeinschaft zusammenwuchsen.
Die Firmgruppen begannen Mitte September mit einem Samstagnachmittag für alle, die sich (bis Mitte Juni) angemeldet hatten. Bei spielerischen oder besinnlichen Angeboten (Malen, Kochen, Singen, Türme bauen, Tonarbeiten, Kerzen verzieren usw.) hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, einander kennen zu lernen. Und zu diesem Zweck gab es auch immer zwei Durchgänge mit wechselnder Besetzung. Anschließend bot die Kochgruppe ein Abendessen an mit den Speisen, die sie vorbereitet hatte. Bevor die Jugendmesse den Nachmittag beschloss, fanden sich die Jugendlichen zu den einzelnen Firmgruppen zusammen. Dazu hingen an der Rückwand der Kirche so viele Plakate, wie Gruppen gebildet werden mussten. Die Jugendlichen sollten selber entscheiden, in welche Gruppe sie gehen wollten und sollten sich deshalb selbst auf den Plakaten eintragen. Und damit nicht einer seine ganzen Freunde untereinander eintrug, wurde jeder Einzelne aufgerufen und schrieb seinen Namen selber auf das Plakat. Dass aber trotzdem Freunde zueinander kamen, war erwünscht. Andere Auswahlkriterien waren: der angebotene Tag für den Gruppenabend und die Namen der Begleiter, die von vorneherein auf den Plakaten standen. Dass alle mit ihren Wünschen nach Tag, Freunden und Begleitern zum Ziel kamen, war nicht immer möglich. Dann suchten wir gemeinsam nach einem tragbaren Kompromiss.
Die Jugendlichen dazu zu bewegen, an den Jugendmessen teilzunehmen, die einmal im Monat angesetzt waren, war in den späten Jahren immer etwas mühsam. Das Zusammensein in der Gruppe und die Gespräche waren den Teilnehmern offensichtlich wichtig. Die Zustimmung zum Gottesdienst schien aber immer wieder schwer zu sein. Selbst wenn wir dazu einluden, dass jede Gruppe einmal eine Jugendmesse vorbereiten sollte, dann geschah das zwar, aber es war eher die Erfüllung einer gestellten Aufgabe als ein Weg zu mehr Freude am Gottesdienst. Dabei konnte es sogar vorkommen, dass eine Gruppe die Vorbereitung übernahm, aber nur zwei oder drei – stellvertretend – in der Messe anwesend waren. Auch wenn die Begleiter mit gutem Beispiel vorangingen, war die Wirkung normalerweise recht begrenzt. Trotzdem sind wir nie auf die Idee gekommen, an dieser Stelle Druck oder Kontrolle auszuüben. Es gibt ja letztlich keinen Vorgang, der so viel Freiheit verlangt wie der Glaube.
Für die Jugendlichen war die Wahl des Firmpaten oft ein Problem. Wir hatten zwei Empfehlungen: Sucht euch einen Paten, mit dem ihr im Gespräch seid und der euch ein paar Jahre voraus ist. Im Gespräch – zudem noch über den Glauben – waren sie natürlich vor allem in der Gruppe. Deshalb wählten viele einen der Begleiter; dann war es möglich, beide Ratschläge zu befolgen. Im Gespräch waren sie aber auch mit den jugendlichen Mitgliedern der Gruppe. Und deshalb kam es immer wieder vor, dass jemand ein anderes Gruppenmitglied als Paten haben wollte. Das war zwar nicht der Idealfall, aber oft die beste Lösung. Nur mussten wir bei der Firmung dann darauf achten, dass der „Pate“ vor dem „Patenkind“ gefirmt wurde, denn ein Pate sollte doch zumindest selbst gefirmt sein. In späteren Jahren kam es häufiger vor, dass Verwandte wieder als Paten gewählt wurden. Da setzte sich wohl das traditionelle Bild wieder durch – ohne viel Auseinandersetzung. Wenn ich mich recht erinnere, war es selten, dass ein Gemeindemitglied gewählt wurde, das nicht ebenfalls in die Firmvorbereitung eingebunden war.
Ein Grund zu Staunen und Dankbarkeit ist die Erinnerung an die Vorbereitung des Firmgottesdienstes. Der Termin dafür wurde bei den Treffen der Firmbegleiter festgelegt. Immer war dann eine Gruppe von engagierten Jugendlichen aus den Gruppen mit dabei. Meist hatten die sich auch schon vorher Gedanken zum Ablauf gemacht. Zunächst ging es meist um die Auswahl der Lieder – natürlich immer aus unserem Jugendliederbuch. Im Mittelpunkt des Abends stand dann die Suche nach einem Symbol, das die Erfahrungen der Vorbereitungszeit und den Akzent für den Gottesdienst verdeutlichen sollte. Und wir wurden immer wieder fündig. – Bei manchen Symbolen war der Bezug zu Glauben und Firmung sofort erkennbar. Die Öllämpchen nach antikem Vorbild und der Kompass waren ein Zeichen für die Hoffnung auf Licht und Weisung für den zukünftigen Lebensweg. Das bunte Spektrum, das die geschliffenen Glaskörper hervorzauberten, weckte die Dankbarkeit für die Vielfalt des Lebens und die bunte Eigenart der verschiedenen Menschen. Darauf sollte auch das Windrad hinweisen. Als wir es im Gottesdienst mit einem Gebläse in schnelle Umdrehung versetzten, verschmolzen die Farben der bunten Lamellen wirklich zu weiß. Im Anhauch des Geistes fügt sich die Vielfalt der Glaubenden zu Einheit des Volkes Gottes. Immer spielte das Symbol eine Rolle im Ablauf des Gottesdienstes. Einmal gingen die Jugendlichen beim Bußakt am Anfang der Messe nach vorne, nahmen einen der kleinen, mit Sand gefüllten Tonkrüge, gossen den Inhalt auf den Boden der Altarinsel und nahmen den leeren Krug mit auf den Platz. Sie hatten den Wunsch, von der Blockade durch Überflüssiges oder Falsches frei zu werden, um offen zu sein für das Wirken des Geistes. – Das Symbol des Firmgottesdienstes! Was uns im Laufe der Jahre aufging und was zunehmend Staunen und Dankbarkeit hervorrief, war die Tatsache, dass es jedes Jahr ein neues Symbol gab. Eine Wiederholung war sehr selten. Und das lag vor allem an der Phantasie und den Einfällen der Jugendlichen.
60. Wohlwollende Vertrautheit
Eine der intensivsten Erinnerungen an die Arbeit mit den Firmbegleitern ist mit einer Einheit zum Thema „Jesus Christus“ verbunden. Gegenstand war die Szene im Garten Gethsemani. Wir sahen dazu den entsprechenden Teil aus dem Film „Jesus Christ Superstar“. Wir hatten mit dem Jugendchor dieses Stück Anfang der 90-er Jahre gesungen und gespielt, sodass Inhalt und Interpretation den Begleitern durchweg vertraut waren. Die Darstellung des Ringens Jesu mit dem Vater ist für mich nach wie vor überzeugend. – Danach versuchten wir uns in zwei getrennten Gruppen in die Situation hineinzuversetzen. Wir waren die Apostel – nicht als Schlafende – mit der Frage, wie wir uns verhalten sollten – Jesus, einen Steinwurf weit von uns entfernt – wir spürten seine Not – konnten wir etwas tun, ihm irgendwie helfen? – hingehen? – wir sprachen miteinander und wir schwiegen miteinander – und wir blieben beieinander – die Distanz zu ihm blieb. - - - Die intensive Empfindung am Ende dieser Gruppe: Hilflosigkeit.
Eine Begegnung mit der Botschaft des Evangeliums! Und die vollzog sich nicht in irgendwelchen frommen „Anmutungen“, sondern sehr realistisch, deutlich im Kontext des eigenen Lebens. Aus einer solchen Konfrontation geht man verändert hervor. Und eine Begegnung mit den übrigen Teilnehmern der Gruppe! Und dabei werden manche Vorbehalte, Absicherungen und Distanzierungen plötzlich unwichtig. Und es ist leicht vorstellbar, dass man sich bei den normalen Begegnungen der nächsten Wochen anders verhält als vorher. Man ist durch die gemeinsame Erfahrung vertrauter miteinander geworden.
Diese Erinnerung tauchte auf, als ich der Frage nachging, wie weit die Firmvorbereitung das Zusammenleben in der Gemeinde beeinflusst hat. Jemand aus dem engeren Kreis der Verantwortlichen hatte nämlich auf eine solche „Langzeitwirkung“ unserer Arbeit hingewiesen. Und dieser Aspekt ist so wichtig, dass es sich lohnt, diesem Hinweis etwas nachzugehen. Bei der Beschreibung von Inhalt, Ziel und Ablauf der Firmvorbereitung (Gemeindekatechese 6) war der Blick nämlich zunächst eingeschränkt darauf fixiert, was und wie wir „vorbereitet“ hatten. Dabei ist schon im Zusammenhang mit Erstkommunion und Buße deutlich formuliert worden, dass es nicht nur um die jedes Jahr wiederkehrende Aufgabe geht, Kinder oder Erwachsene „auf etwas vorzubereiten“. Immer ist der „Gemeindeaufbau“ das eigentliche Ziel. Immer soll die Gemeinde als ganze wachsen im Glauben und in der Erkenntnis, und immer mehr soll sie zu einer Gemeinschaft im Geiste Jesu werden. Und etwas von einer neuen Kirche wird dabei erfahrbar.
Genau so war der „Hinweis“ gemeint, dass die Arbeit in der Firmvorbereitung die Gemeinde geprägt habe. Und so sah das konkret aus: Wenn man sich in der Gruppe über das eigene Leben und den eigenen Glauben austauscht, dann kommt es immer wieder zu intensiven Begegnungen. Deshalb entwickelten sich Kontakte aus den Firmgruppen oft zu sehr beständigen Freundschaften. Und die Bemühungen in der Runde der Begleiter webten in der Gemeinde ein Netz zwischen Menschen, die sich intensiv mit dem Glauben beschäftigt hatten. Wer es in der Firmbegleitung trainiert hatte, konnte sich auch an anderer Stelle über seine Glaubenserfahrung offen austauschen – in der Vorbereitung eines Gottesdienstes, im Familienkreis, in der Bibelwoche, in der Predigtvorbereitung, in der Begleiterrunde für die Kommunionkinder oder im Jugendchor. Dadurch war es für viele Gemeindemitglieder nicht mehr ungewohnt oder sogar verdächtig, wenn in Begegnungen und Treffen der gemeinsame Glaube Gegenstand des Gesprächs wurde. Durch den wiederholten Austausch entstand in der Gemeinde eine breite Basis von Glaubenswissen und Glaubenserfahrung. Und auch theologische Erkenntnisse waren dabei im Spiel, wenn sie durch die Bewährung eines gläubigen Lebens gegangen waren.
Für das Wachsen der Glaubenssubstanz ist es wichtig, dass möglichst viele Gemeindemitglieder an einem solchen Prozess teilnehmen können. In der Firmvorbereitung gab es von Anfang an die Regel, dass jemand nicht öfter als drei Mal hintereinander Begleiter sein durfte. Dann musste er eine Pause einlegen bis zu einem neuen Einsatz. Das sollte verhindern, dass sich eine falsche Routine einstellte. Es hatte aber sicher auch damit zu tun, dass wir in Hochdahl nie „Katecheten“ hatten, die für die Vorbereitung von Kommunion, Buße oder Firmung auf Dauer zuständig waren. In vielen Gemeinden ist diese Praxis die Norm und wo sie einmal etabliert ist, kann man sie kaum mehr verändern. Dann sind aber andere Gemeindemitglieder scheinbar nicht mehr nötig und sie haben keine Chance, ihre vielleicht genauso vorhandenen Fähigkeiten zu entwickeln. Für die Gemeinde bedeutet es, dass das Wachsen der Glaubenssubstanz willkürlich eingeschränkt wird.
Es entwickelte sich eine breit gestreute wohlwollende Vertrautheit. Und diese Vertrautheit hatte auch zur Folge, dass man sich gegenseitig unkompliziert half, entweder im Gespräch zur Bewältigung von Fragen, Unsicherheiten und Ängsten oder in tatkräftiger Unterstützung bei Alter und Krankheit. Dieses Wohlwollen und diese Vertrautheit waren kein Ergebnis von „guten Vorsätzen“ oder einer eingeübten „Verhaltenskultur“. Sie waren als solche in der Arbeit auch nicht das Ziel. Und diejenigen, die im Nachhinein dieses veränderte Zueinander registriert haben, waren verwundert und fühlten sich beschenkt. Ist es da vielleicht erlaubt, in dieser „breit gestreuten wohlwollenden Vertrautheit“ die Verheißung des Glaubens ein wenig erfüllt zu sehen und dahinter etwas von einem anderen, in Freiheit wirkenden Geist zu erleben? Das lässt sich selbstverständlich nicht beweisen. Jeder Versuch, ein „Wirken von oben“ dingfest zu machen, greift daneben. Aber wir dürfen doch die Zuversicht haben, dass es ein solches Wirken gibt.
Als wir vor kurzem auf diese Erfahrungen zurückblickten, waren wir verwundert und erfreut. Im Gespräch stellten sich aber sofort wieder Unsicherheit und Zweifel ein. Denn wie viele Menschen werden auf diesem Weg zueinander gefunden haben? Immerhin war die Zahl derer, die Firmbegleitung gemacht haben, begrenzt. Erst ganz allmählich wurde klar, dass es richtig ist, sich über solche Erfahrungen zu freuen, und dass die Frage nach der Zahl unberechtigt, wenn nicht sogar ein Zeichen von Unglaube ist. Wer nach der Zahl oder der Größe der Gruppe fragt, tut vielleicht etwas Ähnliches wie David, als er den Auftrag gab, das Volk zu zählen (2 Sam 24). Immer wieder hat mich die Frage beschäftigt, was an dieser Volkszählung so schlimm und warum die Strafe so ungeheuer war. Vielleicht kann man die Antwort in der Aussage des Joab finden, der sich zunächst dem Ansinnen Davids widersetzt: „Der Herr, dein Gott, möge das Volk vermehren, hundertmal mehr als es jetzt ist, und mein Herr und König möge es mit eigenen Augen sehen.“ Israel ist das Volk Jahwes und sein Leben und sein Wachstum ist eine Sache Gottes. David aber will es selbst wissen. Wenn er die Zahl der Krieger kennt, dann kann er für die Rettung und für die Sicherheit des Volkes einstehen.
Vielleicht sind die dauernden Statistiken und soziologischen Analysen zum Leben der Kirche gar nicht so heilsam. „Gottesdienstbesuch unter 10 %“ oder „Viele Christen glauben nicht mehr an die Auferstehung“ usw. Die übliche Folgerung lautet: die Kirche muss sich etwas einfallen lassen, wenn sie nicht untergehen will. Und die angefragten Betriebsberater haben viel gute Ratschläge parat: Anpassen der Strukturen, bessere Organisation, effektivere Verwendung der Ressourcen, gezielter Einsatz der finanziellen Mittel, gekonnter Auftritt in der Öffentlichkeit usw. Und wem das Schicksal der Kirche am Herzen liegt, ist dann in der großen Gefahr, die Rettung von seinem eigenen Einsatz und seiner Arbeit abhängig zu machen. Das kann dazu führen, dass man sich dauernd überfordert fühlt. Vielleicht liegt da die Ursache für die müde Resignation, die man vielfach feststellen kann. Ist es verwunderlich, dass das Volk Pestbeulen bekommt, wenn es so zur Verfügungsmasse von „Entscheidungsträgern“ wird? (2 Sam 24,15).
Gott kümmert sich um das Schicksal seines Volkes. Was ist dann aber unsere Aufgabe? Die Antwort kann man in dem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat finden (Mk 4, 26 – 29). Unsere Sache, die Sache der Glaubenden ist es, zu säen und zwar nicht irgendwelche schönen oder klugen Geschichten, sondern die Saat des Glaubens. Wir müssen uns bemühen um eine gute Firmvorbereitung und den Aufbau der Gemeinde. „Und der Sämann schläft und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht.“ Wenn wir unsere Sache tun, dann dürfen wir auch auf die Kraft vertrauen, die im Samen steckt. Und wir dürfen staunend registrieren, wenn so etwas wie ein Wunder geschieht und sich Vertrauen und Hoffnung und Zuneigung zeigen. Wir sind nicht dafür zuständig, das Wunder zu produzieren. Wunder liegen bekanntlich außerhalb der menschlichen Möglichkeiten. Sich bescheiden, aber tun, was unsere Sache ist! Das wird schön, aber auch etwas massiv, in einer Stelle bei Lukas formuliert: „Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.“ (Lk 17, 7 – 10).
Mit der Firmvorbereitung haben wir uns in Hochdahl viel Mühe gegeben. Und das war notwendig. Wenn das dazu geführt hat, dass sich zwischen Menschen (wie viel oder wenig es auch gewesen sein mögen) eine „wohlwollende Vertrautheit“ entwickelt, dann dürfen wir das registrieren und uns über dieses Geschenk freuen. Und wo ein solches Wunder auch sonst in der Gemeinde erkennbar wird, ist die gleiche Freude und Dankbarkeit am Platz. Die Auseinandersetzung mit dem Glauben war an vielen Stellen möglich und manchmal haben sich diese Bemühungen gegenseitig befruchtet und angeregt. Damit haben wir – um es noch einmal zu sagen – keinen Anspruch auf eine Erfahrung des Reiches Gottes begründet. Aber wir dürfen Vertrauen haben und uns über alle Lichtpunkte, die in der Gemeinde auftauchen, freuen. Eine große Gefahr ist seit einigen Jahren, dass wir mit solcher Dankbarkeit in die Vergangenheit schauen, aber unsere Bemühungen um den Glauben nicht mehr (intensiv genug) weiterführen.
61. Gemeindekatechese 7
Viele Jahre hindurch hat es in Hochdahl eine Taufgruppe für Schulkinder gegeben. Eine solche Gruppe wurde nötig, weil immer häufiger Kinder zur Erstkommunion angemeldet wurden, die noch nicht getauft waren. Auch in früheren Jahren war das immer wieder einmal vorgekommen, aber dann waren es meist nur einzelne Kinder, die normalerweise im Zusammenhang mit der Erstkommunionvorbereitung getauft wurden. In den 80-er Jahren nahm die Zahl deutlich zu, sodass wir vor der Frage standen, wie wir auf diese Situation reagieren sollten. Nun hatten wir uns ja wenige Jahre vorher schon intensiv mit der Taufpraxis beschäftigt, sodass es sich hier nur um eine neue Frage in einem bekannten Zusammenhang handelte. Was in Bezug auf die Taufpraxis 1978/79 zur Debatte stand, ist in dem Text „Gemeindekatechese 4“ (Nr. 49) ausführlich beschrieben. – Wenn es um die Taufe von Kleinkindern geht, richtet sich die Vorbereitung an die Eltern. Auf ihren Glauben hin werden die Kinder ja auch getauft. Wenn es aber um Schulkinder vor der Erstkommunion geht, dann müssen diese Kinder selbst vorbereitet werden. Die pastorale Aufgabe gleicht dann viel mehr der Beschäftigung mit den Kommunionkindern. Und so begannen wir 1984 mit der Taufgruppe für Schulkinder.
Wie bei allen anderen Formen der Gemeindekatechese waren die Begleiter der Kinder zwei Gemeindemitglieder, Mütter, die schon bei Erstkommunion- und Bußvorbereitung Erfahrungen gesammelt hatten. Im ersten Jahr waren die Kinder der Gruppe bereits im dritten Schuljahr und die Erstkommunion stand unmittelbar bevor. Offensichtlich haben die Beteiligten sofort gemerkt, dass diese Terminierung nicht besonders glücklich war. Es konnte ja der Eindruck entstehen, als ob die Taufe nur noch schnell durchgeführt werden müsste, weil es sonst keine Erstkommunion gab. Das ist zwar eine bis heute weit verbreitete Praxis, bedeutet aber eine unzulässige Abwertung der Taufe. Schließlich ist sie der Anfang des Lebens als Christ und verlangt im Idealfall nach einer grundlegenden Entscheidung. Deshalb war es richtig, dass schon bald die Taufgruppe für Kinder im zweiten Schuljahr angeboten wurde, als eigenständige Vorbereitung auf das alles entscheidende Sakrament. Es wurde dabei auch üblich, dass nur Kinder in dem entsprechenden Alter teilnehmen konnten. Es gab also keinen allgemeinen „Aufwasch“ für alle bis dahin nicht getauften Kinder einer Familie. Diese Regelung sollte es möglich machen, dass auch jüngere Geschwister eine eigene Vorbereitung und ein eigenes Fest haben konnten. Ab 1986 übernahmen zwei andere Mütter die Begleitung der Kinder. Und die beiden „Neuen“ haben dann bis 2006 alle Gruppen begleitet. 2007 haben dann zwei andere Gemeindemitglieder die Arbeit für ein Jahr weitergeführt.
Und dann saßen wir viele Jahre später noch einmal zusammen, um über die Erfahrungen von damals zu sprechen. Und es wurde der Nachmittag der großen Überraschung! Nun war ich doch während der ganzen Jahre einer der verantwortlichen Leiter der Gemeinde. Natürlich war ich darüber informiert, dass es diese Gruppe gab und in unregelmäßigen Abständen redeten wir im Dienstgespräch auch darüber. Und manchmal markierte ich den Großzügigen. Immer wieder hatten die beiden Begleiterinnen nämlich den Wunsch, zu erzählen, wie sie die Treffen mit den Kindern gestalteten. Dann habe ich ihnen gesagt, ich hätte volles Vertrauen zu ihnen, dass sie das gut und richtig machen würden. Was und wie sie es aber machten, habe ich nie genauer erfahren. Und deshalb war die Überraschung groß, als wir jetzt darüber sprachen. – Hätten wir uns damals getroffen, dann hätte die Begeisterung nicht größer sein können als bei diesem Gespräch – immerhin nach einer Pause von gut 10 Jahren. Im Erzählen wurde alles wieder ganz lebendig. Und die Erinnerungen drängten so intensiv ins Gespräch, dass die Gruppen der Kinder wie in einem Bild vor Augen traten und die Stimmung beim Zusammensein spürbar wurde. Ab und zu musste ich sogar bremsen, weil mir bewusst wurde, wie schwierig all das in einem kurzen Text festzuhalten sei. Und es waren nicht nur die Erinnerungen; auf dem Tisch lag das Programm für die zwölf Stunden des Taufkurses mit einer kurzen Beschreibung jeder einzelnen Stunde!
Dieser Kurs war in einem Punkt anders als die übrigen Aktivitäten der Gemeindekatechese, es gab keinen Begleiter der Begleiter. Sonst haben immer zwei oder drei Leute, die schon Erfahrungen mit der Gruppenarbeit hatten oder theologisch versiert waren, die Treffen für die Begleiter der Gruppen vorbereitet und Thema und Methodik für die nächsten Gruppentreffen erarbeitet. Das war wohl in diesem Fall nicht nötig, weil es ja jedes Jahr nur eine Gruppe der Kinder gab. Die Begleiterinnen der Taufgruppe nahmen zwar an den Treffen des „Arbeitskreis Taufgespräche“ teil (vgl. „Gem. Katechese 4“), arbeiteten im Übrigen aber ganz eigenständig. – Bei der Unterweisung von Kindern lauert immer eine Gefahr. Wenn Katecheten meinen, man wüsste ja Bescheid und könnte das ganz leicht hinkriegen, dann geht es garantiert daneben. Man weiß Bescheid und Herz und Verstand dürfen sich ausruhen. Oder man weiß Bescheid und holt die alten Unterlagen aus dem Regal und braucht gewissermaßen nur noch abzulesen. Wenn aber der Glaube – auch schon bei Kindern – ins Herz gehen soll, dann genügt kein Auswendiglernen und kein Einüben von Ritualen. Dann muss auch die Verkündigung von Herzen kommen und die Botschaft muss mit Verstand und viel Bemühen in die Lebenswelt der Kinder übersetzt werden. In diesem Sinne ist die Aussage zu verstehen, dass die Begleiter der Taufgruppe auf keinen Fall Unterricht machen wollten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren es die Kinder, die sie verlockt haben, sich intensiv um sie zu kümmern. Und das waren nicht die großen Helden und die strahlenden kleinen Schätzchen. Es waren im Normalfall eher die Gebeutelten und Belasteten und Hilfsbedürftigen. Denn die Normalen und die körperlich und seelisch Gesunden waren schon als Kleinkinder getauft worden. Und diese Verspäteten brauchten deswegen besondere Zuwendung. – Und eine solche Haltung hat offensichtlich die Atmosphäre in der Gruppe immer geprägt. Die Kinder fühlten sich angenommen, denn sie waren alle ganz regelmäßig (und durch die ganzen Jahre hindurch) zum Gruppentreffen anwesend. Da gab es für sie nichts Wichtigeres, das sie der Taufgruppe vorgezogen hätten. Und damit die Eltern sich keine Sorge zu machen brauchten – im Herbst wurde es meist schon dunkel, ehe die Gruppe zu Ende war – wurden die Kinder nach dem Treffen von den Begleiterinnen einzeln nach Hause gebracht und an der Haustür abgesetzt. Offensichtlich war auch die Beteiligung der Eltern recht positiv. Vielfach sind sie ja auf Anhieb gar nicht so willkommen, wenn sie kurz vor der Erstkommunion wieder auftauchen, nachdem sie den normalen Termin für die Taufe verpasst haben. Aber beim Elternabend erzählten sie dann, wie groß die Not mit einer langwierigen Krankheit und Schwäche des Kindes war oder wie sehr ihnen familiäre und soziale Schwierigkeiten zugesetzt haben. Und der Verdacht, alles sei nur eine Sache von Gleichgültigkeit gewesen, erweist sich dann als billiges Vorurteil. Und dann kann es sein, dass man für diese Eltern viel Verständnis und für diese Kinder eine besondere Zuneigung entwickelt.
Wenn sie keinen Unterricht machen wollten, wie haben die Begleiterinnen denn dann mit den Kindern gearbeitet? In der Firmvorbereitung war es ganz klar, dass man Jugendlichen nicht beim Gruppentreffen mit einem Vortrag kommen darf, selbst dann nicht, wenn sie anschließend darüber miteinander sprechen dürfen. Es muss vielmehr darum gehen, dass die Jugendlichen ihre Vorstellungen, ihre Hoffnungen und Schwierigkeiten, ihren Glauben und ihre Zweifel äußern dürfen. Das ist die Basis für das weiterführende Gespräch (vgl. Nr.59). Und genau so haben die Begleiterinnen auch mit den Kindern gearbeitet. Natürlich sieht das bei Kindern im Grundschulalter anders aus als bei Jugendlichen. Aber es scheint auch da eine Form des Gesprächs gewesen zu sein. Wenn Kinder spüren, dass sie ernst genommen werden, und wenn die Erwachsenen ein wirkliches Interesse an ihrem Leben haben, dann können die meisten vermutlich schnell sehr vertrauensvoll und frei erzählen. Und dann wird im Erzählen ihr Leben gegenwärtig, ihre Familien und ihre Freunde, ihre Belastungen und ihre Erfolge, ihre Überzeugungen und ihre Unsicherheiten. Und in dieses Leben hinein muss die Botschaft des Evangeliums, die ja zunächst eine Botschaft an Erwachsene ist, übersetzt werden. Dafür gab es ein ausführliches Programm. Der Überschrift für die ganze Arbeit lautete: „Du bist Gottes geliebtes Kind.“ Ein solcher Zielsatz gibt die Möglichkeit, sich auf dem Weg durch den ganzen Kurs immer wieder zu vergewissern, ob die Richtung noch stimmt. Die Formulierungen für die zwölf Stunden waren oft erfrischend anders als das, was in früheren Zeiten im Katechismus stand. Und wer noch eine Erinnerung an den alten Katechismus hat, dürfte überzeugt sein, dass heute den Kindern (wenn auch nicht immer) der Weg zum Glauben besser geebnet wird! – Damit das Gespräch mit den Kindern gelingt, kann man viele Hilfsmittel nutzen. Die Begleiterinnen erzählten ein Beispiel. Bei einem Treffen hatten sie ein großes Bild mit einem Herzen mitgebracht. Es ist wohl auf Anhieb klar, wie viel Kindern dazu einfallen kann. Und das wurde auf kleine Zettel geschrieben und auf das Bild geheftet. Und so wurde sichtbar, wie schön das Zusammenleben sein kann, wenn es von Vertrauen und Liebe geprägt ist. Und hinter all den menschlichen Bemühungen um eine solche Gemeinschaft kann man den finden, der hilft und stärkt und tröstet. Und deshalb kam in die Mitte ein Zettel mit dem Namen „Gott“. – In einer anderen Stunde erzählten sie die Geschichte vom barmherzigen Vater. Das ist die Botschaft von der Güte Gottes. Und sie ist eingebettet in ein Bild von familiären Beziehungen. Und beim Hören und darüber Sprechen wird die eigene Familie mit ihren Höhen und Tiefen für die Kinder ganz nah gewesen sein. – Es geht um das Leben der Kinder und für ihr Leben hören sie die Botschaft von der heilenden und befreienden Nähe Gottes.
Diese Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Und wenn man sie gut oder vielleicht sogar sehr gut leisten will, dann braucht man viele Anregungen. Darum haben sich die Begleiterinnen intensiv bemüht – und wieder sehr eigenständig. Besonders wichtig war dabei der Kontakt zum Katechetischen Institut des Bistums Aachen. Das bietet vor allem Aus- und Weiterbildung für Religionslehrer an. Wenn man zum Beispiel die „missio canonica“, die kirchliche Lehrerlaubnis für den Religionsunterricht, haben will, dann kann man dort die nötige Ausbildung bekommen. Aber auch für die normale Weiterbildung von Religionslehrern ist das Institut zuständig. Und wen wundert es, dass die beiden Begleiterinnen in diesem Kreis immer wieder Erstaunen auslösten. „Wie, Sie sind keine Religionslehrer? Ganz einfache Laien in der Arbeit der Gemeinde?“ Besonders von Rainer Oberthür sprachen die beiden mit großer Hochachtung. Er ist Referent im Institut, offensichtlich aber auch eine sehr kreative Persönlichkeit. Seine Texte und Geschichten waren für die Arbeit in der Gruppe sehr wertvoll. Und immer wieder holten sich die beiden in Aachen neue Kraft und neuen Stoff.
Der Kurs zur Vorbereitung auf die Taufe umfasste 12 Stunden und fand zwischen September und Weihnachten statt. Er war also genau so umfangreich wie die Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Buße. Auch die Größe der Gruppe entsprach im Normalfall dem, was bei diesen beiden Aktivitäten auch üblich war. In einem Jahr waren nur drei Kinder angemeldet. Aber auch mit diesen wenigen fand die Vorbereitung statt. Üblicherweise schwankte die Zahl zwischen fünf und zwölf. In den mehr als 20 Jahren zwischen 1984 und 2007 haben weit über 100 Kinder diese besondere Zuwendung erfahren. Für die Jahre 1996 bis 2006 sind die Listen mit den Anmeldungen noch vorhanden; in diesem Zeitraum waren nachweislich 85 Kinder dabei. Was für ein Aufwand und was für ein großartiges Bemühen! Wenn die Beiden bei den Treffen in Aachen davon erzählten, hörten sie von dem einen oder anderen Seelsorger die übliche Antwort, das sei in ihrer Pfarrei nicht möglich, dafür würden sie keine Leute finden. Und wie kommt es, dass in dieser Taufgruppe für Schulkinder zwei Frauen über zwanzig Jahre intensiv mit Herz und Verstand und unheimlich viel Einsatz arbeiten und hinterher noch sagen, es sei für sie selbst sehr wertvoll gewesen? Und wie kommt es, dass Firmbegleiter zwar auch immer wieder über den hohen Zeitaufwand stöhnen, aber bei der Auswertung am Ende des Kurses gleichfalls sagen, es habe sich für sie gelohnt? Und die anderen Aktivitäten der Gemeinde in Hochdahl! Dazu zitierte eine der beiden Damen von der Taufgruppe unseren Spruch (den Spruch der Gemeindeleiter): „Mach das! Du kannst das!“ Oder dasselbe, etwas anders formuliert: „1. Ich traue dir zu, dass du das schaffst, und 2. Alles, was du dazu brauchst, werden wir gemeinsam erarbeiten.“ (vgl. „Eine Gemeinde traut sich“). Erfahrungen, um für den Rest des Lebens dankbar zu sein! – Gab es in Hochdahl vielleicht auch einen Zaubertrank, der uns stark und mutig machte?
Einige Zeit vor der Taufe gab es einen Wortgottesdienst für die Kinder, die Eltern und die Begleiter. Das Thema war: das Kreuz, das Zeichen der Christen. Alle versammelten sich in Heilig Geist um den Altar. Kleine Kreuze waren für die Kinder vorbereitet. In den ersten Jahren stammten sie oft aus dem Heiligen Land, Kreuze aus Olivenholz. Das war eine schlichte, symbolische Verbindung zum Ursprung der Kreuzverehrung. Die Geschichte der Kreuzigung wurde nicht erzählt. Aber wenn das Kreuz das Zeichen der Christen ist, dann gehören die Kinder der Taufgruppe auch dazu, wenn sie das Kreuz empfangen. Es war natürlich besonders schön, wenn die Eltern ihnen dann das Kreuz umhängten und ihnen auch noch ein Kreuz auf die Stirn zeichneten. Dieser Ablauf war ein intensiver Hinweis auf die Taufe: bald werden sie wirklich ganz dazugehören!
Nur einmal in all den Jahren war ein kleiner Junge immer ganz allein, selbst bei der Taufe. Hoffentlich war die Taufe trotzdem für ihn ein gutes Erlebnis! Sonst waren natürlich immer alle eingeladen und dabei: Eltern, Paten, Geschwister, Bekannte, die Begleiterinnen. Und immer war die Feier in Heilig Geist in Sandheide. Es muss ein sehr schöner Augenblick gewesen sein, wenn die Kinder nach Beginn des Gottesdienstes einzeln gefragt wurden, ob sie getauft werden wollten. Dazu stand der Geistliche, der die Taufe vollzog, vor dem Altar, rief die Kinder einzeln auf und bat sie, ein paar Schritte nach vorne zu kommen .Dann fragte er sie: „Willst du getauft werden?“ und sie antworteten: „Ja, ich will getauft werden.“ – Es ist schade, dass diese Frage nach der eigenen Entscheidung so selten vorkommt. Anscheinend nur in einer solchen Situation! Denn diese Entscheidung ist doch die Voraussetzung dafür, dass einer in der Taufe die Zuwendung Gottes erfahren kann. Und dann wieder das Kreuzzeichen auf die Stirn und die Handauflegung als Zeichen des Segens. Und dann an dem schönen Taufbrunnen in Heilig Geist mit seinem fließenden Wasser – die Taufe mit viel Wasser (wie die Begleiterin erzählt). Und dann viel Licht! Von der Osterkerze verbreitet es sich auf die Taufkerzen der Kinder, die kleinen Kerzen der Geschwister und sonstigen Kinder. Und nach einer langen und intensiven Zeit der Vorbereitung gehören nun die Kinder der Taufgruppe auch ganz dazu. – Die Hochstimmung der Tauffeier setzte sich fort in einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Pfarrsaal. Die Vorbereitung dafür haben immer die Eltern der Kinder übernommen. Und das haben sie vermutlich auch sehr gerne getan.
62. Die Hospizidee und wie sie in Hochdahl Fuß fasste
Anfang 1988; eine kleine Notiz in einer Wochenzeitschrift macht mich auf das Hospiz in Recklinghausen aufmerksam. Die Notiz weckt in mir Erinnerungen und Bilder: Anfang der achtziger Jahre habe ich im Religionsunterricht am Hochdahler Gymnasium „Sterben und Tod“ mit den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe thematisiert. Der Film, den ich zeigte, erzählte die Geschichte einer krebskranken Frau, die mit großer Energie ihr Leben lebte – bis zuletzt.
Ein anderer Film stellt ein Hospiz in England vor. Ich weiß noch, wie die Schüler und ich selbst beeindruckt waren von der Atmosphäre in diesem Haus. – Ich erinnere mich an das Sterben meiner Eltern, beide allein in ihrer letzten Stunde. Und jetzt die Notiz über das Hospiz in Recklinghausen. Und der Gedanke: Wenn in Recklinghausen so etwas geht, vielleicht ist das auch hier in Hochdahl möglich? Ich erzähle meine Gedanken in unserem Seelsorgeteam der Franziskus-Gemeinde- und ich stoße auf Resonanz. Noch vor den Sommerferien fahren wir, Ralf Jachmann, Bernd Staßen, Hildegard Smoch und ich nach Recklinghausen. Und wir sind tief beeindruckt von dem, was wir da hören und sehen.
In Hochdahl erzählen wir davon, im „Haus der Kirchen“, im ökumenischen Konveniat, in der Gemeinde. Erstaunlich, wir stoßen überall auf hellwache Ohren. Viele haben Erfahrung mit dem Sterben von Angehörigen und Freunden gemacht. Sie erkennen, dass es so, wie man es fast überall macht und oft erlebt, nicht wirklich gut ist. – Der Gedanke „Hospiz in Hochdahl“ fällt auf fruchtbaren Boden. Ganz viel gerät in Bewegung.
Im August 1988 bin ich in der Toskana. An einem Tag fahre ich mit dem Zug nach Assisi. – Die Entscheidung für das Recklinghauser Hospiz ist in dieser Stadt gefallen. Plötzlich packt mich, auf dem Marktplatz von Assisi, wieder der Gedanke: ein Hospiz im Sinne des heiligen Franziskus – in Hochdahl! Aber sofort setzen sich Bedenken dagegen: Werden wir denn die Kraft haben, den Gedanken in die Tat umzusetzen?
Im Oktober 1988 verabschieden sich die Arenberger Dominikanerinnen nach 85 Jahren von Hochdahl. Das Kloster „Maria Hilf“ an der Hildener Straße (heute Trills) steht leer. Ob dieses Haus für „unser Hospiz“ geeignet wäre? Im Gespräch mit der Ordensleitung wird mir klar, dass die Schwestern der Idee eher fremd gegenüber stehen. Und: Die Kaufsumme für das Haus könnten wir niemals aufbringen. Bei einem Treffen mit Studienkollegen stoße ich auf den Anfang des Hospizes in Lohmar. Sybille Brombach, die mit ihrem Mann die dortige Arbeit begonnen hat, sagt: „Bei der Begleitung sterbender Menschen sind mir Flügel gewachsen.“
Wir bestehen auf einer ökumenischen Grundlage. „Wohnzimmergespräche“ bei mir: Wie kommen wir an Geld? „Wie kann die Idee Wirklichkeit werden?“
Gespräche mit den Maltesern, mit dem Caritasverband, mit der Diakonie. „Geld? Ja, das wäre schon aufzubringen. Aber eine ökumenische Trägerschaft? Da müssen Sie sich schon entscheiden!“ Auf einer Fahrt in eine Familienfreizeit in Rinsecke im Sauerland kommen mir die Franziskanerinnen von Waldbreitbach in den Sinn. Noch in der Nacht schreibe ich an die Ordensleitung. Und wenige Tage später, am 11. November 1988, die Antwort von Schwester Basina: „Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit der Hospizidee. Wir sind an einer Mitarbeit in Hochdahl interessiert.“
An einem Wochenende danach ist der Pfarrgemeinderat von Hochdahl in Klausur. Das Thema: „Beim Sterben nicht allein sein.“ Wenige Tage später eine offene Einladung in den Pfarrsaal von Heilig Geist: Rund 100 Menschen sind da, evangelische und katholische Christen, aber auch viele andere, die der Kirche eher fern stehen. Ralf Jachmann führt uns an das Thema heran. Viele erzählen sehr persönlich von ihren Erfahrungen mit Sterben und Tod. Die Idee fasst Fuß.
Am 9. Januar, kurz nach 13Uhr ruft Schwester Emmanuela aus Waldbreitbach an: „Wir machen mit!“ Ist das der Durchbruch?
„Ein Verein muss gegründet werden. Auf breiter, ökumenischer Basis!“ – Am 27. Januar 1989 ist es soweit: Mehr als 140 Leute sind da, 114 von ihnen werden Mitglieder des Franziskus-Hospiz-Vereins.
Wir bieten einen Kurs in häuslicher Krankenpflege an. Menschen bereiten sich vor, am Kranken-, vielleicht am Sterbebett „Sitzwache“ zu halten. Eine Gruppe kümmert sich um die Finanzen. Andere übernehmen die Schreibarbeit, ein großer Stamm von Ehrenamtlichen kommt zusammen.
Ende 1989 findet das erste „Sterbe-Seminar“ in Langwaden statt. Die Teilnehmer gewinnen Mut, weiterzugehen und andere auf dem Weg mitzunehmen.
Aber es gibt auch Gegenwind, manchmal heftig und schmerzhaft. Immer, wenn wir ein Privathaus erwerben wollen, entstehen erregte Diskussionen in der Stadt, unter den Anwohnern. „Die Idee ist ja gut. Aber doch bitte nicht in unserer Nähe!“ Unterschriften dagegen werden gesammelt, Leserbriefe geschrieben, die Presse, das Fernsehen eingeschaltet.
Doch der Gegenwind verstärkt auch unser Engagement. Die Zahl der Vereinsmitglieder steigt kontinuierlich. Und am 20. Oktober 1989 ziehen vier Franziskanerinnen ein in die Sandheider Straße 36. Sie lassen sich auf die Idee ein, ohne schon genau zu wissen, wie es gehen, ob es auch gelingen wird. Sie tragen mit uns das Risiko.
Anfang 1990 nimmt der „Hausbetreuungsdienst“ seine Arbeit auf. Grund- und Aufbaukurse werden durchgeführt. Viele üben sich ein ins Leben und ins Sterben.
Aber auch Ängste kommen auf: Wird der Bau eines stationären Hospizes nicht doch unsere Kräfte übersteigen? Wird die „Institutionalisierung“ nicht unsere Idee „verderben“? Auch die Schwestern sind verunsichert. Es gibt eine stürmische Mitgliederversammlung. Zwei Vorstandsmitglieder treten zurück. Dringend werden die Schwestern gebeten, doch weiter mitzumachen. Unsere ökumenische Ausrichtung bleibt garantiert.
Auch in Zukunft soll und muss die Begleitung der Schwerstkranken zu Hause das Wichtigste sein. Das Haus, das jetzt gebaut werden soll, ist ein Angebot für die, die allein sind, die zu Hause nicht mehr angemessen versorgt werden können. Im August 1991 können wir das Grundstück am Bayerpark in Trills kaufen. Damit hat die Bewegung auch einen „Boden“ unter den Füßen. Er bleibt schwankend und erweist sich doch als tragfähig.
Ende 1990 wird dann der Kooperationsvertrag zwischen dem Franziskus-Hospiz-Verein e.V. und den Waldbreitbacher Franziskanerinnen verabschiedet, im Februar 1991 ein neuer Vorstand des Vereins gewählt. Die Ökumene wird gefestigt durch je ein Mitglied der katholischen und der evangelischen Gemeinde im Vorstand des Vereins.
Die Hochdahler Architekten Franz Josef Klother und Friedhelm Sieben werden mit der Planung des Baus beauftragt. Zusammen mit der Geschäftsführerin Schwester Irmgardis und Mitarbeitern entwickeln sie die Gestaltung und Einrichtung des Hauses. Ralf Jachmann und Christoph Bremekamp laden Interessierte zu den ersten Grund- und Aufbauseminaren ein. Der 1. Hochdahler Hospiztag trägt die Idee weiter in eine breite Öffentlichkeit. 1992 betreuen schon die ersten „Ehrenamtlichen“ zusammen mit einigen „Hauptamtlichen“ Schwerstkranke und Sterbende in deren Wohnungen.
Endlich: Im Februar 1992 wird der Bau des Hospizes dann genehmigt.
Als Bundesmodellprojekt wird er durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Minister Norbert Blüm, finanziell großzügig gefördert, so wie auch die zur gleichen Zeit entstehenden Hospize in Halle und Lohmar. Am 15. Dezember 1992, der erste Spatenstich. Am 25. Juni 1993 die Grundsteinlegung durch Minister Norbert Blüm.
Die Hospiztage und die Hospizgespräche erreichen immer mehr Interessierte aus Hochdahl und Umgebung. 1994 sind schon 94 „Ehrenamtliche“ in den verschiedenen Bereichen der Hospizarbeit tätig: Telefonkette, Tageshospiz, Öffentlichkeitsarbeit, Baukomitee. Eine ungeheure Bewegung!
Am 17. März 1994 dann das Richtfest.
Am 26. November 1994 kommen in der Erkrather Stadthalle mehr als 500 Menschen zusammen unter dem Leitwort: „Nicht auszuhalten – dem Schmerz begegnen“. Schwester Liliane Juchli aus der Schweiz hält einen bewegenden Vortrag über die ganzheitliche Begleitung Schwerstkranker und Otto Zsok aus Fürstenfeldbruck spricht über den Schmerz und seinen Sinn.
Am 9. Mai 1995 wird das Franziskus-Hospiz-Zentrum eröffnet.
Da ging etwas in Erfüllung, was jahrelang viel Kraft und Anstrengung gekostet hatte.
Bis zum Vorabend hatte kaum jemand damit gerechnet, dass die Arbeiten im Haus rechtzeitig geschafft würden. Aber: es gelang! Über Nacht!
Die Franziskuskirche Trills war voll, als die Feier eröffnet wurde. Pfarrer Heinrich Pera aus Halle sagte einen Satz, der sich eingegraben hat: „Träume werden wahr, wenn Mensch und Gottes Herz sich begegnen“. Schwester Liliane Juchli aus der Schweiz hielt den Festvortrag. „Dem Sterben ein Zuhause geben“. Ich erinnere mich, dass ihre Gedanken immer wieder um den Mittelpunkt des neuen Hospizes kreisten, um den Innenhof mit seinem Brunnen, mit dem lebendigen Wasser, das sich in alle vier Himmelsrichtungen verströmt, Wasser des Heils, für alle, die damit in Berührung kommen. Besonders bewegt hat mich in dieser Feier, was eine Patientin aus Wülfrath, im Rollstuhl sitzend, gezeichnet von ihrer tödlichen Krankheit, in das Mikrophon sprach: wie sie durch die Hospiz-Begleitung es geschafft hat, ihr Sterben als Teil des Lebens anzunehmen.
Nach der Feier in der Kirche strömten wir in das neue Haus, füllten den Innenhof, rund um den Brunnen. Mit einer Lesung aus dem Propheten Ezechiel (Kap. 47 in einer Nachdichtung von Wilhelm Willms) und dem Wasser des Brunnens durfte ich mit Pfarrer Müller aus der evangelischen Gemeinde den Segen Gottes zusichern, dem Haus, den Menschen, die dort leben und wirken, den vielen, die die Idee und die Arbeit des Franziskus-Hospizes mittragen.
Für viele Besucher war das der erste Blick in das neue Haus. Und das Erstaunen war groß: „Schön! Ein Hauch von Luxus – die Zimmer, die Ausstattung, der Innenhof!“ Zu schön? Zu kostbar? 1443 entstand in Beaune/Burgund ein Hospiz, „Hótel Dieu“, Haus Gottes, genannt; ein „Palast für die Armen“, sagten die Leute über das für die damaligen Verhältnisse überaus luxuriöse Haus. Ich bin froh, dass das Franziskus-Hospiz so ist, wie es ist. Eine Bewohnerin, die ich dort kennen lernte, sagte mir: „ Ich bin jetzt sieben Tage hier und es waren sieben Sonntage!“
Sterben ist ein Teil des Lebens – viele haben das in den Jahren ver-inner-licht. Das Hospiz brachte einen Umbruch im Denken und Fühlen vieler Menschen. Es ist so zu einem „Stein des An-Stoßes“ geworden.
Nichts ist realistischer als eine starke Vision!
Gerd Verhoeven
63. Wochenenden nach der Firmung
Wenn die Gruppen in der Firmvorbereitung gut gelaufen waren, dann tauchte gegen Ende – unmittelbar vor oder nach der Firmung – häufig die Frage auf, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Gruppe fortzusetzen. Ein solcher Wunsch war ein Zeichen, dass sich in dem halben Jahr regelmäßiger Treffen ein deutliches Gemeinschaftsgefühl entwickelt hatte. Vielleicht war auch dem einen oder anderen klar geworden, dass es sich lohnen könnte, weiter über „Gott und die Welt“ nachzudenken. Dafür war die Firmgruppe nämlich die einzige Möglichkeit, wie die Jugendlichen auf vielfältige Nachfrage selber immer wieder bestätigten. Und so sind viele Gruppen nach der Firmung in unterschiedlicher Form und unterschiedlich lange weitergeführt worden.
Die „Wochenenden nach der Firmung“, die es zwischen 1990 und 2000 gegeben hat, scheinen mit einem anderen Hintergrund entstanden zu sein. Die jungen Leute und die Erwachsenen, die bei diesen Wochenenden dabei waren, hatten alle ihre Erfahrungen in der Firmvorbereitung gemacht. Aber für manche lag diese Zeit schon länger zurück. Deswegen ging es wohl auch nicht mehr darum, etwas Schönes festzuhalten, wie bei den anderen Gruppen. Es war wohl ein etwas abgeklärteres Verständnis vom Wert und der Bedeutung dessen, was sie in den Firmgruppen erfahren hatten.
Wie es konkret angefangen hat, erzählt Jörg Burkhard in den „Aspekten“ vom Dezember 1990. Wieder überlegte man in einer Gruppe am Ende der Firmvorbereitung, wie es weitergehen könnte. Drei Wünsche hatten die Teilnehmer: „regelmäßige Jugendmessen, ab und zu eine Fete bei Klönen und Musik und noch einmal so ein Wochenende – ähnlich wie in Rinsecke.“ – Und dann berichtet er von dem ersten derartigen „Wochenende nach der Firmung“ im Herbst 1990.
In der Folgezeit gab es normalerweise in jedem Jahr zwei solche Wochenenden, eins im Frühjahr und eins im Herbst. Rund 30 Jugendliche nahmen teil, mal mehr, mal weniger. Der äußere Rahmen war stabil: in den meisten Fällen fanden die Treffen in Rinsecke statt, freitags um 17,30 Uhr ging es mit dem Bus vom Parkplatz an der Schule los, und wenn es ohne die üblichen Staus abging, konnte abends noch ein normales Programm mit Abendessen, Aufwärmphase und Einführung in die geplante Thematik stattfinden. Ein Artikel in den Aspekten vom September 1996 berichtet über die Planung und Durchführung der Wochenenden. Dort sind auch die Themen der ersten Jahre aufgelistet. Elfmal hatten die Treffen bis dahin stattgefunden und dies waren die Themen: Herbst 1990: „Das Allerzärtlichste überwindet das Allerhärteste!“ Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit der Schöpfung um? – Juni 1991: „Immer wieder anfangen! Sich nicht entmutigen lassen!“ – Herbst 1991: „Wir haben einen Traum!“ Darf/kann ich heute noch Träume haben? Was mache ich mit meinen Träumen? – Herbst 1992: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ oder „Jeder ist sich selbst der Nächste“ – März 1993: „Freundschaft/Partnerschaft“ – Herbst 1993: „Konflikte! Was machen Konflikte mit mir? Wie konfliktfreudig bin ich eigentlich? Konflikte von der Wiege bis zur Bahre! Wie gehe ich mit Konflikten um? – März 1994: „Über den eigenen Schatten springen!“ Mir selbst näher kommen, mich neu kennenlernen, anderen begegnen, etwas Neues ausprobieren. – Herbst 1994: „Ein sinnvolles Wochenende mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und …!“ – Februar 1995: „Ich als Christ im Alltag! Zwischen Heiligenschein und Ellbogenmentalität“ – Herbst 1995: „Ich bin was wert! Jeder Mensch ist ein König!“ – März 1996: „Mein Lebensweg mit Kompass und Karte oder ein Zufallsspaziergang?“
Diese Zusammenstellung lässt erkennen, wie vielfältig die Themen waren, vor allem im Unterschied zu der Abfolge im Firmkurs, die ja deutlicher und zielstrebiger auf Glaube, Kirche und Sakrament der Firmung ausgerichtet war. Das rührte auch daher, dass für die Vorbereitung der Wochenenden immer eine Gruppe von Jugendlichen und Begleitern zuständig war, die die Auswahl vornahm und die Durchführung plante. Die Wochenenden waren dadurch nah am Leben und den Interessen und den Fragestellungen der Jugendlichen. Deshalb verwundert es auch nicht, dass eine Reihe von Teilnehmern öfter bis fast regelmäßig dabei waren. Ihr Interesse war wach geworden und sie hatten erkannt, wo sie ihren Wissensdurst stillen konnten – oder: sie hatten eine Chance entdeckt, wo sie weiterhin über „Gott und die Welt“ nachdenken und sprechen konnten.
Ein Ehepaar mit viel Erfahrung in der Gemeindekatechese und in Führungspositionen der Gemeinde hat die ganzen Jahre diese Aktivität in der Spur gehalten. Von Beginn an war auch Ralf Jachmann dabei, der zu der Zeit schon als Leiter im Hospiz tätig war. Mit seiner theologischen Kompetenz und seiner unnachahmlichen Art, ein Bibliodrama zu gestalten, hat er immer wieder die Teilnehmer tief berührt und ihnen wertvolle Erfahrungen vermittelt. Und selbst als er bei einem Wochenende kurz vor Beginn absagen musste, hatte das eine positive Folge. Die Begleiterin, die seinen Part übernehmen sollte, fühlte sich zwar zunächst heftig überfordert. Aber nach dem ersten Schreck und in Anbetracht der Notwendigkeit stellte sie sich der unerwarteten Aufgabe und siehe da: es ging. – Eine solche Aktivität über mehrere Jahre zu begleiten, kann zu einer deutlichen Belastung werden. So lag es nahe, dass 1997 ein jüngeres Gemeindemitglied die Leitung der Wochenenden übernahm. Leider konnte er sich nicht sehr lange an dieser Tätigkeit erfreuen. Das Haus in Rinsecke wurde im Jahr 2000 geschlossen. Und das hatte zur Folge, dass auch die „Wochenenden nach der Firmung“ nicht weitergeführt wurden.
Die Gestaltung der Tage in Rinsecke war nah bei den Jugendlichen und ihrem normalen Leben. Es ging ja nicht um eine Bildungsveranstaltung oder ein Seminar zur Wissensvermittlung. Und zu der Zeit wurde das Verhalten von jungen Leuten auch noch nicht von „Klicken“ und „Wischen“ geprägt. Angestrebt wurde eine „gute Mischung aus sich wohl fühlen, Gemeinschaft erleben, Spaß haben und über ein gemeinsames Thema nachdenken“ (Aspekte September 96). Und der Ablauf wird im gleichen Artikel so geschildert: „Der Freitagabend dient dazu, sich kennenzulernen, sich ans Thema heranzuschleichen und Spaß zu haben. Nach einer mehr oder weniger langen Nacht gibt es ein ausgedehntes Frühstück mit frischen Rinsecke-Brötchen, Tee, Kaffee, Milch usw. Neben Möglichkeiten zum Bewegen in der sauerländischen Luft, Tischtennisspielen, gemeinsamem Kochen und Spülen, gibt es samstags und sonntags 3 Themenrunden und einen Wortgottesdienst, die durch eine Vorbereitungsgruppe abwechslungsreich gestaltet werden. Neben dem Diskutieren werden dabei alle Sinne angesprochen: Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen. Samstagabend gibt es immer einen Spiel-Abend, der bunt, laut, lebhaft ist und erst lange nach Mitternacht endet. Ein Fässchen Bier (natürlich steht auch ausreichend Saft und Mineralwasser zur Verfügung) löscht den entstandenen Durst.“ Wenn man diese Beschreibung liest, kann einen auch nach so vielen Jahren noch der Wunsch ankommen, damals dabei gewesen zu sein!
Der Blick auf die Wochenenden nach der Firmung kann auch für heute noch hoffnungsvoll stimmen. Scheint sich doch da eine typische Abfolge im Glaubensprozess zu zeigen. Zunächst muss man irgendwie „auf den Geschmack kommen“. Anscheinend geschah das immer wieder in den Gruppen der Firmvorbereitung. Und einige Jugendliche und Erwachsene sind dabei so „angesprungen“, dass sie sich selbst für die Fortsetzung der Treffen und Gespräche einsetzten. Das ist bemerkenswert, denn normalerweise ist es in der Kirche üblich, dass sich die Hauptberuflichen etwas einfallen lassen und dann viel Reklame machen, um die Veranstaltung voll zu bekommen. Die Wochenenden nach der Firmung sind natürlich auch in den Mitteilungen an die Gemeinde vorgestellt worden, aber wichtig waren vor allem die persönlichen Kontakte und das eigene Interesse der Teilnehmer. Mündige Christen, die sich selbst um ihren Glauben kümmern, gibt es also nicht nur in der Theorie! – Die brauchen dann aber auch die Möglichkeit, sich irgendwann und irgendwo zu treffen. Sie brauchen den „Raum“ der Gemeinde. Damit ist nicht nur der Ort gemeint, sondern vor allem die Möglichkeit einer dauerhaften und tragfähigen Gemeinschaft. Soll der Glaube wachsen und nicht bald wieder verkümmern, scheint eine dauernde Zugehörigkeit zu einer lebendigen Gemeinde nötig zu sein. Das haben die Wochenenden wahrscheinlich nur ansatzweise bieten können. Denn viele der Teilnehmer lebten inzwischen nicht mehr in Hochdahl und waren deshalb zwischen den Treffen vermutlich auf sich allein gestellt. Und als es im Jahr 2000 nicht mehr weiterging, hörte diese Möglichkeit von Gemeinschaft auf. Da ging dann wohl jeder dahin, wo er inzwischen lebte und arbeitete. Dass er dort die tragende Gemeinschaft fand, ist nicht sicher. Es gibt also neben der hoffnungsvollen Perspektive auch eine bittere Frage bei der Betrachtung der Wochenenden nach der Firmung: hat der mündige Christ eine Chance, die lebendige und vertrauensvolle Gemeinde zu finden, in und mit der er seinen Glauben leben kann? Leider sind die Unbeweglichkeit und die Berufung auf das Hergebrachte in vielen Gemeinden die Norm. Und diese Mentalität hilft nicht.
Eine flächendeckende Versorgung kann die Kirche in Deutschland schon lange nicht mehr leisten. Wenn man dem Glauben ein neues Fundament geben will, muss man es vielleicht nach dem Muster der „Wochenenden nach der Firmung“ versuchen. Leute, die auf den Geschmack gekommen und angesprungen sind, werden eigenständig und suchen nach Wegen und Möglichkeiten, ihren Glauben zu entwickeln und zu leben. Im „Zeugnis des Glaubens“ stärken und ermutigen sie sich gegenseitig. Wenn sie dazu eine tragfähige und dauerhafte Gemeinschaft finden und gestalten, entsteht Kirche neu.
64. Gemeindekatechese, ein Weg zur Erkenntnis
Der Begriff „Gemeindekatechese“ kommt wahrscheinlich in den bisherigen Erzählungen am häufigsten vor. Und das, was damit gemeint ist, hat die Hochdahler Gemeinde zwischen 1973 und 2007 am intensivsten geprägt. Vieles, was wir getan haben – bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion, beim Glaubenskurs zur Firmung, beim Arbeitskreis Taufgespräche, beim Tauf-Kurs für Schulkinder, bei den Wochenenden nach der Firmung – stand vermutlich mit Recht unter dieser Überschrift. Wir hatten aber während der ganzen Zeit keine theoretische Beschreibung, was unter „Gemeindekatechese“ genau zu verstehen ist. Dann wurde beim Erzählen der Erinnerungen das Bedürfnis immer stärker, eine solche Beschreibung zu versuchen. Das folgende Ergebnis dieser Bemühungen setzt nun die Erfahrungen aus der Praxis voraus, ist aber in der Form ein theoretischer Entwurf, der in gewissem Maß sogar den Anspruch erhebt, so könne ein gemeinsamer Weg einer Gemeinde zur Erkenntnis aussehen. (Vgl. zum gesamten Text: Nr.14 Personale Begegnung.)
„Gemeindekatechese“ ist der Titel für einen Lernprozess, zu dem eine christliche Gemeinde ermutigt und befähigt werden sollte. Er setzt die Theologie des Volkes Gottes voraus, die auf dem Konzil wiederentdeckt wurde. Deswegen wird er hier auch – wie das Wort „Gemeinde“ nahelegt – in erster Linie als typisch für eine christliche Gemeinde angenommen. Wahrscheinlich ist er aber auch ein Weg für Gruppen, die in ähnlicher Weise ein tragfähiges gemeinsames Fundament haben. – Er unterscheidet sich sehr deutlich von anderen Formen des Lernens. Er hat nicht die Form von „Unterricht“. Die Gemeindekatechese trat in Hochdahl 1973 an die Stelle des bis dahin üblichen „Kommunionunterrichts“. (vgl.Nr.16). Seitdem geht es nicht mehr in erster Linie um die Vermittlung von Wissensstoff an die Kinder. Auch ist nicht nur einer der Lehrer; weil er eben alles weiß, was zu vermitteln ist. Und die Kinder sollen nicht mehr nur lernen, weil sie noch unwissend sind. Sondern sie sind Lernende und Lehrende, weil sie schon Erkenntnisse haben, wenn sie auch noch so anfänglich und unentwickelt sind. Bei der Arbeit mit Jugendlichen sollte dieser Aspekt sehr ernst genommen werden (vgl.Nr.59). – Der Titel „Gemeindekatechese“ ist auf diesem Hintergrund nicht günstig. Denn Katecheten werden immer wieder als Lehrer angesehen und Katechese ist im Normalfall eine Form von Unterricht. Wenn Gemeindekatechese so missverstanden wird, dann bleibt von ihr nur übrig, dass Gemeindemitglieder (Eltern) eben „Katecheten“ sind.
Der Lernprozess vollzieht sich im Gespräch. In einer christlichen Gemeinde ist das Ziel des Gesprächs die Erkenntnis oder das Kennenlernen dessen, was die Botschaft des Evangeliums bedeutet. Wenn eine Gruppe von Glaubenden und Getauften versammelt ist, kann ich davon ausgehen, dass den Teilnehmern der Geist Jesu gegeben ist. Dann ist nicht nur einer der Wissende und alle anderen Lernende, sondern alle sind gleichzeitig Lernende und Lehrende. Und dabei ist es auch gestattet, dass die verschiedenen Personen ihren Glauben in unterschiedlichem Maß aktualisieren und formulieren können. Im Gespräch stellt jeder seine bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse in den Dienst der anderen, damit in der Gruppe der Glaube wächst. Diese Beschreibung ist natürlich eine theologische und kann nur für jemanden verbindlich sein, der bereit ist zu glauben. Eine ähnliche Beschreibung für einen Prozess in einer Gruppe findet sich schon in dem Text „Suchen und Fragen“(Nr.12).
Der Inhalt des Gesprächs ist nicht die offizielle Lehre der Kirche oder das, was im Katechismus steht. Denn da handelt es sich um den Versuch, das Glaubenswissen in seinem ganzen Umfang zu beschreiben. Die Teilnehmer des Gesprächs dagegen befinden sich an einem bestimmten Punkt ihres Lebens und sie sind unterwegs auf dem Weg des Glaubens. Und deshalb können sie sich nur austauschen über das, was ihnen bis jetzt klar geworden ist. Was dabei zur Sprache kommt, wird sehr vielfältig sein. Denn der Glaubensweg und die erreichte Glaubenserkenntnis werden bei jedem Teilnehmer anders sein. Oft spielt dabei die konkrete Lebenssituation der Beteiligten eine Rolle. So drehten sich in den Ehekreisen viele Gespräche um die Erziehung der Kinder, aber auch um die neuen Formen christlichen Lebens nach den Veränderungen durch das Konzil (Vgl.Nr.5). Jeder Teilnehmer ist aber auch geprägt von der Erziehung, dem Umfeld in der Kindheit und Jugend, oder auch durch die Begegnung mit bestimmten Menschen, zum Beispiel Lehrern oder Vorbildern. Und selbst die Veranlagung spielt dabei mit. Ein lebendiger Austausch kann dazu führen, dass in dem Gespräch eine große Weite und Vielfalt sichtbar wird. Und vielleicht fühlt sich die Gruppe hin und wieder sogar veranlasst, über die Fülle des Lebens und des Glaubens zu staunen.
Der Ausgangspunkt des Gesprächs ist eine veränderte Blickrichtung der Gruppe. Beim Unterricht geht es um einen bestimmten Stoff, den man sich ansehen und mit dem man sich vertraut machen muss. Man braucht den Lehrer, der den Stoff schon kennt und der einem den Zugang eröffnet. Man muss sich den Stoff aneignen. Vielleicht muss man ihn auch auswendig wiedergeben können. Der Gegenstand im Gespräch der Gemeindekatechese ist eine persönliche Befindlichkeit der Teilnehmer. Und die kommt nur dadurch ins Gespräch, dass jeder Teilnehmer diese seine persönliche Glaubenssituation den andern offenbart. Und das muss mit Vertrauen und ohne Aufdringlichkeit geschehen. – Wie das in der Praxis geschehen kann, soll an der Arbeit mit den Begleitern der Erstkommunion erläutert werden. Das Gespräch in der Gruppe muss mit dem ersten Treffen der Begleiter beginnen. Eine Zusammenstellung der Themen, die in der Vorbereitungszeit anstehen, sollte der Leiter der Gruppe den Teilnehmern vor Beginn zuschicken, damit die Begleiter sich vorher damit vertraut machen können. Das Gespräch muss damit beginnen, dass die Teilnehmer gefragt werden oder sagen können, welche innere Einstellung, welche Neugier oder Angst sie in Bezug auf die verschiedenen Themen haben. Der Lernprozess beginnt also mit der Frage des Einzelnen, wie er zu den unterschiedlichen Themen innerlich steht. Wenn es schon möglich ist, sollte jeder auch einige Sätze zur Begründung oder Erklärung sagen. Das kann der Ausgangspunkt für das Gespräch sein und es dient gleichzeitig dem Ziel, dass die Begleiter miteinander bekannt und vertraut werden. Eine vertrauensvolle Atmosphäre ist für das Gespräch und für den gewünschten gemeinsamen Erkenntnisprozess unbedingt notwendig. Vielleicht kommen auch schon Erfahrungen zur Sprache, die die Begleiter bei früheren Aktivitäten gemacht haben. – Alle Treffen der Begleiter sollten in der Methode oder der Eigenart des Gesprächs einen ähnlichen Ablauf haben. Und wie die Teilnehmer vor dem ersten Treffen die Zusammenstellung der Themen kennen sollten, damit sie sich damit vertraut machen können, so sollten sie sich auch auf jeden weiteren Abend in ähnlicher Weise vorbereiten. Dazu kann die Mappe für die Kinder oder das Handbuch für die Begleiter eine wertvolle Hilfe sein. Mit Mappe und Handbuch können die Begleiter den Umfang und die ganze Weite der Thematik in sich aufnehmen. Und an jedem Abend ist der Zugang zum Gespräch dann die Frage, „was das Thema mit mir macht“. Im Einzelnen können das auch mehrere Fragen sein. „Ist das mein Thema? Macht es mir Schwierigkeiten? Bin ich hilflos, verärgert, belastet, in Angst, erfreut, neugierig, gehalten und getragen? Gibt es mir Hoffnung und Zuversicht?“ Um solche Zusammenhänge geht es, kluge Theorien sind nicht gefragt. Und wenn die Themen so mit den eigenen Lebenseinstellungen in Kontakt gebracht werden können, dann ist die Chance groß, dass Glaube und Erkenntnis in der Gruppe wachsen.
Das Ziel des Gesprächs ist ein lebendiger und intensiver Austausch über die Glaubenssituation der Teilnehmer der Gruppe. Wenn sich eine Gruppe neu zusammenfindet, muss man immer damit rechnen, dass es deutliche Startschwierigkeiten gibt. Diese Form des Austauschs wird ja sonst selten trainiert. Und es wird einige Zeit dauern, bis sich das nötige Vertrauen untereinander einstellt. – Bei einer Gruppe, die sich regelmäßig trifft (z.B. Ehekreise), kann diese Beziehung zueinander über längere Zeit allmählich wachsen. Bei Treffen von Begleitern (z.B. für die Vorbereitung auf die Erstkommunion) werden die Themen zunächst stärker im Vordergrund stehen. Wenn die Teilnehmer sich dabei fragen, was die Themen für ihren Glauben bedeuten, dann können die persönlichen Hintergründe nach und nach deutlich werden. In beiden Situationen kann das Gespräch eine innere Dynamik entwickeln, die zunächst getragen wird von der Bereitschaft der Teilnehmer, ihre Erkenntnisse und Vorstellungen in die Gruppe einzubringen. Und vielleicht merkt die Gruppe an einer bestimmten Stelle, wie spannend es ist, mehr zu verstehen und tiefer in die Zusammenhänge einzudringen. Dann wird die Erkenntnis, die Sache oder im Idealfall die Wahrheit zum eigentlichen Antrieb. Erkennen, was ist, was das Evangelium meint, was uns zum Leben verhilft! In diesem Augenblick erlebt die Gruppe, wie der Glaube wächst. An der Stelle ist es dann auch sinnvoll, sich nach den Beiträgen umzusehen, die andere kluge Menschen schon zu Fragen des Glaubens formuliert haben. Es wurde schon erwähnt, dass in den Ehekreisen die Schriften von Otto Betz sehr hilfreich und geschätzt waren (Nr.5). – In der Firmvorbereitung haben wir manchmal eine besondere Form des Gesprächs praktiziert. Die Teilnehmer versetzen sich zum Beispiel in die Situation der Apostel und führten in der Gruppe ein „Apostelgespräch“. Von einem solchen Gespräch wurde bereits erzählt (Nr.60). Die Apostel im Garten Gethsemane schlafen in diesem Beispiel nicht, sondern überlegen, ob und wie sie Jesus in seiner Not und Todesangst helfen können. Und bis auf den heutigen Tag wird immer wieder die Hilflosigkeit in mir wach, die ich bei diesem Gespräch erlebt habe.
Die Atmosphäre im Gespräch muss so sein, dass sie den persönlichen Austausch ermöglicht und stützt. Diese Erkenntnis war uns schon im Firmkurs klar und wichtig. Deswegen gab es da eine verbindliche Anweisung für Kleingruppen-Gespräche (Nr.59). Die braucht hier nur abgedruckt zu werden (mit kleinen Veränderungen):
Die Atmosphäre sollte von Vertrauen, Rücksicht und Diskretion geprägt sein. Alle Formen von Zugreifen, Wissen-wollen, Besser-wissen sind nicht gestattet. Deshalb kann es eigentlich bei solchen Gesprächen keine Diskussionen geben, bei denen Standpunkte gegeneinander gestellt werden.
Da es um persönliche Dinge geht, darf und sollte jeder selbst entscheiden, was er von sich preisgibt und was er für sich behält. Es kann also sein, dass jemand in einer Einzelbeschäftigung viel mehr über sich erkannt hat, aber davon nur einen Teil weitergibt – unter Umständen auch noch in verallgemeinerter Form.
Rückfragen der übrigen Teilnehmer sind gut, wenn sie aus echtem Interesse und Zuwendung gestellt werden. Jeder Versuch, mit – u.U. heimlicher – Gewalt in andere zu dringen, ist unzulässig.
Es muss für alle Beteiligten selbstverständlich sein, dass persönliche Dinge nicht an Außenstehende weitererzählt werden.
Der Rahmen und Leitfaden für das Gespräch wird normalerweise ein Thema sein. Entweder hat sich die Gruppe jeweils für das nächste Treffen oder auch für einen längeren Zeitraum auf Themen geeinigt. Oder die Reihe der Themen ist vorgegeben, wie das bei der Sakramentenvorbereitung meistens der Fall ist. Für die Vorbereitung auf die Erstkommunion gibt es normalerweise eine Mappe, die als Leitfaden dient. Es kann auch sein, dass sich in einer Gemeinde im Laufe mehrerer Jahre schon eine gewisse Tradition gebildet hat, wie und mit welchen Themen die Vorbereitung abläuft.
Es gibt in einer Gemeinde verschiedene Bereiche, in denen das Gespräch als Erkenntnisweg eine Rolle spielen kann. Am häufigsten wird es wohl in der Sakramentenvorbereitung seinen Platz haben, vor allem bei der Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion, dann aber auch beim Glaubenskurs zur Firmung und bei der Begleitung der Eltern vor der Taufe ihrer Kinder. – Die Ehekreise waren von vorneherein als Gesprächsgruppen konzipiert. – Auch bei den Fernsehserien trafen sich feste Begleitgruppen zum Gespräch, die dann nicht nur Themen als Ausgangspunkt hatten, sondern die verschiedenen Szenen, die in den Sendungen gespielt wurden. – Und auch für die Kreise, die Kinder- oder Jugendgottesdienste vorbereiteten, war das Gespräch der Weg, um das Thema zu klären und den Weg für die Verkündigung im Gottesdienst festzulegen.
Für ein solches Gespräch gibt es Schwierigkeiten und Hindernisse. Und das bedeutet, dass die Gemeindekatechese eine sehr anspruchsvolle und gar nicht selbstverständliche Form der Seelsorge ist.
Als wir 1973 in Hochdahl mit der Gemeindekatechese anfingen, waren die Eltern durchweg noch vor dem Krieg geboren. Und die kirchliche Mentalität in der Zeit ihrer Kindheit und Jugend war noch von Druck und Androhung göttlicher Strafen bestimmt. Und im Beichtspiegel stand für diese Eltern noch die Frage, ob sie Zweifel gehabt hätten. Und ich erinnere mich an Aussagen von Eltern damals, die noch die strenge Erziehung bei Nonnen verarbeiten mussten. Mit einem solchen Hintergrund musste es schwerfallen, offen und ehrlich und ohne Angst über den eigenen Glauben, über Unsicherheiten und Schwierigkeiten zu sprechen. Gleichzeitig fühlten diese Eltern eine große Verantwortung für ihre Verkündigung an die Kinder. Leichthin und oberflächlich über Glaubensfragen zu debattiere, kam deshalb als Ausweg nicht in Frage. – Ich habe den Eindruck, dass die Gespräche für die Begleiter in der Firmvorbereitung weniger problematisch waren. Die Jugendlichen hatten damit wohl keine Schwierigkeiten – wie das bei Jugendlichen ja oft ist.
Das Gespräch bei der Gemeindekatechese soll im Idealfall sehr persönlich und offen sein. Eine solche persönliche Beziehung und Praxis wird für manche Menschen schwer zu vollziehen sein. Für viele wird es auch nicht zu ihrer persönlichen Eigenart passen. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass die Gruppe sich auf diese Bedingungen einstellen wird, ohne dass darüber gesprochen werden muss. Aber das bedeutet, dass die theoretischen Vorstellungen in der Praxis nur sehr unterschiedlich Wirklichkeit werden können. Das kann nicht anders sein. Trotzdem dürfte es wertvoll sein, sich durch die Theorie vor Augen zu halten, wie es gehen kann. Vielleicht wird es dadurch auch in der konkreten Situation leichter zu erkennen, wo man gerade steht.
Und von einer Gefährdung soll die Rede sein! In dem Text „Wohlwollende Vertrautheit“ (Nr.60) wird der Gedanke entwickelt, dass der Austausch über das eigene Leben und den eigenen Glauben zu sehr intensiven Begegnungen führt, aus denen sich in der Hochdahler Gemeinde oft sehr beständige Freundschaften entwickelt haben. Ich bin überzeugt, dass das so stimmt und dass wir dafür dankbar sein können. Wenn das Gespräch aber eine derart positive Erfahrung ermöglicht, dann kann es auch geschehen, dass man immer wieder solch schöne Erlebnisse haben möchte, auch wenn die Situation das überhaupt nicht hergibt. Menschen werden abhängig – von ihren Wunschvorstellungen und möglichweise auch voneinander! – Die Teilnehmer sollten sich über eine solche Gefährdung im Klaren sein, dann können sie leichter damit umgehen.
Dann muss aber auch ein Vorteil erwähnt werden, den das Gespräch in der Gemeindekatechese hat. Was oben über die Belastungen durch die alte kirchliche Mentalität gesagt wurde, hatte oft die Folge, dass es selbst in der Familie nur sehr selten ein Gespräch über die persönlichen Glaubensvorstellungen gab. Die gehören ja auch zum Intimsten, was ein Mensch hat. Und wenn man darüber spricht, setzt man sich aus. Allem Anschein nach ist ein Gespräch im Rahmen der Gemeindekatechese viel leichter, weil es immer im Rahmen eines Gruppenprogramms, bei einem Einsatz für Kinder und Jugendliche oder während eines gemeinsamen „Bildungsvorgangs“ stattfindet. Ich habe lange gemeint, eigentlich müsste man ohne solche stützenden Gruppentreffen über sich und seinen Glauben sprechen können. Das war zum Beispiel immer mein Vorbehalt, wenn die Damen der Frauengemeinschaft sagten, sie würden beim Basteln für Bolivien oder Weinachten viel über Glaubensfragen sprechen. Diese Auskunft habe ich lange nicht so richtig ernstgenommen. Irgendwann habe ich mich dann bekehrt, wie man aus dem vorliegenden Text entnehmen kann.
Wenn jemand, der heute in der Seelsorge tätig ist, diesen Text liest, kann er sicher nur den Kopf schütteln. Denn heute ist alles anders und in diesem Fall stimmt der Spruch sogar. Wir hatten in Hochdahl nach 1968/70 fast ideale Bedingungen: die Pfarrei hatte knapp 10.000 Gemeindemitglieder, viele hoch motiviert und bereit, Zeit und Mühe für die Gemeinde auf sich zu nehmen, eine interessierte und hinreichend besetzte Gemeindeleitung. Wir konnten uns eine intensive Vorbereitung auf die Sakramente leisten. – Inzwischen sind die Fusionsproduckte ja Monster – egal welch schönen oder künstlichen Namen sie haben. Wer als Seelsorger „nur“ 20.000 betreuen muss, kann sich noch glücklich fühlen, inzwischen gehen die Zahlen deutlich in Richtung 100.000.
Selbst in dieser Situation würde ich die Gemeindekatechese nicht aufgeben. Wie noch etwas gehen könnte, möchte ich an einem konstruierten Beispiel mit realem Hintergrund beschreiben. Ich stelle mir eine fusionierte Pfarrei vor mit etwa 20.000 Katholiken. In diesem Gebilde gibt es zwei kleine ehemalige Pfarreien, in denen es im Lauf der Jahre immer etwa 20 oder auch weniger Kommunionkinder gegeben hat. Die für die Seelsorge im ganzen Bereich Verantwortlichen behandeln diese beiden Gemeinden nun als Sonderfall: hier werden die Kinder nach Art der Gemeindekatechese auf die Kommunion vorbereitet. Das bedeutet: kleine Gruppen, intensive Arbeit mit den Begleitern, wöchentliche Treffen der Kinder mit ihrer Begleiterin. Das ist nicht als Privilegierung gedacht, sondern soll helfen, dass eine intensive Form der Vorbereitung nicht in dem großen Betrieb untergeht. Und vielleicht erlebt die Eine oder der Andere, wie viel man bei dieser Arbeit für sich selber gewinnt. Dann heißt plötzlich Maria 2.0 nicht mehr „Ich will Priesterin werden“, sondern „ an diesen Platz gehöre ich hin und hier kann ich mehr bewirken als irgendein Priester“. Und so könnte die Verwandlung der Kirche dann beginnen. – Dieses Modell müsste in dieser Großpfarrei wandern. Ob das bereits nach einem Jahr sinnvoll wäre oder nach zwei oder drei, das muss die Realität zeigen. Auch welche Teilbereiche in den größeren ehemaligen Pfarreien ausgewählt werden sollten, kann nur vor Ort geklärt werden. Die Kommunionvorbereitung forderte immer schon eine Menge Phantasie und Einsatz.